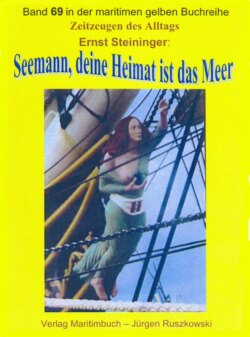Читать книгу Seemann, deine Heimat ist das Meer – Teil 1 - Ernst Steininger - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND in Bremen
ОглавлениеDie SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND war ein Segel-Schulschiff der Handelsschifffahrt. Das letzte deutsche Vollschiff liegt inzwischen als maritimes Denkmal ganzjährig in Bremen-Vegesack. Da der Name „Deutschland“ schon für das bereits geplante, aber noch nicht gebaute Panzerschiff „DEUTSCH-LAND“ der Marine vergeben war, wurde bei der SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND die Funktion Schulschiff mit in den offiziellen Namen aufgenommen.
Geschichte:
Die SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND wurde1927 vom Deutschen Schulschiff-Verein als 4. Schulschiff in Auftrag gegeben. Am 14. Juni 1927 lief sie bei der Tecklenborg-Werft in Geestemünde (heute Bremerhaven) vom Stapel.
Von 1927 bis 1939 unternahm sie Ausbildungsfahrten nach Übersee und in Nord- und Ostsee. Während des Zweiten Weltkrieges waren diese Reisen eingeschränkt und fanden nur noch in der Ostsee statt. Durch einen kurzen Einsatz als Lazarett-Schiff konnte nach Kriegsende verhindert werden, dass sie als Reparationsleistung abgegeben werden musste.
Zwischen 1949 und 1952 diente sie drei Jahre lang als Jugendherberge, bevor sie anschließend in Bremen wieder als stationäres Schulschiff für Seefahrtschüler genutzt wurde. Im Jahre 1995 wurde sie als schwimmendes Denkmal anerkannt und 1995/1996 in Bremen-Vegesack renoviert. Bis zum Juli 2001 wohnten Schiffsmechaniker an Bord, die in einem Bremer Schulzentrum ausgebildet wurden. Mit der Einstellung dieser Ausbildung in Bremen wurde das Kapitel der Seemannsschule Bremen geschlossen.
Heute liegt das SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND in Bremen-Vegesack und kann dort als maritimes Denkmal besucht werden.
Technische Daten
Art: 3-Mast-Bark / Stahl
Nation: Deutschland
Reederei: Deutscher Schulschiff-Verein
Schiffsgattung: Vollschiff
Bauwerft: Joh. C. Tecklenborg, Geestemünde
Stapellauf: 14. Juni 1927
Länge über alles: 88,2 m
Breite über alles: 11,9 m
Seitenhöhe bis Hauptdeck: 7,3 m
Konstruktionstiefgang: 5,2 m
Bruttoraumgehalt: 1.257 BRT
Segelfläche: 1.900 m²
Anzahl der Segel: 25
Höhe des Vormastes: 50 m
Höhe des Großtopps: 52 m
Höhe des Kreuztopps: 48 m
entnommen: http://lexikon.freenet.de/Schulschiff_Deutschland
Am späten Vormittag des 9. Dezember 1957 kam ich müde und wie „gerädert“ in Bremen an. Die Nachtfahrt im streckenweise überfüllten Zug, die ich teils im Sitzen, teils im Stehen verbracht hatte, war alles andere denn angenehm gewesen. Von Passau bis Würzburg stand ich im Gang eines Zweite-Klasse-Waggons und behinderte mit meinem voll gestopften Seesack, den ich mir ja schon vorher vorsorglich besorgt hatte, die pflichteifrigen BGS-Beamten, die misstrauisch meine Papiere kontrollierten. Dem mit einer roten „Schärpe“ ausgestatteten dickleibigen Zugführer und den ständig hin und her wuselnden Passagieren war ich ganz offensichtlich auch ein Hindernis. Ab Würzburg, wo ich umzusteigen hatte, wurde es ruhiger. Obwohl ich nun einen Sitzplatz hatte, konnte ich dennoch nicht schlafen. Ich starrte in die vorbeihuschende, stockfinstere Nacht und kam mir auf einmal sehr verlassen vor. Der Anfangstext irgendeines Schlagers hatte sich in meinem Kopf verhakt: „Und ein Zug fährt durch die Nacht, durch die fremde, dunkle Nacht…“ Es folgten unverhältnismäßig lange Aufenthalte in geisterhaft leeren Bahnhöfen: Fulda, Bebra, Eschwege, hier irgendwo, ganz in der Nähe verlief die Grenze. Die Grenze zwischen „Gut“ und „Bös“? Die Grenze zwischen Freiheit und Unfreiheit? Ganz sicherlich aber eine Grenze der Reisefreiheit – von der ich, Gott sei Dank, nicht betroffen war… Göttingen: Es wird Tag, unausgeschlafene, mürrisch blickende, unhöfliche Menschen stürmen ins Abteil, um „ihren“ Sitzplatz zu ergattern. Es ist ganz offensichtlich, ich bin schon wieder im Weg. Ab Hannover, nach neuerlichem Umsteigen, heißt es wieder Stehen. Über dem weiten, flachen Land hängt eine niedrige, graue Wolkendecke, die kahlen, nassdunklen Bäume an den Ufern der Bäche und Flüsse stehen wie nackte Gespenster im rauchigen Nebel… Endlich – obwohl ich das Ende der Reise noch gerne ein bisschen hinausgeschoben hätte – ratterten die Räder des Zuges über die Weichen des Bremer Hauptbahnhofes. Weichen haben etwas Schicksalhaftes an sich. Diese Weiche hatte ich mir selbst gestellt. Wohlan, vorwärts und keinen überflüssigen Blick mehr zurück…
Dorthin will ich und ich traue
mir fortan und meinem Griff.
Offen liegt das Meer, ins Blaue
treibt mein Genueser Schiff.
Alles glänzt mir neu und neuer,
Mittag schläft auf Raum und Zeit: -
Nur dein Auge – ungeheuer
blickt mich’s an: Unendlichkeit!
Friedrich Nietzsche
Also gab ich mich entschlossen, schulterte meinen nagelneuen, mit Klamotten voll gestopften „Seesack“, bewegte mich wiegenden Schrittes vom Bahnsteig über die Verbindungstreppen zur geräumigen, imposanten Schalterhalle. Dort hielt ich erst einmal inne, um mich zu orientieren. Der Liegeplatz des Schiffes war mir bekannt. Der war am jenseitigen Ufer der Weser, dicht an der Eisenbahnbrücke, die parallel zur Stephani-Brücke verläuft und die Bremen–Mitte mit dem Stadtteil Neustadt verbindet. Das ist vom Hauptbahnhof und zu Fuß ein ganz schönes Ende. Während ich noch überlegte, fiel mein Blick auf einen jungen Mann, der – ebenso ausgerüstet wie ich – ebenso ratlos in die Gegend guckte. Wir machten uns bekannt und stellten amüsiert fest, dass wir fast denselben Dialekt sprachen: Der „Kollege“ stammte aus Niederbayern…
Unisono beschlossen wir, uns den Luxus eines Taxis zu leisten. Guten Mutes entstiegen wir dann dem Taxi und standen unvermittelt vor dem schwarzen Eisenrumpf des an dicken Dalben angebundenen Segelschiffes. Die sich uns darbietende Backbord-Seite war in einer Linie von vorn bis hinten von kleinen kreisrunden, fest verschlossenen Bullaugen durchlöchert. Drei mit nackten Rahen bespickte Masten ragten wie Jakobsleitern in die tief hängende graue Wolkenschicht. Von der Uferböschung zum Schiff führte eine stabile Holzbrücke, an deren landseitigem Ende sich ein Wachhäuschen befand. Darin stand ein schneidiger Junge, angetan mit einer langen, marineblauen Flatterhose, einer marineblauen Matrosenbluse und einer dunkelblauen Pudelmütze. Der wies uns den Weg, ohne sich weiter um uns zu kümmern oder sonst irgendwie behilflich zu sein. Also schleppten wir unsere Seesäcke über die schmale, mit Handläufen versehene glitschige Holzbrücke, an deren Ende wir über eine kurze hölzerne Treppe auf die ebenso glitschigen Holzplanken des Hauptdecks gelangten.
So, bis hierher hatte ich es geschafft. Endlich, endlich war ich am Ziel! Stolz und Genugtuung schwellten meine doch noch etwas schmächtige Seemannsbrust: Aber ach, dieser Zustand euphorischen Hochgefühls währte nur kurz. Direkt vor uns hatte sich breitbeinig ein kleiner, grantig blickender „Klabautermann“ aufgebaut. Das offensichtlich missmutig gestimmte Männchen in dunkelblauer Schiffermontur mit dem roten, zerfurchten Krebsgesicht unter der flachen Schiffermütze war kein anderer als der berühmt-berüchtigte Bootsmann Mau. Einige bange Augenblicke lang musterte er uns verächtlich, so wie eine satte Spinne, die zu faul ist, ihre Opfer anzuspringen. Dann plötzlich – meine Knie begannen bereits weich zu werden – blökte er uns unvermittelt an: „Ihr vom Land herein geschissenen Mistbauern, was steht ihr hier dumm rum und glotzt Bauklötze. Bewegt gefälligst eure Ärsche und seht zu, dass ihr unter Deck verschwindet!“ Sprach’s und schob uns beide sehr energisch in Richtung Niedergang…
Bootsmann Mau – ein „old sailor“ von echtem Schrot und Korn – war bereits zu Lebzeiten eine Legende. Seine Autorität wurde von niemandem auch nur angezweifelt. Die „kernigsten“ unter uns angehenden Schiffsjungen, die ihn wie einen maritimen Guru umschmeichelten und umschwänzelten, durften sich unter seiner Obhut schon einiges erlauben. Ich gehörte nicht dazu… Und so gab es auch reichlich Ärger für mich, als ich doch einmal beim verbotenen „Aufentern“ in die Masten erwischt und verpetzt wurde. Die Aussicht, im Wiederholungsfall gefeuert zu werden, verleidete mir dieses seemännisch-sportliche Vergnügen für den Rest meiner Anwesenheit an Bord. Überhaupt wurden meine Vorstellungen vom abenteuerlichen, romantischen Seemannsleben, woran ein gewisser Herr „Ringelnatz“ auch nicht ganz unschuldig war, schon bald schwer erschüttert. Hoch oben, in der Saling des Großtopps, da ließ es sich noch träumen von der Weite des Meeres; von Gischt schäumenden, anrollenden Wellenbergen, im brüllenden Sturmwind dahinjagenden Windjammern, von Kap Hoorn, von Feuerland…
Segelschiffe
Sie haben das mächtige Meer unterm Bauch
und über sich Wolken und Sterne.
Sie lassen sich fahren vom himmlischen Hauch
mit Herrenblick in die Ferne.
Sie schaukeln kokett in des Schicksals Hand
wie trunkene Schmetterlinge.
Aber sie tragen von Land zu Land
fürsorglich wertvolle Dinge.
Wie das im Winde liegt und sich wiegt,
Tauwebüberspannt durch die Wogen,
da ist eine Kunst, die friedlich siegt,
und ihr Fleiß ist nicht verlogen.
Es rauscht wie Freiheit. Es riecht wie Welt. –
Natur gewordene Planken
sind Segelschiffe. – Ihr Anblick erhellt
und weitet unsere Gedanken.
Ringelnatz
… Feuerland, wie es Magellan noch vorfand, mit vielen Feuerchen an allen Ecken und Enden, an denen sich die pudelnackten einheimischen Indios wärmten. Ich hingegen, was sah ich? Ich sah auf die Stahlkonstruktion der Eisenbahnbrücke; sah die Silhouette der Stephani-Kirche und nächtens, vom Europahafen herüber strahlend, das rötlich-lila leuchtende Reklameschild von „Reidemeister und Ullrich“…
Der Anfang meiner Seemannskarriere war halt alles andere als das, was ich mir vorgestellt hatte. Einige von uns Jungs wurden mit irgendwelchen Funktionen betraut, die zum laufenden Schiffsbetrieb gehörten. Mich steckte man, aus welchen Gründen auch immer, in die „Pantry“. Das ist die Anrichte für die Offiziersmesse. Ich hatte somit die zweifelhafte Ehre, die Herren Offiziere bedienen zu dürfen. Für mich brach eine Welt zusammen, ich war wie am Boden zerstört. Matrose wollte ich werden – und nicht Kellner! Ich wehrte mich vehement, doch weder Tränen der Wut noch Tauschvorschläge – lieber wollte ich Heizungswart, Ascheträger oder sonst was sein – fruchteten etwas. Es war beschlossene Sache. Von wem? Vielleicht von Mau, der mir nicht gewogen war – auf alle Fälle aber von Kapitän K., und das war ein massiger, stiernackiger, rundköpfiger Bayer. Nachdem ich in den Job eingeführt war, merkte ich aber bald, dass er nicht nur Nachteile hatte. Nicht nur, dass ich nicht bei jedem Scheißwetter irgendeine Scheißübung mitmachen musste – durch meinen Pantry-Dienst war ich immer wieder verhindert. Auch die Vorteile einer Pantry-Kombüse-Connection sollte ich bald schätzen lernen.
Die Kombüse war in dem schmalen, niederen Decksaufbau auf dem Vorschiff untergebracht, die Kabinen des Kapitäns und der Offiziere achtern unter dem erhöhten Poopdeck. Dort befanden sich auch meine „Wirkungsstätten“, die Pantry und die O-Messe. Diese räumliche Distanz bedingte, dass ich als „Essensträger“ der ständigen „Hänselei“ meiner Kameraden ausgesetzt war, von denen nicht wenige neidisch auf meinen lukrativen Job waren. Das „Lukrative“ für mich war mein gutes Verhältnis zur „Mutti“, der mir wohlgesinnten, schon ein wenig betagten Köchin. Sie sah, wenn auch bissig witzelnd, so doch milde lächelnd über meine „natürliche“ Abneigung gegen norddeutsche Essenszubereitung hinweg. Zum Beispiel: zermanschter Grünkohl, der mich lebhaft an frisch hingeschissene Kuhfladen erinnerte, oder wässrig-teigige Klöße, die auch im Entferntesten nichts mit einem festen Mehl- oder Semmelknödel gemein haben. Dank Muttis Beistand – in Form von Pudding-Nachschlägen und allerlei anderen Leckereien – und dank der kondensierten Dosenmilch für das Offiziersfrühstück, die ich, wenn auch rationiert, im Kühlschrank „meiner“ Pantry verwahrte, überlebte ich diese erste schlimme Zeit elementarer „Fress-Zäsur“ (der Gerechtigkeit halber: Nach einer etwas längeren Karenzzeit begann mir die Norddeutsche Kost durchaus zu munden. Mittlerweile gehört Grünkohl mit Pinkel in der kalten Jahreszeit zu meinen Wunschgerichten.)
Der Kapitän, der die Luxusgüter wie Bohnenkaffee und Kaffeesahne für die O-Messe verwaltete – der Rest der Besatzung musste sich mit „Muckefuck“ abfinden – brachte mich alsbald mit erhöhtem Dosenmilchverbrauch in Verbindung. Zwischen ihm und mir entspann sich ein zäher Kleinkrieg, den die Herren Offiziere damit bezahlten, dass ihre Kaffeesahne immer dünnflüssiger wurde. Hin und wieder befahl mich der „Alte“ zum Rapport in sein Kapitänslogis, sein „Heiligtum“, um mir nutzlose Vorträge über sparsameren Umgang mit Dosenmilch zu halten. Massig, wie er nun einmal war, saß er eingeklemmt in seinem Polstersessel, den runden, kurz geschorenen Schädel mit dem feisten Stiernacken über den Arbeitstisch gebeugt. Auf diesem lagerten nicht etwa Papiere oder was sonst so auf Schreibtischen zu liegen pflegt, sondern – Uhren! Armbanduhren, Eieruhren, kleinere Chronometer, teils ganz, teils in ihren Einzelteilen. Und während er mir, ohne mich dabei auch nur anzusehen, die Leviten las, hantierten seine dicken Wurstfinger mit feinen Pinzetten, winzigen Rädchen, Federchen… Das also – vom Rationieren der Luxusfurage mal abgesehen – war die Hauptbeschäftigung des Herrn Kapitän. Für alles andere hatte er ja seine Offiziere, drei Stück an der Zahl und – last not least – Bootsmann Mau. Während der Alte, vor sich hin räsonierend, mit seinem Spielzeug beschäftigt war, starrte ich wie gebannt auf dessen feisten Nacken und – dachte dabei an das unrühmliche Ende des Franzosenkönigs Ludwig den XVI…
Die Aufenthaltsräume für uns Jungs waren unter dem Hauptdeck. Es waren deren vier; zwei hintereinander an jeder Seite, getrennt durch ein mittschiffs verlaufendes Längsschott. An der niederen Decke waren in Reih und Glied die Eisenhaken für unsere Betten, die Hängematten, angebracht. Ferner waren da noch breite, bewegliche Eisenbügel. Sie dienten dem Platz sparenden Verstauen unserer Tische und Bänke – das waren glatt gehobelte lange Bretter. Dann gab es da noch den Wassergraben an der Außenbordseite. Der war zum Auffangen und Ablaufen des latent von der eisernen Außenhaut abtropfenden Schweißwassers gedacht. Diese etwa 15 cm breite und einige Zentimeter tiefe, dick mit roter Farbe beschmierte eiserne Rinne war das Lieblings-Kontroll-Objekt des allgegenwärtigen Bootsmann Mau auf seinem abendlichen Inspektionsgang durch die Mannschaftsräume. Wehe, er hatte schlechte Laune! Der Graben konnte noch so sauber geleckt und gewienert sein; auch wenn es absolut nichts zu finden gab – Bootsmann Mau fand was. Das hieß: Warten! Warten, bis der Bootsmann seine Inspektion durch die anderen Mannschaftsräume beendet hatte und… Und – auch wenn inzwischen keiner einen Finger gerührt hatte – war es ihm dann entweder recht – oder eben nicht. Auffallend war, dass es vor allem immer wieder die „Greenhorns“, also die Gruppe der Neuzugänge, traf. War es ihm dann endlich recht, holte jeder seine zu einer stabilen Wurst zusammengerollte Hängematte aus dem „Bettkasten“ und brachte sie unter den Eisenhaken in Position. Nach dem Aufschnüren der Wurst wurden die Ringe in die Haken eingehängt, und fertig war das Bett.
Sofern ich nicht durch böswillige Kameraden daran gehindert wurde, habe ich darin auch vorzüglich geschlafen. Es war nämlich ein gängiger, wenn auch schlechter Scherz, unbeliebte Kameraden durch das Aushängen des Ringes am Fußende unsanft aus dem Schlaf zu reißen. Natürlich gab es dann immer Tumult, und natürlich war es dann auch keiner gewesen. Für Bootsmann Mau war das auch keine Frage. Er dachte gar nicht daran, die Übeltäter ausfindig zu machen. Für ihn gab es nur die Sippenhaft und als Disziplinarmaßnahme „Hängemattenstemmen“! Das heißt, alle hatten – und wenn es mitten in der Nacht war und bei jedem Wetter – in Windeseile ihre Hängematte zu schnüren und damit prompt an Deck zu erscheinen. Und dann, schön in Reih und Glied breitbeinig aufgestellt, die Arme, mit der Wurst in den Händen, hoch ausgestreckt und: Eins und zwei, eins und zwei, hoch und nieder, hoch und nieder… Wehe jenen, die da ihr Bündel nicht gut verschnürt hatten. Die zu stemmende Wurst musste steif und fest wie eine Salami sein und durfte nicht wie ein schlappes Wiener Würstel Kraft raubend überm Kopf zappeln. Wer dann noch das Unglück hatte, dass ihm die Eingeweide seiner Wurst – Kopfkissen, Decke, Laken – austraten, der hatte wirklich schlechte Karten. Nicht nur, dass er nach dem „Aufbereiten“ seiner Wurst noch alleine eine Zeitlang weiterstemmen durfte – nein, er war sich auch des Spottes seiner „Kameraden“ sicher.
Kameraden? Die Übeltäter, die auch davor nicht zurückschreckten, ihr auserwähltes Opfer – in der Regel ein „schwächelndes“ Individuum bzw. jemand, der sich nicht unbedingt mannschaftskonform verhielt – am Kopfende der Hängematte auszuhaken, kamen meist selbst aus dem „inneren Kreis“ um Bootsmann Mau. Nicht, dass ich ihm im Nachhinein unterstellen will, dass er davon wusste. Das nicht. Aber dass selbst nach solch kriminellen Vergehen nicht einmal der Versuch unternommen wurde, jemanden zur Verantwortung zu ziehen, das zeigt doch deutlich, wes Geistes Kind unsere damaligen Vorgesetzten waren. Der 1. Offizier Sch., ein hoch aufgeschossener, hagerer Mann mit dem „outfit“ eines Gregory Peck in Marineuniform, hatte auf dem Schiff schon Dienst getan, als es noch unter der „Reichsflagge“ segelte. Damit will ich ihm aber nicht ans Bein pinkeln. Sch. war der Offizier, der den morgendlichen Appell mit witzigen Bemerkungen aufzulockern verstand. Sein Verständnis für die Sorgen Einzelner, seine Freundlichkeit machte ihn allseits beliebt. Was aber nun den Bordalltag betraf, da hatte er wohl wenig zu sagen. Das Regiment führte Bootsmann Mau. U. war einer der beiden 2. Offiziere. Von Statur groß und kräftig, die Uniformjacke meist ungeknöpft, leger getragen, verkörperte er den Typ eines Robert Mitchum. Er war der Klassenvorstand meines Kurses. Was wir genau bei ihm lernten – daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber irgendwas mussten wir gelernt haben, schließlich bin ich noch heute im Besitz eines benoteten Zeugnisses.
Bittesehr:
Führung: sehr gut
Fleiß: sehr gut
Praktische Kenntnisse befriedigend
Theoretische Kenntnisse gut
Bootsdienst gut
Allgemeines Wissen befriedigend
Dass mein allgemeines Wissen gerade mal nur mit einer Drei honoriert wurde, dass ärgert mich noch heute. Fühlte ich mich doch auf diesem Gebiet den meisten meiner Kollegen haushoch überlegen – siehe Ludwig der XVI … Praktische Kenntnisse, wie Knoten und Spleiße, wurden uns von dem 2. Bootsmann B. beigebracht. Der damals noch relativ junge Mann war während seiner aktiven Fahrenszeit auf einem der noch verbliebenen „Windjammer“ angeblich aus dem Mast gestürzt. Seitdem hinkte er und hieß deshalb der „Schleicher“. Es hieß, man müsse sich vor ihm in Acht nehmen. Warum? Das habe ich niemals konkret erfahren. In Acht nehmen musste ich mich vor dem 2. Offz. U., dem war ich wohl etwas zu vorlaut. Mein Platz im „Unterrichtsraum“ war unmittelbar neben dem Eingang zum Niedergang, also der Treppe zum Hauptdeck. Die Tür öffnete sich in den Raum, und ich bekam die jeweilige Person erst dann zu Gesicht, wenn sie bereits eingetreten war. Nun kam es immer wieder vor, dass durch die nur halbgeöffnete Tür, nach vorn hin, eine Meldung durchgegeben wurde und darauf der „Melder“ wieder abzog, ohne die Tür ordentlich zu schließen. Bei so einer Gelegenheit – es war schließlich Winter, und ich saß dann im kalten Luftzug – plärrte ich, echt seemännisch und aus vollem Hals: „Schott dicht!“ Das Gemurmel und Geraune im Raum verstummte abrupt. Am vorderen Ende richtete sich U. auf, wurde länger und länger, nahm mich mit kaltem, unheilschwangerem Blick in die Zange und sagte: „Steininger, du Würstchen…“ Und noch einiges mehr – wie sollte ich auch wissen, dass in diesem Fall der „Melder“ niemand geringerer war als der andere 2. Offizier, Herr B.!
B., ein kleiner schneidiger Mann in stets tadellos sitzender Uniform, nahm mir das aber nicht weiter krumm, jedenfalls durfte ich ihm in meiner Eigenschaft als „Pantry“ auch weiterhin den Kaffee servieren. Ohnehin nahm mich der mir aufgehalste Pantry-Job so in Anspruch, dass der reguläre Schulbetrieb mitunter glatt an mir vorbeilief. Die Note „Gut“ im Bootsdienst verwundert mich ebenfalls noch heute: Ich kann mich kaum erinnern, überhaupt einmal im Übungskutter gesessen zu haben. Dafür erinnere ich mich umso mehr an missglückte Auftritte als eleganter Oberkellner. Wie z. B. während der Weihnachtsfeier im „Saloon“ des Schiffes, zu der der Kapitän die Herren Offiziere samt Familien geladen hatte. Die feinen Damen irritierten mich, die Gören nervten mich. So passierte es, dass sich der Inhalt eines Sahnekännchens auf den mit feinem Tuch bedeckten Schoß einer der Offiziersfrauen ergoss. Meine spontanen Reinigungsversuche machten die Sache nicht besser, und für den Rest der Feier verdrückte ich mich dann schamhaft in „meine“ Pantry…
Ebenfalls unvergesslich bleibt mir der Silvesterabend des Jahres 1957. Zu den Feiertagen waren nur eine Handvoll Jungs an Bord geblieben. Diejenigen halt, die so wie ich, allzu weit von zu Hause entfernt waren. Auch von den Offizieren war nur der wahrscheinlich unbeweibte Kapitän anwesend. Diesem gefiel es, wie auf Kauffahrteischiffen üblich, zum Jahreswechsel ein kleines Feuerwerk zu veranstalten. Zu diesem Zweck wurden achtern an der Reling des Poopdecks ein paar Feuerwerkskörper in Stellung gebracht, um sie um Mitternacht abzufeuern. Das Wetter war typisch bremisch: feuchtkalt. Ein dünner Schneeregen verwandelte das bisschen Schnee an Deck in tückischen Matsch. Als es dann soweit war, dass die Raketen gezündet werden sollten, entsann sich der Kapitän der vorn auf der Back befindlichen Schiffsglocke, die doch auch geläutet werden sollte. In blindem Eifer, der Rutschgefahr nicht achtend, stürzte ich los und – da ich auf dem Schneematsch natürlich nicht zum Stehen kam – stürzte ich auch Hals über Kopf die Treppe zum Hauptdeck hinunter. So etwas übersteht man eigentlich nur in Zeichentrickfilmen unbeschadet. Im ersten Moment dachte ich, das gleichzeitig einsetzende Feuerwerk und Gehupe der in den Häfen liegenden Schiffe entstamme meinem Kopf. Spätestens, als ich merkte, dass dem doch nicht so war, rappelte ich mich hoch und stellte erleichtert fest, dass noch alles heil war. Zur Back gelangte ich dann aber doch nicht ganz so schnell wie von der Poop hinunter aufs Hauptdeck. Aber einmal dort angekommen, läutete ich mit zusammen gebissenen Zähnen die Schiffsglocke so heftig wie vor noch nicht allzu langer Zeit als Ministrant die Angelus-Glocke…
– Schiffsjunge Ernst Steininger –
Wenn man davon absieht, dass mich mein unbefriedigendes Sexualleben für den Rest der Schulungszeit unter den Kameraden ein wenig in Verruf brachte, wäre das Thema Schulschiff eigentlich schon abgeschlossen. Mein Sexualleben!? Verklemmt und gehemmt, wie ich in dieser Sache durch meine „klösterliche“ Erziehung nun einmal war, bestand es lediglich aus heimlichem Onanieren. Ich beneidete meine Kameraden; für die schien sexueller Kontakt zum anderen Geschlecht das Selbstverständlichste von der Welt zu sein. Eines Tages bemerkte ich, dass vor dem an Land stehenden Wachhäuschen nicht wenige Kameraden sich aufgeregt gegenseitig auf die Füße traten. Der Grund: Im Wachhäuschen hielten sich angeblich Mädchen auf, die sich nicht nur befummeln ließen, hieß es… Nach Dienstende, erst als es dunkelte, wagte auch ich mich zum Wachhäuschen, um das es inzwischen ruhig geworden war. Aber tatsächlich: Außer dem „Posten“ war da auch noch ein Mädchen von schwer einschätzbarem Alter. Ihr schmutzigbrauner Kamelhaarmantel stand offen und gab den Blick frei auf handfeste Konturen. In ihren Gesichtszügen vermeinte ich gleichgültige Hochmütigkeit zu erkennen. Offensichtlich erwartete sie von mir, dass ich zur Sache käme. Aber um sie nun direkt anzugehen – dafür fehlte mir der Mut. Und außerdem, da war ja auch noch der „Postenjunge“… Jedenfalls war sie dann damit einverstanden, dass ich sie nach Hause begleiten wollte. Aus meiner Sicht war das Mädchen eine Nutte, eine „Amateuse“, und bei der erstbesten Gelegenheit nahm ich mir das Recht heraus, sie zu befummeln. Ich wollte endlich den mich quälenden Status meiner „Jungfräulichkeit“ beendet sehen. Doch wehe, das Luder, an der sich meine Kameraden – wenn es stimmte, was sie erzählten – reihenweise vergehen durften, klopfte mir auf die Finger: sprach von ein andermal und appellierte an meine „Anständigkeit“. Ich war so beeindruckt, dass ich sie doch tatsächlich noch bis zu ihrem Zuhause – irgendwo im hintersten Gröpelingen – begleitete. Dann ertränkte ich meinen Kummer im „Schwarzen Anker“. Fazit: Nicht nur, dass aus meiner „Entjungferung“ wieder nichts geworden war; auch der Spott meiner Kameraden traf mich hart. Sie betrachteten es als ein männliches Versagen, dass ich es nicht nur nicht vor Ort mit ihr getrieben, sondern sie auch noch nach Hause gebracht hatte.
Aber selbst dieses frustrierende Erlebnis mochte nicht zu verhindern, dass ich mich sterblich in eine strohblonde, dralle Kellnerin verliebte. Meine knappe Freizeit verbrachte ich – von sporadischen Kinobesuchen abgesehen – am liebsten in den Häfen. Vor allen im Überseehafen, weil dort die großen Linienfrachter des „Norddeutschen Lloyd“ und die Schwergutschiffe der „Hansa-Linie“ nach ihren großen Reisen anlegten. Während das Fahrtgebiet der „Hansa“ der Persische Golf war, von dem man in „Insiderkreisen“ eher abfällig sprach, so standen die weltumspannenden Reisen der Lloyd-Schiffe bei den Fahrensleuten hoch im Kurs. Bei mir natürlich auch, und ich wünschte mir sehnlichst, nach meiner Schiffsjungen-Ausbildung auf einem dieser Schiffe mit den unverwechselbaren ockergelben Schornsteinen zu fahren…
Seefahrt
Wie viele Gedanken begleiten
erwartend die Schiffe, hin, her, von Land!
Manchmal gleichen auf See die Zeiten
Dachzimmerchen ohne Wand.
Wenn Schiffe verschollen geblieben,
untergegangen sind,
Fragt niemand mehr: Welcher Wunsch, welcher Wind
hat das Schiff in die Ferne getrieben?
Was ist’s, was die Schiffe meistert,
durch die Möglichkeiten sie leitet?
Der Mut, der den Weltblick begeistert,
Rauleben, das Kleinblicke weitet.
Mit Ehrlichkeit durch Gefahr. –
Vielleicht ist das morgen nicht mehr.
Doch Seefahrt, wie vordem sie war,
war wunderbar.
Roch nach Gewürzen und Teer.
Ringelnatz
Auf meinem Wege zum Überseehafen durchquerte ich auch stets das Gelände des Europahafens. Da stand als Anbau eines Hafengebäudes die „Muggenburg“; eine einfache Kneipe für einfache Schauerleute mit im Raum verstreuten Esstischen und einem langen, wuchtigen Tresen. Und an diesem langen Tresen hing dann immer wieder mal ein junger Mann mit langer Nase über dem Bierglase und folgte mit treuherzig ergebenen Blicken den behenden Bewegungen der schon erwähnten Blondine. Der „seuten Deern“ blieb das natürlich nicht verborgen, aber wie es halt so ist im Leben – ich ward gewogen und zu leicht befunden…
Der Ausbildungskurs ging zu Ende, und ich fragte mich, was ich außer meiner „Kellnerausbildung“ eigentlich sonst noch gelernt hatte. Sicher, die meisten Knoten beherrschte ich, und auch den „Prüfungs-Spleiß“ hatte ich irgendwie hingekriegt. Von all dem theoretischen Kram hatte ich jedoch nicht viel mitbekommen – und der Bootsdienst, na ja… Ob das wohl reichen würde, um als Schiffsjunge auf einem der großen Pötte zu bestehen?
Am Vormittag des 7. März 1958 befahl mich Kapitän K. zum letzten Mal in sein Uhren-Kabinett, um mir das von der Heuerstelle der Hansestadt Bremen ausgestellte Seefahrtbuch zu übergeben.
Darin wurde mir durch Stempel und seine eigenhändige Unterschrift bescheinigt, dass ich an Bord des Schulschiffes SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND vom 9. Dezember 1957 bis 8. März 1958 mit Erfolg an einem Vorauslehrgang teilgenommen hatte. Zugleich wies er mich an, dass ich mich so schnell wie möglich in der Heuerstelle im Europahafen bei einem gewissen Herrn Maier einfinden sollte. Der hätte bereits aufgrund seiner Fürsprache ein passendes Schiff für mich parat…