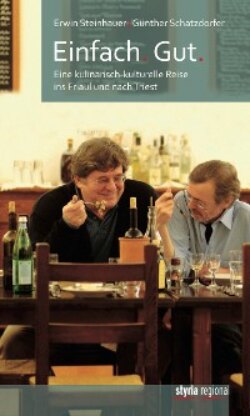Читать книгу Einfach. Gut. - Erwin Steinhauer - Страница 11
Eine Bruchstelle im Kontinent
ОглавлениеKaum wo ist die Grenze zwischen Norden und Süden so scharf gezogen wie in Venzone. Eben noch war man im alpinen Bauernland mit seinen schweren, von knorrigen Obstbäumen umgebenen Gehöften und Stallungen, hat Ortschaften gesehen, die typische Märkte sind, dominiert von Kirchen im Stil des südbayrischen Barock. Landschaftlich und architektonisch sind kaum Unterschiede auszumachen zu den südalpinen Gegenden Sloweniens oder Tirols. Und plötzlich, wo sich das Tal des Tagliamento zwischen dem Monte Simeone und dem Monte Plauris zu weiten beginnt, wächst der erste Wein und steht die erste italienische Stadt: Venzone.
Der Ort ist nicht groß, aber doch eine Stadt mit allem, was dazugehört: ein Dom aus dem 14. Jahrhundert, ein ebenso altes Rathaus in venezianischem Stil, mit Arkaden und einer Freitreppe, und mit Gassen, gesäumt von Häusern, die keine Häuser mehr sind, sondern kleine Palazzi. Vor allem hat Venzone eine Piazza, auf der und um die herum sich das Leben abspielt, eine Agora. In den Städtchen im Gebirge wäre so was eine gotteslästerliche Verschwendung von Weide- und Bauland. Aber hier beginnt die Erde üppige Flächen zu haben.
Venzone ist in die letzte Talenge hineingebaut, wie ein gigantisches Schlachtschiff aus Stein, das den Stürmen der Geschichte trotzte, den unzähligen blutigen Kriegen, welche die Patriarchen von Aquileia oder die venezianischen Dogen führten, der deutsche Kaiser, die österreichischen Fürsten und die napoleonischen Truppen. Vom Ersten Weltkrieg blieb es weitgehend verschont, auch wenn hier der Geschützdonner zu hören war, Truppen verpflegt und Verletzte versorgt werden mußten. Erst das Erdbeben vom Mai 1976 und die Nachbeben im September machten die Stadt dem Erdboden gleich. Nur fünf Prozent der Bausubstanz blieben erhalten, viele Tote waren zu beklagen. Dank des Fleißes und der Beharrlichkeit der Überlebenden steht heute Venzone wieder da, als wäre ihm kein Leid geschehen. Nichts deutet auf einen Wiederaufbau hin. Es ist ein stattlicher mittelalterlicher Borgo, dessen Bewohner sich durchaus dessen bewußt sind.
Auf einer ihrer Fahrten Richtung Meer erinnerten sich der Schauspieler und der Poet daran, daß die Straße ihrer Kindheit auf dem Weg in die Ferien an den Stadtmauern von Venzone vorbeiführte, und sie beschlossen, dort Rast zu machen. Es war ein heißer Sonntag im Sommer, als sie die Autobahn bei Carnia verließen und auf der alten Straße Richtung Süden gondelten, durstig, hungrig und dennoch in freudiger Erwartung. Die Stadt empfing sie mit einem Fahrverbotsschild. Sie suchten einen Parkplatz im Schatten. Schatten gab es keinen. Also stellten sie das Auto in die Sonne und schleppten sich durch das Stadttor. Der Ort schien ausgestorben zu sein und präsentierte sich wie ein architektonisches Modell, welches sie durchschritten, als wären sie selbst bloß Figuren in einer Animation. Die ersten Menschen, die sie trafen, waren zwei fröhliche junge Frauen, die dabei waren, ihr Geschäft auf der Piazza mit Zitronenbäumen, Zweigen und Girlanden mit Früchten zu dekorieren. Sie waren also im Süden, unterhielten sich mit den Damen, hielten ihnen die Leiter und gaben nützliche technische Ratschläge, wie Männer das halt so tun, wenn sie flirten. Man kam überein, einen Aperitivo miteinander zu nehmen.
Gegenüber drangen Stimmen aus dem Caffè Vecchio. Drinnen, im Halbdunkel, saßen ein paar alte Männer, lasen Zeitung, sprachen kaum. Ein junges Paar löffelte Eis. Eine Fliege machte mehr Geräusch als die Kühlanlage der Bar. Die Zeit war stehengeblieben, lange vor dem Erdbeben, das die zwei jungen Frauen nicht erlebt hatten, weil sie damals noch gar nicht auf der Welt waren. Als sie heranwuchsen, war Venzone schon wieder Venzone; die Zerstörungen kennen sie nur von den Photos, die in der Loggia des Rathauses ausgestellt sind. Jolanda und Mariella sind beide Keramikerinnen geworden. Die Stadt und ihre Bewohner leben vom Kunsthandwerk, auch Kunstschmiede und Herrgottsschnitzer gibt es hier.
Schräg gegenüber, in der Straße, die zum Dom führt, liegt rechter Hand die Trattoria „Al Municipio“, die über einen netten Garten verfügt. In diesen gelangt man nur, wenn man sich an der Küche vorbeischlängelt, was aber von Vorteil ist, weil man gleich sieht und riecht, was es zu essen gibt. Der Chef empfahl ihnen Steinpilze. Sie seien heute morgen frisch gekommen, die ersten des Jahres. Wie wäre es mit „Insalata di funghi con rucola e formaggio“? Sie willigten sofort ein.
Während sie im Schatten saßen, etikettenlosen Pinot Grigio und viel Wasser tranken, alberten sie noch herum. Weshalb werden rohe Pilze immer mit frisch gemahlenem Pfeffer serviert? Antwort: Damit man die Wurmlöcher nicht mehr sieht! Das mag mancherorts der Fall sein, hier aber war es das nicht. Feinblättrig geschnittene, reinweiße Porcini bildeten einen ansehnlichen Berg, der von reifem, hauchdünn gehobeltem Montasio gekrönt war. Ein paar Tropfen Zitrone darüber geträufelt, mit kaltgepreßtem Olivenöl kondiert, dazu frisches Hausbrot: es war ein Festessen. Die Steinpilze schmecken hier anders als in den Nordalpen. Das liegt naturgemäß am klimatischen Unterschied, aber auch daran, daß der Humus, den Nadeln, Laub und die Früchte im Gehölz bilden, deren Duft und Geschmack an die Schwämme vermittelt. Nicht nur Steinpilze, auch Hallimasch, Stockschwämmchen oder Täublinge entfalten intensive Aromen. Oder sollte es wieder nur am Lebensgefühl liegen? Oder ist das nur Einbildung? Vielleicht schmecken auch tiefgekühlte Scampi am Meer besser als frische am Arlberg.
Nachdem die beiden Reisenden auch noch hausgemachte Tagliatelle mit Steinpilzen und Rosmarin verkostet hatten, war trotz der Hitze ein Verdauungsspaziergang nötig. Sie schlenderten durch die Gassen zum Dom, in Erwartung, daß dieser wie alle Kirchen in Italien nachmittags geschlossen ist. Zu ihrer Überraschung war aber das Portal offen. Sie traten ein in den kühlen, menschenleeren Raum und verharrten, um ihn auf sich wirken zu lassen. In diesem Augenblick hub oben auf der Empore ein Frauenchor an, Madrigale zu singen. Die klaren Stimmen erfüllten den Dom, schienen hin und her zu schweben, echoten entlang der Wände und verklangen irgendwo in der Apsis. Die beiden Männer setzten sich auf eine Bank und lauschten. Es wurde ihnen klar, was damals, zur Zeit der Errichtung dieses Baus, der Begriff „Gottesdienst“ bedeutet haben konnte.
Als die Chorprobe unterbrochen wurde, verließen die beiden Freunde die Kirche. Wie um sie zu verabschieden, erklangen in diesem Augenblick die mächtigen Glocken des Campanile. Wieder verharrten sie, bis diese verklungen waren. Dann machten sie sich auf in die Kapelle des heiligen Michael, wo die berühmten Mumien von Venzone ausgestellt sind, zumindest ein Teil davon. Es sollen über dreißig erhalten sein. Gut ein halbes Dutzend von ihnen kann besichtigt werden. Schwarze, unheimliche knochige Leiber scheinen einen aus den tiefen Augenhöhlen anzustarren. Sie erinnern an Ötzi, auch wenn sie nicht ganz so alt sind wie dieser. Es sind vermutlich fromme Kirchenmänner, die im Mittelalter in der Krypta des Doms beigesetzt worden sind und dank der speziellen klimatischen Bedingungen sich als perfekte Mumien erhalten haben. Sie sind ein Memento mori, vor dem einer, der gerade zuviel gegessen und getrunken hat – und womöglich, wie der Poet, auch noch raucht –, nicht allzu lange verweilt, sondern sich wieder ins Sonnenlicht begibt.
Langsam lösten sich lebendige Menschen aus den Schatten der Gemäuer und strömten der Piazza zu. Jolanda und Mariella waren fertig mit der Dekoration ihres Keramikladens und wegen der Vernissage sehr nervös. Sie überredeten den Schauspieler und den Poeten, unter Künstlern mit ihnen noch einen Prosecco auf den Erfolg zu trinken. Das Caffè Vecchio war mittlerweile brechend voll und laut. Vor allem am Schalter für Glücksspiele herrschte großes Gedränge. Ein Doppel-Jackpot im Fußball-Toto war auszuspielen. Die beiden Freunde erwarben je einen Schein, füllten ihn nach bestem Wissen mit ihren Tips und übergaben ihn den jungen Frauen zu treuen Handen. Ob sie etwas gewonnen haben, das haben sie bis heute nicht erfahren.
Als sie zum Auto kamen, stand dieses bereits im Schatten, genauer gesagt in dem des Monte Simeone. Dabei war es noch nicht spät. Nur wenige Kilometer weiter Richtung Süden flimmerte die Hitze über der Pianura, dem Flachland, wo nur Bäume, Kirchtürme und die weit ausladenden Dächer der Bauerngehöfte kärglichen Schatten spenden. Noch ein paar Meilen weiter, am Meer, gibt es nur noch den Schatten, den man selber wirft, in dem man sich erfahrungsgemäß nicht unterstellen kann.
Sie waren also doch noch mit einem Fuß im Norden – aber mit einem schon im Süden. Vielleicht ist es so, daß hier eine Welt an die andere stößt, so unvermittelt, daß alle paar hundert Jahre die Erde von dieser Gegensätzlichkeit erbebt und die Menschen, ihre Mauern und ihre Geschichte kurzerhand verschlingt.