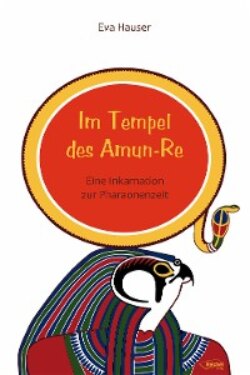Читать книгу Im Tempel des Amun-Re - Eva Hauser - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bel-shalti-Nannar
ОглавлениеBel-shalti-Nannar war nicht da – und doch war sie in ihrem Palast allgegenwärtig. Ihren Untergebenen war es so, als könne sie jeden Augenblick wieder hier sein.
Aber sie war wirklich nicht da, sie war hoch hinauf auf die Zikkurat gestiegen, und da würde sie wohl eine Weile bleiben, bis sie mit neuen Erkenntnissen wieder herabkam. Und bis sie herabkam, das konnte dauern, denn so schnell wie früher bewältigte sie die vielen Treppen nicht mehr, obwohl sie den Weg für ihr weit fortgeschrittenes Alter in einer großen Geschwindigkeit zurücklegte. So schnell, dass die weitaus jüngeren Priesterinnen, die sie bis zu einer der oberen Ebenen – nicht der obersten – begleiteten, außer Atem gerieten und hasten mussten, um mit ihr Schritt zu halten, die in Gelassenheit von Stufe zu Stufe stieg.
Bel-shalti-Nannar war nicht da, so konnte Moiria in Ruhe ihre Gedanken fließen lassen, wo immer sie hin wollten. Wenn Moiria ihnen freien Lauf ließ, dann verging die Zeit so schnell, als gäbe es sie nicht, und was ihr wie ein Augenblick erschien, musste wohl eine lange Zeit gewesen sein, denn Bel-shalti-Nannar, die sie eben noch weit weg wähnte, stand dann plötzlich vor ihr, um sie zu ermahnen.
»Mein Kind«, sagte sie dann, so begann sie immer, wenn sie mit Moiria sprach, »du lässt deine Gedanken schweifen. Kontrolliere sie, setze sie zielgerichtet ein oder sei leer von ihnen und versinke in innerer Stille!«
Moiria kannte diese Worte zu Genüge, sie kannte sie auswendig, oft hatte sie sie vernommen. Gerade fünfzehnjährig war sie gerne noch ein Kind. Sie übte wohl das eine oder andere manchmal, aber es dauernd zu tun, das entsprach ihr nicht. Der Zwänge waren zu viele, wie sie fand. So war sie froh um jede Gelegenheit, bei der sie in ihren Gedanken die Enge des großen Palastes verlassen konnte. Dabei fingen ihre Gedanken an, selbständig zu werden. Ein Gedanke holte den anderen heran. Sie waren wie unsichtbare Fäden, die miteinander verknüpft waren und an denen immer neue hingen. So hatte das Spiel kein Ende, es konnte immer weiter gehen, Moirias Gedankenspiel.
Jedes Mal, ehe sie damit begann, nahm sie sich vor, aufzuhören, bevor Bel-shalti-Nannar dazukam und sie überraschte, doch nie gelang es ihr; immer wurde sie inmitten ihrer Träume gestört. So würde es wohl auch diesmal wieder geschehen, so sehr sie sich auch bemühte, mitten aus ihren schönsten Gedanken würde sie geholt werden, und Bel-shalti-Nannar würde sie ermahnen. Doch das wollte Moiria hinnehmen. Bel-shalti-Nannar kam sowieso viel zu früh zurück. Vielleicht noch früher. Sie war immer für etwas Unerwartetes gut.
Bel-shalti-Nannar stand auf der obersten Plattform der Zikkurat. Trotz ihres hohen Alters hielt sie sich tadellos aufrecht, und der mehrstöckige, ausladende Kopfputz, den sie trug, saß kerzengerade. Ihre Robe in leuchtend hellem Blau betonte ihre Augen, wohl das Auffallendste an ihr, besonders. Sie blitzten wie Saphire. Es war nicht eine ihrer hochoffiziellen Roben, die von oben bis unten mit Edelsteinen versehen waren, und die sie in allen Farben besaß, sondern eines ihrer Alltagsamtsgewänder, die in Ausstattung und Schnitt wohl den großen Roben nachempfunden waren, aber nicht deren hohes Gewicht hatten und deshalb zu einem Gang auf die Zikkurat besonders geeignet waren.
Ihre zartrosa getönte Haut, die sich bisweilen zu einem temperamentvollen Dunkelrot färben konnte, war noch immer glatt, weich und feinporig. Auch war sie mit guter Körperfülle gesegnet, ganz im Gegensatz zu einigen der älteren Priesterinnen, deren Gesichter und Körper durch all die jahrelange Entsagung mager und ausgezehrt waren.
Bel-shalti-Nannar sah auf ihren Palast hinüber, dabei verzog sie ihren Mund schräg nach unten. Manchmal widerte ihr großer Hof sie an, mit all den Menschen. Immer mehr Weihrauch ließ sie verbrennen, um die Luft zu reinigen von all der Habgier und Hinterlist, von all dem Zersetzenden, von all dem Niederen, das diese Schmarotzer verströmten. Tag um Tag kostete der Unterhalt ihres Hofes sie einen beachtlichen Betrag. Nicht so viel wie der Haushalt des persischen Satrapen in Babylon, der verschlang in einem Jahr weit mehr Talente Silber, aber immerhin, es war beachtlich.
Dabei konnte sie es sich mehr als leisten, denn die Tempel des Nannar und der Ningal, deren Geschicke sie lenkte, und die von den Persern nicht besteuert wurden, hatten höchst erfreuliche Einkünfte aus Handel und Landwirtschaft. Auch an einem Bankhaus war Bel-shalti-Nannar beteiligt. Ihr Schatzhaus füllte sich Jahr um Jahr. Aber trotzdem, für all die Schmarotzer da drüben im Palast, die Wein in sich hinein leerten, Braten und ausgewählte Speisen in sich hineinschlangen, reute sie jede Ausgabe. Und nicht nur die Schmarotzer wollten genährt und bedient werden, auch deren Pferde, Wagenlenker, Dienerschaft und Eskorten waren zu versorgen.
Bel-shalti-Nannar wollte das ändern und mit dem höchsten Beamten der Palastverwaltung darüber sprechen. Er sollte einmal eine Aufstellung machen, wie viele Kosten sie einsparen könnte, wenn nur der Besucher selbst freies Gastrecht genoss. Für sein Pferd, oder, falls er mit einem Wagen kam, für seinen Wagenlenker und die Pferde, hätte er Stallmiete und Kostgeld in den raren persischen Goldmünzen zu entrichten, als Spende für den Tempel. Dasselbe galt natürlich für sonstige Begleitung.
Ihre Idee gefiel ihr prächtig. Warum hatte sie nicht schon früher daran gedacht? Gegen eine Spende für den Tempel konnte keiner etwas einwenden. Sie hätte dadurch weitere Einnahmen, und niemand könnte ihr mangelnde Gastfreundschaft vorwerfen.
Falls nun die ausländischen Gesandten und anderen Gäste nicht mehr in so zahlreicher Begleitung erschienen, weil die Kosten sie reuten, dann hätte auch dies Vorteile. Einen Teil des Personals könnte sie vom Palast abziehen und anderweitig einsetzen. Wachen und Stallknechte konnten draußen auf den Feldern und bei den Herden arbeiten, Frauen aus der Palastküche im heiligen Bezirk die Weberinnen unterstützen und den Handwerkern helfen, noch mehr Kunstgegenstände für den Verkauf herzustellen. Ein zusätzlicher Gewinn! Gleich morgen wollte sie veranlassen, dass ihr neuer Plan in die Tat umgesetzt würde.
Moirias helle Haut, von der Jesed böserweise behauptet hatte, sie sei so weiß wie ein Fischbauch, stand in Kontrast zu ihrem dunklen Haar und ihren Augen, die die Farbe ändern konnten wie das Meer. Was bestimmte Dinge anging, so wollte sie nicht erwachsen werden. Die Verantwortung und die Pflichten des Amtes, das sie, als Nachfolgerin Bel-shalti-Nannars, einmal innehaben würde, schreckten sie. Schon lange taten sie das.
Meist schob sie solche Sorgen einfach weg. Doch heute gelang es ihr nicht. Die Bedrängnis kam mit Nachdruck. Es war ein Zwiespalt, in dem sie sich befand und der sich nun nicht mehr leugnen ließ, das musste sie sich vor sich selbst eingestehen. Einerseits hoffte sie, dass Bel-shalti-Nannar noch ewig lebte, damit sie noch lange nicht deren Platz einnehmen müsse, denn riesenhaft und ängstigend schien ihr das Gebilde zu sein, das Bel-shalti-Nannar inmitten des persischen Reiches geschaffen hatte. Andererseits war sie Bel-shalti-Nannars Reden, wohlmeinender Belehrungen, Übungsstunden und Ratschlägen mehr als überdrüssig. Sie waren zu viel und zu eindringlich. Wenn Moiria sie mit einem bloßen Achselzucken hätte abtun können, wäre es ein Leichtes gewesen. Aber das ging nicht. Nicht bei Bel-shalti-Nannar. Es lag an ihrer Allgegenwart und, wie es Moiria schien, auch an ihrem Blick, dem nichts verborgen blieb. Ganz gleich ob sie die Augen offen oder geschlossen hielt, sie konnte in Moiria hineinsehen, ob Moiria das wollte oder nicht.
Bel-shalti-Nannar hatte es nach Moirias Meinung leicht, weil sie keine Rolle zu spielen brauchte. Sie war sie selbst. Die Übereinstimmung von Bel-shalti-Nannar als solcher und Bel-shalti-Nannar als Hohepriesterin war vollkommen. Warum das jedoch so war, das entzog sich Moirias Kenntnis. Ob sich Bel-shalti-Nannar das Amt der Hohepriesterin für sich passend gemacht hatte, oder ob sie schon immer so gewesen war, das konnte Moiria nicht auseinanderhalten.
Wie, so fragte sie sich oft, sollte es ihr, die doch so anders war, jemals gelingen, so zu sein wie Bel-shalti-Nannar? Würde die Zeit das von alleine tun? Und wäre Zeit genug, um eine Hohepriesterin zu werden? Nahezu unerreichbar schien es ihr.
Oder sollte sie vielleicht doch allmählich anfangen, wenigstens einen Teil von Bel-shalti-Nannars Weisungen, die ihr so wenig sinnvoll erschienen, zu befolgen? Bel-shalti-Nannars Forderungen, die kannte Moiria nicht erst seit heute, sie waren ihr bekannt, seit sie im Palast in Ur lebte. Bel-shalti-Nannar wollte, dass Moiria so werde wie sie.
Am Anfang hatte Bel-shalti-Nannar wohl angenommen, es sei nur eine Frage der Zeit, und das Beispiel, dass sie vorlebte, würde das Seine schon dazutun. Deshalb hatte sie Moiria oft sich selbst überlassen und nur ab und zu, zwischen ihren vielen Beschäftigungen, sich ihr zugewandt. Moiria war es lieb so gewesen und sie hatte dabei nichts vermisst. Sie hatte sich wohl gefühlt bei Bel-shalti-Nannar, geborgen und Zuhause inmitten der vielen Menschen, den Priesterinnen, den Besuchern und den Gästen. In Wohlleben und süßem Nichtstun hatten sich die Tage aneinander gereiht. Es hätte immer so weitergehen können, wie ein glückliches Fest.
Doch das tat es seit einiger Zeit nicht mehr. Bel-shalti-Nannar ließ Moiria nicht mehr in Ruhe, weil sie ihr Abbild werden sehen wollte. Und da es nicht von alleine wurde, versuchte sie, es zu formen. Je mehr Bel-shalti-Nannar von Moiria verlangte, umso mehr widersetzte sie sich ihr. Und umso mehr Moiria das tat, umso eindringlicher wurde Bel-shalti-Nannar in ihren Bemühungen...
Bel-shalti-Nannars Blicke auf der Zikkurat waren wiederum hinüber zum Palast gewandert. Sie war höchst unzufrieden mit Moirias Entwicklung. Eine Ausbildung, die ihresgleichen suchte, ließ sie ihr angedeihen. Aber das Kind begeisterte sich nicht dafür. Bel-shalti-Nannar hatte schon vieles versucht, um zu erreichen, dass Moiria endlich annahm, was sie ihr zu vermitteln suchte.
Sie hatte Druck ausgeübt, aber einsehen müssen, dass das nur das Gegenteil des Gewünschten bewirkte. Moiria verschloss sich vor ihr. Dann war sie es anders angegangen und hatte Moiria eine Weile gar nicht beachtet. Aber Moiria war das nur recht gewesen.
Schließlich hatte Bel-shalti-Nannar wieder lange Gespräche mit Moiria geführt, um sie zu überzeugen, jedoch auch das hatte nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. Moiria lebte weiter in den Tag hinein, ließ die Zeit dahingehen und die Übungsstunden über sich hinweg. Sie spazierte, schön anzusehen, zwischen ihren eigenen Gemächern und dem großen Empfangssaal hin und her und tat ansonsten einfach nichts.
Bel-shalti-Nannar war das unbegreiflich. Jedes andere Mädchen, allen voran Philomena, hätte alles darum gegeben, um an Moirias Stelle sein zu dürfen. Die anderen Priesterinnen, die niemals die Gelegenheit haben würden, zum Rang der Entu, der Hohepriesterin, aufzusteigen, zerrissen sich fast, um zu zeigen, wie ernst sie ihre Ausbildung nahmen. Alle hätten es als Krönung ihres Lebens erachtet, von ihr, Bel-shalti-Nannar, lernen zu dürfen und eines Tages zu übernehmen und fortzuführen, was sie sich erarbeitet hatte, nur Moiria nicht.
Wahrscheinlich tat sie auch jetzt nichts. Bel-shalti-Nannar senkte die Lider und konzentrierte sich auf Moiria. Sie wollte wissen, was das Kind gerade tat. Nach einigen Atemzügen in tiefer Entspannung erschien Moirias Bild vor ihrem inneren Auge. Es war so wie Bel-shalti-Nannar vermutete hatte. Nicht einmal die einzige Übung, die sie Moiria für den heutigen Nachmittag vorgeschlagen hatte, führte das Kind aus.
Moiria saß zwischen einigen Kissen und hatte die Augen ins Weite gerichtet. Bel-shalti-Nannar schnaubte. Gerade das, was sie verhindern wollte, tat Moiria nun wiederum. Schon war sie an der Treppe, um hinunterzusteigen, zum Palast hinüberzueilen und Moiria zum soundsovielten Male auf die Folgen unachtsamer Gedanken aufmerksam zu machen, die sich ebenso verwirklichten wie alle anderen auch, da besann sie sich eines Besseren und hielt inne.
Was würde es nützen, Moiria einen weiteren Vortrag zu halten? Nichts würde es nützen, gar nichts! Stille war auf der Zikkurat und Klarheit. Trauer war in Bel-shalti-Nannar. Sie würde nicht zu Moiria gehen, sie würde bleiben, ganz genau so, wie sie es sich für heute vorgenommen hatte. Sollte Moiria nun endlich lernen, die Folgen für sich selbst zu verantworten. Schmerzlich wandte Bel-shalti-Nannar ihre Aufmerksamkeit wieder sich selbst zu.
Moiria, zwischen Kissen hin gelagert, war in das Spiel ihrer Gedanken vertieft. So anders als Bel-shalti-Nannar empfand sie sich, so ganz anders und seit einiger Zeit so unverstanden von ihr. Eigentlich war überhaupt niemand mehr da, der Verständnis für sie hatte.
Josua, ihr Freund aus der Kinderzeit, kam nur noch selten in den Palast. Bel-shalti-Nannar hatte ihn von ihr entfernt. Josua hatte sie verstanden. Alles hatte sie ihm sagen können, alles. Jedes Mal wenn sie das, was sie auf dem Herzen hatte, bei ihm ausgesprochen hatte, war es nur noch halb so schwer, und wenn sie dann gemeinsam noch darüber lachen konnten, dann war es ganz verschwunden gewesen. Josua hatte niemals etwas beurteilt oder verurteilt, bei ihm war jedes Wort gut aufgehoben, sogar Geheimnisse. Stundenlang waren sie nebeneinander an ihrem Lieblingsplatz auf dem Dach gesessen, hatten kleine Pfeifen geschnitzt und Früchte gegessen. Gemeinsam hatten sie den Palast durchstreift, die Wachen geneckt und die Besucher geärgert. Sie hatten die Magazine durchstöbert, sich Naschwerk aus dem Küchenhaus geholt, und endlose Tage der Kindheit miteinander geteilt.
Bel-shalti-Nannar hatte der Kinderfreundschaft einige Jahre zugesehen und dann, als Moiria heranwuchs, Josua kurzerhand und ohne Vorankündigung eine Aufgabe als Hirte draußen vor der Stadt zugewiesen. Damit war Moirias Kinderzeit von einem Tag auf den anderen zu Ende gewesen. Von nun an waren nur noch die Erwachsenen um sie, von denen sie seit je wie eine Erwachsene behandelt worden war.
Seit Josua nicht mehr da war, gab es niemanden mehr, von dem sie sich wirklich verstanden fühlte. Bei Bel-shalti-Nannar fand sie kein offenes Ohr. Du bist nicht irgendein Kind, hatte sie ihr gesagt, du hast eine Aufgabe zu erfüllen, auf die du vorbereitet sein musst. Und eben dies, wofür du Verständnis möchtest, behindert deine weitere Entwicklung.
Dies wiederum verstand Moiria nun nicht. Bel-shalti-Nannar besaß immer die sichere Überzeugung genau zu wissen, was gut und richtig, was überflüssig war und was noch dazu gehörte. Um diese Sicherheit beneidete Moiria Bel-shalti-Nannar. Bel-shalti-Nannar, die immer alles wusste, die immer etwas tat, sich scheinbar niemals auszuruhen brauchte, die herrschte wie eine Königin und die Menschen gebrauchte und hin und herschob, wie Figuren auf einem Brettspiel, in ihrem Spiel der Macht.
Machtspiel, Moiria stutzte einen Augenblick über das, was sie soeben gedacht hatte. Wie an einer Perlenkette waren Bel-shalti-Nannars Eigenschaften an ihr vorbeigeglitten, die gütigen, die vehementen, die liebenden, die energiegeladenen, die bewahrenden, die temperamentvollen, und sie hatten alle zueinander gepasst. Doch die eine Perle, die war deutlich größer als alle anderen, an der blieb alles hängen. Dabei hatte Moiria innegehalten.
Bel-shalti-Nannar war mächtig. Das gehörte zu ihr, das kannte Moiria nicht anders. Aber sie hatte es bisher nur wahrgenommen, ohne darüber nachzudenken. Jetzt begriff sie es und es erschreckte sie in seiner Deutlichkeit. Moiria dachte an all die Menschen, die in den vergangenen Jahren ein- und ausgegangen waren, Gesandte aus vielen Ländern, hohe Beamte der Perser, Kaufleute und Abenteurer. Und sie begann die Bedeutung dieser Kontakte zu ermessen. Bel-shalti-Nannars großer Empfangshof war immer reich besucht. Es wimmelte förmlich, vor bunter Vielfältigkeit der Farben und Charaktere.
Bisher hatte Moiria es nur genossen zu schauen, stundenlang. Von erhöhtem Platze aus hatte sie über die Menge gesehen. Auch das war eine ihrer sehr lieben Beschäftigungen; sie war dabei und doch in sicherer Distanz. Sie hatte sich gefreut über die vielen Besucher, ihre Geschenke entgegengenommen und sie war stolz darauf, dass ihre Mutter eine so bedeutende und hochgeehrte Frau war. Mehr hatte sie dabei nicht gedacht.
Dass Bel-shalti-Nannars Thron meist leer geblieben war, während sich die Gäste davor tummelten, fiel Moiria erst heute auf.
Der Thron blieb deshalb leer, weil Bel-shalti-Nannar es vorzog, sich zu Einzelbesprechungen in ihren kleineren, privaten Empfangsraum zurückzuziehen. Hier wurde das Eigentliche ausgehandelt, Aufträge erteilt und über deren Ergebnisse Rechenschaft abgelegt.
Nicht nur hohe Politiker und Gesandte anderer Länder empfing Bel-shalti-Nannar, sondern auch Personen, die durch ihr verwegenes Äußeres Aufmerksamkeit erregten. Und manche Augen, in die Moiria oft im Vorbeigehen gesehen hatte, waren wie abgrundtiefe Löcher, aus denen kein Lichtfunke schimmerte und in denen kein Widerhall war. Augen, die Werkzeugen gehörten, die für Silber wohl vieles taten, wenn nicht gar alles, so sagte sie sich jetzt.
Moiria war nicht wohl zumute, als sie daran dachte, dass auch diese Belange eines Tages die ihren sein würden, und sie wusste nicht, wie sie das Ausmaß der Folgen überschauen und beherrschen sollte. Die Besucher kamen nicht, um Nannar und Ningal zu ehren oder ihnen zu opfern, sie kamen, weil sie in die Fäden Bel-shalti-Nannars verstrickt waren. Das Spiel der Macht zog sie an. Und Bel-shalti-Nannar spielte es mit jedem Jahr meisterhafter, und die Umsetzung ihres Willens gelang ihr schneller und durchschlagender. Immer stärker liebte sie das Ausleben ihrer Macht.
Nebukadnezar stand in seinem Wagen und fuhr auf Ur zu. Er hatte sein Herz verschlossen. Immer seltener öffnete er es. Und wenn er es öffnete, dann tat er es nur, um auf Unterstützung von außen zu hoffen. Doch das Offensein für die Hoffnung schmerzte ihn, weil er damit auch offen war für Verletzung und Enttäuschung. Wie viele Jahre hatte er schon vergebens gewartet, auf ein Ereignis, das ihm helfen würde, endlich sein rechtmäßiges Erbe anzutreten! Und so verschloss er sich immer mehr und verhärtete sein Herz.
Bel-shalti-Nannar hatte ihn nie in der Weise unterstützt, wie er es von ihr erwartet hatte, obwohl sie seine Tante war. Nebukadnezars Vater, Bel-shalti-Nannar und Belshazzar waren Geschwister gewesen, Kinder aus der Verbindung von Nitocris, der Tochter Nebukadnezars dem II., und Nabonid, der bis zur Machtübernahme der Perser König von Babylon war.
Belshazzar, der älteste Sohn und seine Nachkommen waren während Kyros' Einmarsch ums Leben gekommen. Nebukadnezars Vater hingegen hatte sich zu dieser Zeit nicht in Babylon aufgehalten. Durch ihn, als einzig überlebenden königlichen Sohn Nabonids, war die Linie der Familie fortgeführt worden, deren männliches Oberhaupt nun Nebukadnezar war.
Schon als er noch ein Kind war, hatte das Sinnen danach, den Persern die Herrschaft zu entreißen und den babylonischen Thron einzunehmen den wichtigsten Platz in seinem Leben eingenommen. Doch die Jahre waren vergangen, ohne dass es die wirkliche Gelegenheit für einen großangelegten, durchschlagenden Erfolg gegeben hätte. Wohl hätte er längst einen lokalen Aufstand durchführen und sich zum König ausrufen lassen können; das hatten vor ihm schon viele versucht, jedoch nach kurzem Erfolg waren sie niedergeschlagen worden.
Um so etwas zu unternehmen, dazu besaß Nebukadnezar zu großen Weitblick. Der Angriff gegen die Perser musste anders begonnen werden, von mehreren Fronten aus und mit Hilfe Verbündeter. Könnte es gelingen, dann wäre die Thronfolge an ihm, und ein Sohn der Chaldäer würde wieder in Babylon herrschen.
Doch die Wirklichkeit sah im Augenblick anders aus. Er musste sich in Uruk mit Besitztümern begnügen, die, gemessen an ganz Babylonien, bescheiden waren. Darüber hinaus war ihm ein persischer Beamter zur Seite gestellt, der seine Erträge aus Land-, Viehwirtschaft und Handel überwachte. Dieser Beamte war zugleich lokaler Schatzmeister. In regelmäßigen Abständen zog er hohe Abgaben von ihm ein.
Wie das ganze Volk litt Nebukadnezar unter den Steuern, denn Xerxes bereitete weitere Kriegszüge gegen die Griechen vor, die Unsummen kosteten. Doch nicht nur das. Nebukadnezars Aufseher waren für Xerxes' Armee rekrutiert worden. Deshalb mussten Nebukadnezars Wagenlenker und die Männer, die ihn sonst begleiteten, vorübergehend auf seinen Feldern und Dattelhainen aushelfen. Jede Hand wurde gebraucht, bis Nebukadnezar neue Arbeitskräfte beschaffen konnte, die bei der Ernte halfen. Das war die Lage, mit der er zu leben hatte und die ihm so ganz und gar nicht gefiel.
Der Thron, auf dem Bel-shalti-Nannar saß, war der einzige Machtfaktor, den die Familie damals, bei der persischen Machtübernahme behalten hatte. Kyros hatte dem Volk seinen Glauben und seine Götter gelassen, wohl wissend, dass er leichter regieren könne, wenn die Menschen ihm gewogen wären. Babylon behielt seinen Stadtgott Marduk und Ur den Mondgott Nannar mit seiner irdischen Gemahlin und Stellvertreterin Bel-shalti-Nannar.
Seitdem hatte es Bel-shalti-Nannar verstanden, die reichen Schenkungen, die Nabonid dem Nannar- und Ningal-Heiligtum übereignete, als er das alte Amt für seine Tochter neu einrichtete, um ein Vielfaches zu mehren. Auch ihre einflussreichen Beziehungen immer weiter auszubauen gelang ihr, und das in einer Weise, die nach außen hin alles im Namen des Mondkultes und zum Wohle der Stadt Ur erscheinen ließ.
Bel-shalti-Nannar war die Herrscherin eines gewaltigen Gefüges geworden. Die Steuerfreiheit und die Unantastbarkeit des heiligen Bezirkes sicherten ihr riesige Handelsgewinne. Durch den Schutz der persischen Machthaber, den sie in all den Jahren genossen hatte, war sie nahezu unangreifbar. Feinde, derer sie sich viele gemacht hatte, konnten wegen ihrer besonderen Stellung als Hohepriesterin nicht direkt gegen sie vorgehen, meistens waren ihnen diesbezüglich sogar völlig die Hände gebunden. Die Angriffe ihrer Gegner mussten deshalb auf Umwegen stattfinden, und wenn sie nicht überhaupt im Sande verliefen, erreichten sie Bel-shalti-Nannar nur in abgeschwächter Form, so dass es ihr ein Leichtes war, sie abzuwehren.
Wer es mit ihr aufnehmen wollte, der musste ihr deshalb mehr als gewachsen sein. Manch einer, der dachte, er könne dies, wurde nach kurzer Zeit einer ihrer Handlanger, den sie benutzte und wieder wegwarf, um ihn erneut zu gebrauchen, wenn er ihr wieder nützlich sein konnte. Wer nicht mehr wollte, der musste weitermachen, denn eines wollte er doch: die Macht, die er schon besaß, auch wenn sie noch so gering war, nicht mehr hergeben.
Auch der Familie gegenüber hatte sie immer spüren lassen, dass sie das Sagen hatte und alle von ihr abhängig waren. Bel-shalti-Nannars Ableben würde ein Hindernis weniger für Nebukadnezar bedeuten. Auf ihren Tod wartete er seit dem Tage, an dem sie, die ehe- und kinderlos bleiben musste, seine Tochter Moiria als ihre Nachfolgerin adoptiert hatte. Von dem Augenblick an, an dem Moiria die Hohepriesterin sein würde, konnte er Einfluss nehmen, und, mit Hilfe der Möglichkeiten, die er durch sie zur Verfügung hatte, Vorbereitungen treffen, um im geeigneten Moment loszuschlagen.
Bel-shalti-Nannar wollte heute noch lange auf der Zikkurat weilen, bis spät in die Nacht, oben, wo sie entrückt war und das Tagesgeschäft des Palastes weit weg. Die Punkte ihres Tagesplanes hatte sie am Morgen in atemberaubender Organisation erledigt und unter anderem vier Verhandlungen geführt.
In einer davon war versucht worden, ihr eine Falle zu stellen, sie sollte sich versprechen. Aber Bel-shalti-Nannars Sinne waren scharf, sie versprach sich nicht. Ihr Gegenüber hatte gerätselt. War sein Verdacht, den er als absolut stichhaltig angesehen hatte, wirklich völlig unbegründet, oder hatte Bel-shalti-Nannar sich nur sehr gut unter Kontrolle? Er war verwirrt. Sie nutzte die Situation und stellte nun ebenfalls eine Fangfrage, auf die er auch prompt hereinfiel. Er biss sich vor Wut auf die Zunge und Bel-shalti-Nannar war es zufrieden. Sie verabschiedete ihn mit honigsüßem Lächeln.
Außer den vier Verhandlungen hatte sie Weisungen für Verschönerungsmaßnahmen im Palast gegeben und einen Verwaltungsbeamten entlassen. Darüber hinaus hatte sie neue Losungsworte festgelegt. Gewisse Personen nämlich, die den Palast besuchten, sollten im großen Empfangshof nicht gesehen werden. Damit sie unbemerkt in den Palast gelangen konnten, gab es das Tor in der hinteren Umfassungsmauer und den Seiteneingang. Der Personenkreis, der diesen Weg benutzte, nannte den Wachen keine Namen, sondern gebrauchte Kennworte. Von Zeit zu Zeit änderte Bel-shalti-Nannar die Losung, damit ausschließlich diejenigen Zutritt hatten, die für sie von augenblicklichem Interesse waren. Wer nur ein Losungswort kannte, das Bel-shalti-Nannar bereits abgeschafft hatte, wurde auf diesem Wege nicht mehr hereingelassen, so sehr er auch von der Richtigkeit seiner Parole überzeugt war.
Seit Moiria als kleines Mädchen zu Bel-shalti-Nannar gekommen war, hatte sie ihre leibliche Mutter nicht mehr gesehen. Bereits vor Moirias Geburt war bestimmt worden, dass die erstgeborene Tochter Nebukadnezars von Bel-shalti-Nannar adoptiert werden würde. Moirias Mutter war überzeugt gewesen, dass sie sich und ihrer Tochter viel Leid ersparen könne, wenn sie, im Hinblick auf die bevorstehende Trennung, die Bindung zwischen sich und ihrem Kind nicht zu eng werden lassen würde.
Als sie Moiria, ihr erstes Kind, unter ihrem Herzen trug, litt sie unsagbar und wünschte, dass es ein Sohn sei. Der Schmerz darüber, dass sie das Kind, welches in ihrem Leibe wuchs, würde hergeben müssen, wenn es ein Mädchen war, und früher oder später ganz an Bel-shalti-Nannar verlieren würde, schnürte ihr manches Mal fast die Luft ab. Doch sie musste ihren Kummer für sich behalten. Sie durfte ihn nicht zeigen, am allerwenigsten Nebukadnezar und der Familie, die stolz darauf waren.
Nachdem Moiria geboren worden war, tat Bel-shalti-Nannar, wie Moirias Mutter es vorausgesehen hatte, alles, um möglichst früh eine Bindung zu Moiria aufzubauen. Moiria wurde in regelmäßigen Abständen von Uruk nach Ur zu Besuch gebracht. Es waren dann Süßigkeiten für sie aufgestellt und Bel-shalti-Nannar spielte mit ihr. Moiria durfte sich alle Spiele wünschen. Bel-shalti-Nannar beschäftigte sich mit ihr in einer Weise, wie Moiria es bei keinem anderen erlebte. Sie erhielt von Bel-shalti-Nannar all das, nach dem sie sich sehnte und was ihre leibliche Mutter ihr nicht zu geben wagte, um ihr den Schmerz der Trennung zu ersparen.
Moiria gefiel es in Ur, wo sie so besonders behandelt wurde. Aber sie liebte auch ihr Zuhause, obwohl ihre Mutter sich inzwischen viel mehr ihrer zweitgeborenen Tochter Ina zuwandte, einem Kind, das nun wirklich ihr eigenes war, und das keiner ihr nehmen konnte. Einmal, Moiria kam soeben von einem Besuch in Ur zurück, sah sie, wie ihre Mutter gerade Ina besonders liebevoll in ihren Armen wiegte und mit weicher Stimme ein Lied dazu sang. Moiria sagte: »Aber, du bist doch auch meine Mutter, nicht nur Inas.«
Mutter sah Moiria aus ernsten Augen an und sagte: »Bel-shalti-Nannar ist bald deine Mutter.«
Moiria sah hinab auf ihre Hand, in der sie einen entzückenden kleinen Spiegel hielt, den Bel-shalti-Nannar ihr heute geschenkt hatte. Sie nahm ihn auf und sah hinein. Darin erblickte sie ihre Augen. Groß und traurig waren sie. Ganz fest sah sie hinein, bis diese sich mit Tränen füllten. Dann konnte sie den Anblick nicht mehr ertragen. Sie ließ den Spiegel schnell sinken und rannte davon.
In Ur würde ihr Leben beginnen, erst dort, nicht hier. Als Moiria dann bald darauf nach Ur übersiedelte und bei Bel-shalti-Nannar lebte, kam Mutter nicht zu Besuch. Moiria fragte Nebukadnezar jedes Mal: »Wo ist Mutter, wann kommt sie mit?«
Er sagte dann immer: »Ein andermal vielleicht.«
Mutter kam nie mit. Irgendwann hörte Moiria auf zu fragen. Das Gesicht der Mutter, mit den ernsten Augen und der zarten, blassen Haut, das sie zunächst noch deutlich vor sich hatte sehen können, wurde mit der Zeit ein Schemen. Für Moiria war Bel-shalti-Nannar ihre Mutter, und sie liebte sie, trotz allem Unwillen und trotz aller Aufsässigkeit, die sie ihr so oft entgegenbrachte. Sie bewunderte die Stärke dieser bemerkenswerten Frau, die wie ein Kaleidoskop immer Neues, Schillerndes hervorbrachte.
Moiria träumte vor sich hin. Ihre Gedanken waren auf Reisen gegangen. Moiria selbst verließ den Palast meist nur, um den heiligen Bezirk aufzusuchen. Wenn sie dort mit Bel-shalti-Nannar auf die Zikkurat, den Hochtempel des Nannar stieg, blieb keine Zeit für Ausblicke und Betrachtungen. Denn ganz oben waren Bel-shalti-Nannars Belehrungen immer von besonders gedrängtem Inhalt. Moiria musste sich sehr anstrengen, um alles zu behalten. Und während sie das eben Gehörte noch in ihrem Kopf bewegte, waren sie bereits wieder herabgestiegen und hatten den Palast erreicht.
Vom Palast bis zum heiligen Bezirk führten Moirias Wege und manches Mal bis zu den Stadtmauern Urs. Weiter führten sie nicht, nur ihre Träume. Die Wege, die weiter führten, zur Mündung des Stromes, über die Meere, in ferne Länder, die gingen andere. Männer wie Jesed oder Tamkaru gingen diese Wege und Moiria bewunderte sie sehr. Sie kannten alle Länder der Welt, und Moiria wünschte sehnlichst, sie auch eines Tages besuchen zu können.
Jedes Mal, wenn Jesed überraschend den Palast betrat, dann war es für Moiria, als ginge zwischen all den Öllampen und Schwaden des Rauches der Duftharze ein Stern auf. Wenn er in den Empfangshof des Palastes hereinrauschte und seine weißen Gewänder dabei knisterten, war es Moiria, als bringe er einen belebenden Lichtstrahl zu ihr, in die Welt des Mondgottes, und sie könne teilhaben an dem Leben draußen, an der Sonne und an der Bewegung.
Jesed gehörte zu den Männern, die Bel-shalti-Nannar respektierte und denen gegenüber sie ein gewisses Wohlwollen hegte. Das Wohlwollen zu ihm hätte aber sofort in ein Fuß-auf-die-Brust umgeschlagen, falls auch er sich hätte abfertigen lassen, wie sie es zu tun pflegte, wenn ihr nicht Einhalt geboten wurde. Zu gern hätte sie ihn ganz einbezogen in ihr Spiel, doch es gelang ihr nicht so wie sie wollte. Manches Mal konnte sie ihn für kurze Zeit ködern, aber dann ging er wieder weit fort, hinaus aus ihren Kreisen.
Moiria wusste dann nicht, wo er war, was er tat, welcher Art von Geschäften er nachging und ob und wann er wieder zurückkehrte. Einmal war er drei Jahre lang weggeblieben, ehe er den Palast wieder besuchte. Als Moiria ihn fragte, wo er denn so lange gewesen sei, hatte er geschmeichelt gelacht und gesagt, Dareios habe ihn gebeten, in Afrika Bewässerungssysteme zu erkunden, die dem Quanat im persischen Hochland überlegen seien. Es klang sehr wichtig und das war es wohl auch, wenn der persische Großkönig Jesed darum bat. Moiria war sehr beeindruckt.
Seit Moiria zu Bel-shalti-Nannar gekommen war, hatte sie Ur nicht mehr verlassen. Bel-shalti-Nannar hatte sie verwöhnt, mit Geschenken überhäuft und ihr alles angedeihen lassen, was an Luxus und Wohlleben möglich war. Aber Moiria dachte nur an die Existenz all dessen, das außerhalb der Eingrenzung war, in der sie lebte: das Vorhandensein aller Freiheit, für die, in ihren Augen, Jesed der Inbegriff war. Die Freiheit, ohne Pflicht zu sein, jederzeit alles hinter sich zu lassen, zu kommen und zu gehen, wann und wohin auch immer. Den Atem dieser Freiheit brachte er zu ihr, mitten in Bel-shalti-Nannars Palast hinein.
Auch Tamkaru, der Kaufmann, kannte wie Jesed all die Länder, in die Moirias Träume führten.
Sie freute sich immer schon auf den Augenblick, in dem er den Palast wieder betreten und hoffentlich für viele Tage in Ur bleiben würde. Er wurde aus dem Reich Kush in Afrika zurückerwartet. Ein Land, in dem es Gold und edle Steine in der Erde gab. Ein Land, in dem wunderschöne Akazien wuchsen und das da, wo es vom Nil, vom Atbara und vom Blauen Nil eingeschlossen beinahe wie eine Insel war, ein Paradies sein sollte. Reich war das Land, viel reicher als Bel-shalti-Nannar, und so schön wie keines sonst, so hatte Tamkaru ihr erzählt. Die Menschen dort seien dunkel und ebenmäßig und liebten es zu musizieren, zu singen und zu lachen und zu tanzen.
Ein Land der Freude und der Schönheit, dachte Moiria, ein Land wie aus den Märchen, die Bel-shalti-Nannar ihr früher immer vor dem Einschlafen erzählt hatte. Schon malte Moiria sich aus, was Tamkaru ihr wohl diesmal aus diesem zauberhaften Land mitbringen würde, da fiel ihr auf, dass er bereits schon bei seiner unmittelbar vorhergehenden Reise in Kush, in der Stadt Meroë am Nil gewesen war.
Moiria war ratlos. Zweimal hintereinander nach Kush, dafür gab es keinen vernünftigen Grund. Und überhaupt, warum hatte sie das nicht schon früher bemerkt. Vielleicht, so schien es Moiria nun fast, hatte Bel-shalti-Nannar ein ganz klein wenig recht damit, wenn sie sagte, ihre Gedanken seien nachlässig, verworren und abschweifend. Aber sie nahm sich vor, es vor Bel-shalti-Nannar nicht zuzugeben.
›Nun gut‹, dachte sich Moiria, ›mir ist also entgangen, dass Tamkaru wieder nach Kush gereist ist. Aber warum ist es mir entgangen?‹ Sie begann fieberhaft zu überlegen. In den Tagen vor seiner Abreise hatte Tamkaru nicht mit ihr über sein nächstes Reiseziel gesprochen. Und sie hatte nicht danach gefragt, weil sie angenommen hatte, es sei Indien. Jedes Mal, wenn er aus Kush gekommen war, war er im Anschluss daran nach Indien gereist. Dahin, glaubte sie, sei er gefahren, sie war ganz fest davon überzeugt gewesen.
Wie war es aber nun gekommen, dass sie jetzt wusste, dass er woanders war? Sie konnte es noch nicht lange wissen, sonst hätte sie sicher schon darüber nachgedacht. So nachlässig konnte sie doch gar nicht sein. Wer hatte darüber gesprochen? Es musste jemand sein, der sehr gut informiert war. Vielleicht Bel-shalti-Nannar selbst?
Da erinnerte Moiria sich wieder. Bel-shalti-Nannar war mit jemandem in ihren privaten Empfangsraum gegangen und Moiria hatte im Vorbeigehen einen Fetzen des Gespräches aufgefangen. »Wie weit ist alles gediehen«, hatte der Mann gefragt. Und Bel-shalti-Nannar hatte erwidert: »Zu meiner Zufriedenheit. Du erhältst Weisungen, sobald Tamkaru aus Meroë zurück ist.« Moiria hatte nicht sofort etwas Besonderes an der Äußerung bemerkt. Weil sie in dem Augenblick, in dem es gesagt wurde, gerade an etwas anderes gedacht hatte. Sie überlegte nämlich, mit welcher Ausrede sie den bevorstehenden Harfenunterricht verschieben konnte, da sie noch nicht geübt hatte.
Tamkaru war also in Kush gewesen, und sie hatte keine Ahnung davon gehabt. Wenn sie nicht zufällig die Bemerkung gehört hätte, dann wäre ihr erst an Tamkarus Geschenk aufgefallen, dass er nicht in Indien gewesen sein konnte. Warum, fragte sich Moiria, hatte sie eigentlich keine Ahnung davon? Von diesem und von so vielem anderen, von dem sie immer erst erfuhr, wenn es schon geschehen war. Sie wollte ja sehr gerne Ahnung davon haben. Nur, wie sollte sie es anstellen, Dinge zu ahnen, von denen sie nicht wusste? Hinterher zu wissen, das war leicht, aber vorher, das wollte sie können.
Es war immer dasselbe, sie wusste nicht, während alle anderen zu wissen schienen. Alle wussten – und allen voran Bel-shalti-Nannar. Nur sie selbst, Moiria, wusste nichts. Warum wusste sie nicht? Das fragte sie sich jetzt. Es musste einen Grund dafür geben. Aber welchen? Sagte man es ihr nicht? Oder hatte man es ihr gesagt und sie hatte nicht hingehört? Oder fragte sie nicht? Vielleicht war es das.
Fragen hätte sie können. Aber was sollte sie denn fragen, wenn sie nicht wusste wonach? Sicherlich könnte sie zu Bel-shalti-Nannar gehen und sagen: »Ich habe das Gefühl, dass es so viele Dinge gibt, die ich nicht weiß.« Das Gespräch würde dann etwa folgenden Verlauf nehmen.
Bel-shalti-Nannar antwortete sehr wahrscheinlich, so oder ähnlich: »Aha, mein Kind ist wissbegierig, das gefällt mir, was möchtest du denn wissen.«
Und sie würde darauf sagen: »Das weiß ich nicht, darum geht es ja gerade, um die Dinge, die ich nicht weiß!«
»Gut«, würde Bel-shalti-Nannar erwidern, »du weißt also noch nicht, was du mich fragen willst, dann komme morgen wieder, wenn du dir eine Frage überlegt hast.« Oder sie sagte einfach: »Mein Kind, das brauchst du jetzt noch nicht zu wissen, ich werde es dir erklären, wenn es an der Zeit ist, hast du sonst noch eine Frage?«
Von Bel-shalti-Nannar würde sie nichts erfahren, wenn sie etwas herausfinden wollte. Also musste sie allein versuchen, zu ergründen, was Tamkaru in Kush wollte.
Tamkaru hatte vor seiner Abreise lange Gespräche mit Bel-shalti-Nannar geführt, an denen Moiria wie üblich nicht teilnahm. Bel-shalti-Nannar hatte sie früher oft eingeladen, daran teilzunehmen. Aber nachdem Moiria sich dabei immer nur gelangweilt hatte, hatten sie es wieder gelassen. Es war dabei ausschließlich um Kapital, Waren und Gewinne gegangen.
Beim letzten Mal mussten Bel-shalti-Nannar und Tamkaru aber etwas anderes besprochen haben. Denn die Güter, die die Kaufleute seit urdenklichen Zeiten aus Kush holten, waren die gleichen geblieben. Tamkaru beförderte sie in regelmäßigen Abständen auf seinen Karawanen und Schiffen. Und sie würden weiterhin gehandelt, auch ohne dass er zweimal hintereinander nach Meroë reiste. Wenn es etwas Neues gegeben hätte, ein seltenes Tier, eine Pflanze, ein Gewürz, ein Duftöl, einen feinen neuen Stoff oder neue Schminke, oder die Künstler sich in einer neuen Fertigkeit übten, Tamkaru hätte ihr beim letzten Mal schon davon erzählt und es ihr längst mitgebracht.
Um was ging es also wirklich? Was hatte Bel-shalti-Nannar vor? Was konnte sie wollen, von diesem Land, in dem Tamkaru nun zum wiederholten Mal war?. Moiria überlegte, was sie über Kush wusste. Aus Kush kamen Gold, Edelsteine, Elefantenstoßzähne, Tierfelle, Ebenholz, Harze und Augenschminke. Es war der südliche Nachbar des von den Persern besetzten Ägyptens und sein König hieß Siaspiqa. Mehr wusste sie nicht über Kush. Es war nicht allzu viel, wie sie zu ihrer Bestürzung feststellte, obwohl Tamkaru ihr immer ausgiebig davon berichtet hatte.
Ein Land, das so weit weg war und mit dem Bel-shalti-Nannar irgendetwas im Sinne hatte. So sehr Moiria auch versuchte herauszufinden, was es war, sie kam nicht darauf.