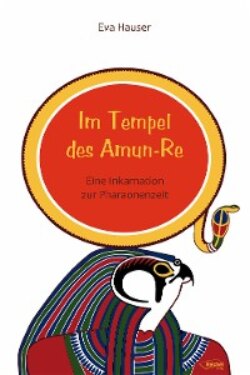Читать книгу Im Tempel des Amun-Re - Eva Hauser - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nebukadnezar
ОглавлениеNebukadnezar ließ sich des Öfteren in Bel-shalti-Nannars Palast in Ur sehen. So hatte er es auch heute vor. Er wollte ein vertrauliches Gespräch mit seiner Tochter führen, denn er befürchtete, dass Bel-shalti-Nannar sie immer mehr beeinflussen und ihm mit der Zeit entfremden könnte. Er wollte sich Moirias vergewissern. Ihrer Unterstützung musste er sicher sein, wenn er seine Pläne in die Tat umsetzen wollte.
Doch noch war ihm Bel-shalti-Nannar im Wege. Denn sie hatte nicht vor, ihm bei der Vorbereitung und Durchführung des Krieges gegen die Perser zu helfen. Er wusste genau, dass Bel-shalti-Nannar letztlich dasselbe Ziel verfolgte wie er, wenngleich mit anderen Personen.
In letzter Zeit pflegte sie verstärkt Kontakte mit Kush. Wegen des Goldes tat sie das sicher nicht, davon hatte sie schon mehr als genug. Etwas anderes gab es dort, das sie haben wollte und das für sie kostbarer war als Gold, es war Eisen.
Sie brauchte Eisenwaffen. Und sie konnte Eisen nicht selbst herstellen. Es gab hier keine Eisenerzvorkommen, und es gab keine Wälder, die Holz geliefert hätten, um die Hochöfen zu heizen. Auch wenn beides vorhanden gewesen wäre, Bel-shalti-Nannar hätte nicht in aller Öffentlichkeit Hochöfen betreiben können, ohne Argwohn bei den Persern zu erregen. Also mussten die Waffen von anderswo bezogen werden, aus Meroë, wo es Eisenerz, Holz und Hochöfen in Fülle gab. Dort würden Pfeil- und Speerspitzen aus Eisen hergestellt und als fertige Waffen auf Tamkarus Karawanen verladen und zwischen seinen Handelswaren hierhergebracht werden.
Soweit stimmten Bel-shalti-Nannars und Nebukadnezars Ansicht über die Vorgehensweise überein. Er musste ebenso handeln. Denn auch er benötigte Waffen, um die Rebellen auszurüsten, die seit langen Jahren hinter ihm standen und auf den Tag warteten, an dem sie endlich losschlagen konnten. Es war nur von Vorteil, wenn Bel-shalti-Nannar schon die Vorbereitungen getroffen hatte und durch Tamkarus Vermittlung mit Siaspiqa einig geworden war. Sie würde ihm, Nebukadnezar, in die Hände arbeiten, solange sie noch am Leben war. Für eine kurze Zeit wollte er sie noch gewähren lassen. Nur zulange durfte es nicht mehr sein. Sie musste sterben, ehe sie ihre Vorsätze weiter ausführen konnte.
Denn was die weitere Zukunft betraf, unterschieden sich Bel-shalti-Nannars und Nebukadnezars Pläne deutlich. Sie hatte ihn bei der späteren Verteilung der Macht nicht vorgesehen. Außerdem wusste sie sehr gut, dass es keinen Platz mehr für sie gäbe und ihre Stunden gezählt wären, wenn er an die Herrschaft käme. Deshalb wollte sie sich von vornherein auf keine Gefahr einlassen und ihn von Anfang an nicht mit dabeihaben.
Nebukadnezar hatte ursprünglich erwartet, dass sie ihn um seinen Rat bitten und ihn mit dem Unternehmen betrauen würde. Denn ohne das Wissen und Können eins Mannes wie ihn, konnte Bel-shalti-Nannar keinen Krieg führen. Er hatte gehofft, dass sie sich für ihn entscheiden würde. Wäre es so gekommen, dann hätte er vor gehabt, sie schrittweise von den Informationen abzuschneiden, bis sie isoliert gewesen wäre. Dann hätte er sie vollends außer Kraft gesetzt.
Bel-shalti-Nannar mochte über langjährige politische Erfahrung verfügen, aber deshalb war sie noch kein Feldherr. Hier war ihr, auch wenn sie es äußerst ungern wahrnahm, eine Grenze gesetzt. Immer hatte sie jedoch auch jenseits dieser Grenze ihren Willen ausführen lassen wollen. Männer waren dabei ihre Erfüllungsgehilfen gewesen. Um sicherzustellen, dass diese ihre Aufträge genau einhielten, belohnte sie sie erst bei Erfolg, mit Silber, mit einem Posten in der Tempelverwaltung, mit der Beteiligung an einem ertragreichen Geschäft oder mit einem neuen, noch anspruchsvolleren Auftrag.
Je fähiger diese Männer waren, umso weniger gab es davon, umso teurer waren sie und umso riskanter wurde es für Bel-shalti-Nannar, sie zu beschäftigen. Sie musste immer noch mehr, noch Begehrenswerteres, noch einflussreichere Positionen bieten und dabei darauf vertrauen, nicht selbst übervorteilt zu werden. Nebukadnezar fragte sich, wer es sein könnte, den sie auf ihr nächstes Ziel ansetzte, und was sie ihm wohl in Aussicht stellte, damit er tätig würde. Sehr viel müsste es sein, mehr als Bel-shalti-Nannar im Augenblick selbst besaß. Im Geiste hatte sie wohl schon ganz Babylonien und Akkad inne und lockte damit.
Nebukadnezar dachte an Jesed: er könnte der Mann sein, den sie mit ihrem Vorhaben betraute. Er vermutete sehr, dass es Jesed sein würde. Denn Bel-shalti-Nannar und Jesed hatten schon des Öfteren erfolgreich zusammengearbeitet.
Die äußeren Begrenzungen von Ur tauchten vor Nebukadnezar auf und er ließ seine Pferde ausgreifen. Es würde viel geschehen in der nächsten Zeit, und er wollte nicht länger mehr Zuschauer sein, sondern Verursacher, Lenker und Herrscher.
Moiria ging immer noch ihren Gedanken nach, als ihr Vater den Palast erreichte. Sie überlegte gerade, was Tamkaru ihr wohl aus Meroë mitbringen würde. Hübsche Dinge aus Gold oder Elfenbein oder Edelsteine konnten es nicht sein. Die hatte er ihr schon von seinen früheren Reisen dorthin mitgebracht, und er wiederholte sich nicht. Es musste also etwas ganz anderes sein. Aber was? Moiria rätselte. Ein Leopardenfell vielleicht? Er hatte ihr erzählt, dass die Priester es dort über ihren Gewändern trügen. Ob ...
Moiria erwachte wie aus einem Schlaf, so tief war sie in ihren Gedanken gewesen. Hatte da nicht jemand etwas zu ihr gesagt? Sie sah ihr Gegenüber aus verwunderten Augen an. Es war nicht Bel-shalti-Nannar, wie sie zu ihrer großen Erleichterung feststellte, sondern Shabarad, eine ihrer Dienerinnen. Nebukadnezars Besuch wurde ihr gemeldet und sie lief ihm entgegen.
Bel-shalti-Nannars Blick war auf den Horizont gerichtet. Bald würde die Sonne untergehen und ein kühler Hauch würde sie umwehen. Dann war sie allein mit sich und den Sternen, die kalt vom Himmel blitzten und die unbeteiligt auf sie herabsahen. Die Sterne, die schon da waren, als sie geboren wurde, als Ina-Esagila-Rimat, Tochter der Nitocris und des Nabonid. Die Sterne, zu denen sie wollte, die alles wussten. Die gesehen hatten, wie sie zusammen mit ihrem Bruder Belshazzar, den sie gehasst hatte, aufgewachsen war.
Belshazzar, der ihr vom Vater immer vorgezogen wurde, nur weil er ein Junge war. In den Augen des Vaters konnte er alles und jedes besser als sie. Dabei war es genau umgekehrt. Sie konnte schneller laufen und länger durchhalten als er, sie konnte schärfer denken und Zusammenhänge durchschauen, sie hatte eine geschwindere Auffassungsgabe, sie konnte den Bogen kräftiger spannen und die Ziele genauer treffen als er und ihr Wille war stärker als der seine.
Immer hatte sie ihn besiegt, als sie noch Kinder waren. Der Vater hatte es gewusst, aber er wollte es nicht sehen. Dann, eines Tages, hatte er ihr verboten, weiter an der Ausbildung der Jungen teilzunehmen, weil sie ein Mädchen war.
»Aber Vater«, hatte sie gerufen, »ich will kein Mädchen sein, ich will ein Junge sein.«
»Du bist und bleibst ein Mädchen, also lebe danach«, hatte er gesagt.
Und die Sterne hatten alles gesehen. Auch, dass Belshazzar zum Kronprinz ernannt wurde, als Nabonid schließlich, nachdem innerhalb eines Zeitraumes von sechs Jahren die drei Könige, die Nebukadnezar II. auf den Thron folgten, Awil-Marduk, Neriglissar und Labaschi-Marduk, ermordet wurden, zum König von Babylon ausgerufen wurde, und sie nur die Prinzessin war.
Sie hatte ihren Vater angefleht: »Höre auf mich, du machst einen Fehler, Belshazzar ist ein Weichling, er ist ein Versager, er ist dumm, er kann nichts. Er kann niemals dein Nachfolger sein. Ernenne mich dazu.«
»Du bist nur eine Frau«, hatte Nabonid geantwortet.
»Als Frau bin ich ein besserer Mann als er, das weißt du doch, Vater.«
»Es bleibt bei meinem Wort, endgültig, und du hast dich zu fügen.«
»Nein«, hatte sie gerufen, »niemals werde ich mich fügen, ich kann regieren, ich kann mächtig sein.«
»Was willst du mit der Macht, als Frau? Den Männern gehört die Macht. Längst hättest du verheiratet sein sollen, doch immer hast du es verstanden meine Pläne zu vereiteln.«
»Ich will nicht heiraten, ich will mich nicht unterordnen.«
»Du kennst die politische Lage. Du weißt, welche Gefahr unserem Reich drohen kann, wenn wir es nicht verstehen, uns mit unserem Gegner zu verbünden. Deshalb ist es von größter Bedeutung, dass du in das persische Königshaus einheiratest.«
»Das tue ich nicht, niemals.«
»Du kannst unserem Volk damit um vieles mehr dienen, als wenn du es regierst.«
»Nein sage ich, und wenn du mich dazu zwingst, dann bringe ich den Mann um, an den du mich verheiratest.«
Wütend wurde das Gespräch daraufhin zwischen ihnen. Aber ihr Wille war wie ein Bollwerk. Nabonid kam nicht dagegen an. Er gebrauchte derbe Worte und wollte, dass sie demütig sei, aber sie antwortete ihm:
»Demut, das ist doch eine Erfindung der Männer, damit die Frauen und Untergebenen sich noch mehr gefallen lassen müssen. Sollen sie es doch tun, die anderen Frauen, aber ich nicht. Ich gehe meinen eigenen Weg, und kein Mann wird mir je befehlen. Und wer mich herausfordert, der wird es bitter bereuen.«
Nabonid wusste, dass sie ihre Worte wahr machen würde. Er hatte keine Wahl. »Meine Tochter«, sagte er schließlich, »ich kann dich nicht dazu zwingen zu heiraten, aber Babylon bekommst du nicht.«
Da sagte sie ihm, was sie wünschte. »Wenn ich schon Babylon nicht von dir bekomme, dann will ich Ur.«
»Du willst Ur?«
»Ja, ich will Ur. Bau mir einen Palast dort, einen Palast wie diesen. Ich will die Hohepriesterin des Nannar und der Ningal sein. Und lass die Zikkurat ändern, sie ist falsch. Sie hat nur drei Stufen. Lass sie aufmauern, sie muss siebenstufig sein.«
So war es geschehen. Sie hatte Ur bekommen und ihren Palast und die siebenstufige Zikkurat im heiligen Bezirk.
Die Sonne versank und Bel-shalti-Nannar sah den Sternen zu. Sie hatten alles mit angesehen. All die Ungerechtigkeit kannten sie und hatten erlebt, wie sie sich selbst behauptet hatte. Und wie sie sich behauptet hatte! Belshazzar, der Weichling war nicht mehr. Aber sie war noch da. Sie war die Stärkere gewesen. Wie Recht sie doch damit gehabt hatte, ihrem Vater zu sagen, dass ihr Bruder nichts tauge. Wie recht sie doch immer mit allem gehabt hatte. Sie, die Herrscherin und die Königin von Ur, die mächtigste Frau.
Lichter aus Ur und aus dem heiligen Bezirk leuchteten herauf. Lichter des Himmels glitzerten über ihr. Bel-shalti-Nannar war dazwischen. Sie atmete das Licht ein, sie ließ es strömen und Strahlen von ihren Fingerspitzen in die Nacht hinaus gleißen. Sie sog das Licht ein, bis ihr Körper heiß wurde, bis sie die Hitze kaum mehr aushielt, bis an die Grenze, wo sie zu verbrennen drohte.
Tamkaru befand sich auf der Rückreise nach Ur. Er liebte es, unterwegs zu sein. Längst hätte er sich zur Ruhe setzen können, doch immer wieder zog es ihn hinaus, zusammen mit seinen Männern und treuen Freunden. In den Karawansereien und unter freiem Himmel war er mehr zu Hause als in seinem kostbar ausgestatteten Wohnhaus in Ur.
Auf der Karawanenroute, die von Meroë zum Roten Meer führte, hatte er die Wüste durchquert. Nun war er an Bord eines seiner Seeschiffe, das entlang der Küste um die arabische Halbinsel segelte. In wenigen Tagen würde er die Insel Telmun erreichen, einen Hauptumschlagsplatz für die Güter der Kaufleute. Tamkaru war gern auf Telmun, mit seinem geschäftigen Treiben, den Rufen der Männer und dem Aufeinandertreffen der verschiedenen Kulturkreise. Er blieb immer für einige Zeit, bevor er nach Ur weiterreiste, denn Ur war ihm zu ruhig geworden. Mit jedem Jahr wurde es stiller. Auf seinen Straßen war es meist leer, und in seinem Hafen legten nur noch Flussschiffe an. Früher, als die Seeschiffe seines Großvaters und dessen Vorväter Ur noch anlaufen konnten, war es eine Stadt pulsierenden Lebens gewesen. Heute hatte sie nur noch Anziehungskraft durch das Nannar- und Ningalheiligtum und seine Hohepriesterin Bel-shalti-Nannar. In dem Maße, wie die Mündung des Stromes zum persischen Golf hin versandete, verlor die Stadt an wirtschaftlicher Bedeutung.
Doch diesmal wollte Tamkaru sich nicht auf Telmun aufhalten. Es drängte ihn, nach Ur zu kommen. Auch sein Schiff, das er aus Indien zurückerwartete, das in diesen Tagen einlaufen sollte, konnte ihn nicht davon abhalten. Es zog ihn zu Bel-shalti-Nannar. Die Blütenessenzen, die Seidenstoffe und die Perlen aus Indien, die sie wünschte, konnten warten. Das, was er ihr zu sagen hatte, vertrug keinen Aufschub, sondern verlangte größte Eile.
Tamkaru entstammte einer reichen, alteingesessenen Kaufmannsfamilie der Stadt Ur. Schon sein Vater hatte für Bel-shalti-Nannar Handelsgeschäfte geführt. Sie hatte ihm Kapital anvertraut, das er für sie investierte, und Waren, die er für sie verkaufte. Heute besaß Tamkaru Bel-shalti-Nannars Vertrauen. Er allein wahrte sämtliche Handelsinteressen des enormen Tempeleigentums. Diese Eigenschaft hatte sein Ansehen, das er über die Grenzen des persischen Reiches hinaus genoss, noch erhöht und er war dadurch zu noch größerem, zu außerordentlichem Reichtum gekommen.
Tamkarus und Bel-shalti-Nannars Beziehungen führten nach Afrika, ans Mittelmeer und bis nach Indien. Ihre Zusammenarbeit erstreckte sich jedoch nicht nur auf Handelsgeschäfte. Tamkaru war auch der erste Informant Bel-shalti-Nannars. Denn als Kaufmann konnte er überall hinreisen und unter dem Vorwand, Geschäfte abschließen zu wollen, mit jedem sprechen, selbst mit Feinden des persischen Reiches.
Er ging bei den Herrschern ein und aus, er sah und hörte, was in ihren Familien, in ihren Palästen, in ihrem Volk und in ihren Heeren geschah. Wieder zu Hause in Ur, berichtete er Bel-shalti-Nannar, was er erfahren und beobachtet hatte, und sie, die Ur nicht verlassen durfte, wusste auf diese Weise alles, was sie wissen musste, um ihre Netze immer weiter auszuwerfen. Die Ideen, die sie dabei für das weitere Vorgehen hatte, die Härte, mit der sie Geschäfte abschloss und Gewinne herausschlug, gefielen Tamkaru. Bel-shalti-Nannar hatte eine wahre Händlernatur, die weit und breit ihresgleichen suchte. Selten war er auf seinen Reisen Männern begegnet, mit denen das Handeln so viel Freude machte wie mit ihr. Jemand wie Bel-shalti-Nannar hätte aus jedem beliebigen Bazar, und wäre er auch noch so heruntergekommen, in kürzester Zeit eine Goldgrube gemacht.
Jedes Mal, wenn Tamkaru nach Ur zurückkehrte, betrat er sein Haus nur, um es unmittelbar darauf wieder zu verlassen. Nach einem Bad, mit neuen Kleidern angetan sowie mit erlesenen Geschenken für Bel-shalti-Nannar und Moiria, führte sein erster Weg zum Palast, wo er bereits erwartet wurde. Moiria war dann jedes Mal ein Stück gewachsen und noch hübscher und mädchenhafter geworden, während Bel-shalti-Nannar die gleiche geblieben war, sprühend, geistreich, alterslos und ein Mittelpunkt besonderer Anziehungskraft.
Viele Jahre lang war das so gewesen. Tamkarus und Bel-shalti-Nannars Geschäfte blühten und ihre Verbindungen wurden immer weitreichender. Doch in der letzten Zeit hatte sie sich verändert. Sie war abweisender geworden, in sich gekehrter. Ein gequälter Ausdruck lag in ihrem Gesicht. Ihre Worte waren knapper und entschlossener, ihre Anweisungen duldeten noch weniger Widerspruch als früher, und mancher Gedankengang, an dem sie ihn mit leiser Stimme bruchstückhaft teilnehmen ließ, erfüllte ihn mit Unbehagen. Es war kein Denken innerhalb des Verantwortungsgefüges einer Hohepriesterin mehr. Es war das Denken eines Menschen, der sich nur mehr durch größtmögliche Machtausdehnung Genugtuung verschaffen konnte.
Bisher hatten Tamkarus Ziele und sein Handeln mit dem Willen Bel-shalti-Nannars übereingestimmt, und er hatte große Vorteile daraus gehabt. Aber was nun, wenn es einmal anders wäre? Längst plante Bel-shalti-Nannar nicht mehr nur. Sie begann, die tatsächliche Ereignung ihrer Vorstellungen zu verwirklichen.
Bel-shalti-Nannar sah zu den Sternen. Ein bitterer Geschmack stieg in ihr auf. Er war ihr vertraut. Die Bitterkeit war ihr Begleiter. Im Palast gelang es ihr gewöhnlich, sie hinunterzuschlucken. Aber auf der Zikkurat war das nicht möglich. Hier gab es kein Verbergen, kein Geheimnis vor ihr selbst. Das Versteckte zeigte sich und wurde deutlich. Es wollte bemerkt werden und nicht länger mehr nur der dunkle Teil sein.
Sie wusste es, sie wusste es nur zu gut. Unbarmherzig war ihr Weg gewesen, rücksichtslos und grausam bisweilen. Aber wie hätte sie ihn anders gehen sollen? Nur so hatte sie ihre Aufgabe erfüllen können. Sie hatte so sein müssen, um ihrer Berufung gerecht zu werden. Manches Opfer war dafür auf ihrem Weg geblieben, den sie so und nicht anders weitergehen musste, da sie ihn nun einmal begonnen hatte. Oft hatte sie ihre dunkle Seite geschaut. Wie ein Anfall war es, wenn das Hässliche ihr sein Gesicht zeigte.
Die Bitternis in Bel-shalti-Nannar stieg an. Das gestochen scharfe Bild des Himmels begann zu verschwimmen. Die Sterne wurden blasser und zu trüben Nebeln. Das Oben und das Unten hatten keine klare Abgrenzung mehr. Bel-shalti-Nannar atmete schwer. Sie tastete nach einem Halt und versuchte sich an den Lichtern Urs zu orientieren. Aber die Lichter zerflossen. Der Palast, der Himmel und die Treppe, die von der obersten Terrasse der Zikkurat hinabführte, hatten keine Konturen mehr.
Schwindelgefühl erfasste sie. Die Krone auf dem Kopf, war das oben, oder irgendwo anders? Ein Schwall von Hitze stieg in ihr auf. Unter ihrer Robe wurde es eng und heiß. Sie bekam keine Luft mehr darunter. Mit einer hastigen Bewegung riss sie daran. Da stürzte ihr Kopfputz krachend zu Boden und rollte klimpernd davon. Bel-shalti-Nannar sah dem Geräusch nach, aber sie konnte nichts erkennen. So sehr sie ihre Augen auch anstrengte, die Umrisse zerrannen.
Mit den Händen den Kopf haltend, lehnte sich Bel-shalti-Nannar an den Nannar-Tempel, der inmitten der obersten Zikkurat-Plattform stand. Aber an seinen glatten glasierten Ziegeln rutschte sie ab. Sie sackte in sich zusammen und sank zu Boden. Schwärze umgab sie. In der Dunkelheit vor ihren Augen begann sich ein Bild zu zeigen. Von Zeit zu Zeit erschien es ihr. Manches Mal hatte sie jahrelang Ruhe, dann wieder kam es mit Macht, das Schreckliche, das Unvergessliche, das besser ungeschehen hätte bleiben sollen. Reglos, wie gelähmt lag Bel-shalti-Nannar da und sah das Bild der Erinnerung.
Rote Schlieren begannen zu laufen. Schlieren in blutroter Farbe, die unentwegt flossen, bis sie zu einer großen Lache geworden waren. Der Untergrund, auf dem das Blut floss, war der Palastboden, und es war ihr eigenes Blut. Winzige Arme und Beine lagen in der Blutlache, zerschnittene Teilchen von kleinen Wesen, die Kinder hatten werden wollen. Es waren Zwillinge gewesen, und sie hatte sie sich herausholen lassen, noch bevor die Schwangerschaft sichtbar wurde.
Wie sie so da lag, die Hände um den Bauch gekrampft, von Schmerzen durchwühlt und beinahe verblutend, war noch etwas geschehen. Etwas, das niemals hätte geschehen dürfen und das die Entsetzlichkeit der zerteilten Körperchen ins Unermessliche steigerte. Er, der nie davon erfahren sollte, war noch einmal zurückgekommen. Er war eingetreten und hatte alles gesehen. Er, ihr Geliebter. Vor einer Stunde noch hatte sie ihn weggeschickt. Sie hatte sich erhöht gestellt, in Ornat und Krone, damit sie die Kraft hatte, Nein zu sagen und ihn anzulügen.
»Erwartest du ein Kind?« hatte er gefragt, »unser Kind?«
»Nein!« hatte sie aus ihren zusammengepressten Lippen hervorgebracht.«
»Komm von deinen Stufen herunter, damit ich mit dir sprechen kann!«
»Nein, es ist vorbei!«
»Du kannst mir nichts vormachen. Du liebst mich und ich liebe dich. Wir haben uns immer geliebt und wir werden uns immer lieben. Lass deinen Stolz! Komm zu mir und heirate mich!«
»Nein!« hatte sie gerufen.
»Wir werden zusammen regieren, gemeinsam werden wir herrschen über Babylonien und Akkad, das Land deiner Väter!« beteuerte er, »nie werde ich eine Entscheidung ohne dich treffen, wir werden gleichberechtigt sein! Sobald ich der Satrap Babyloniens bin, dann bekommst du durch mich das Reich deines Vaters zurück.«
»Du hast es gesagt«, sprach sie, »du wirst der Satrap sein, der Statthalter, ganz recht, du, nur du und nicht ich, nicht wir beide gemeinsam, sondern nur du!«
»Offiziell wohl, aber du weißt doch wie ich, dass von höchster Stelle unsere Verbindung sehr begrüßt und gefördert wird, es wäre für alle nur von Vorteil! Sei bereit, Ur aufzugeben und komm mit mir. Ich will keine Heimlichkeiten mehr und mich wie ein Dieb zu dir schleichen müssen, wenn ich dich in meinen Armen halten will. Lass deinen Palast und den heiligen Bezirk. Eine deiner Priesterinnen kann alles in deinem Sinne weiterführen! An meiner Seite wirst du mehr Macht haben als hier! Warum weigerst du dich? Vertraue mir! Wir werden Großes vollbringen!«
Sie stand oben auf ihren Stufen. »Meine Entscheidung ist gefallen. Nein lautet sie, n e i n !« Sie wollte noch einmal nein sagen, aber er sah sie nur an. Das Wort erstarb ihr auf den Lippen.
Er glaubte ihr nicht. Den Kopf schüttelte er über sie. Trotzdem ging er.
Bel-shalti-Nannar ließ die Dienerin, der sie am meisten vertraute, sich überzeugen, dass er tatsächlich davon ritt und nicht irgendwo in der Nähe blieb. Als sie sich sicher wähnte, dass er Ur wirklich verlassen hatte, hatten sie angefangen. Unterwegs musste ihn ein Verdacht zum Umkehren bewogen haben. Er war wieder zurückgeritten. Die Wache am Seiteneingang ließ ihn auf demselben Weg herein, auf dem er zuvor hinausgegangen war.
Bel-shalti-Nannar fühlte wieder die stechenden und schneidenden Schmerzen und sah ihn vor sich, wie der Anblick ihn erstarren ließ. Wie ihn das Entsetzen ergriff über die Frau, die er liebte. In grauenvoller Unwiederbringlichkeit breitete sich die Blutlache aus, und mit ihr etwas, das noch grauenvoller war: die Gewissheit, dass sie, Bel-shalti-Nannar, wieder so entscheiden würde.
Moiria konnte sich nicht in den Schlaf fallen lassen. Sie lag wach auf ihrem Ruhebett und sah den Lichtreflexen zu, die über die hohen Palastwände huschten. Von Ferne hörte sie das Gemurmel der Dienerinnen. Auch die Luft war nicht still, sie brauste und vibrierte, so als ob alles Bel-shalti-Nannars hohe Energie angenommen hätte.
Seit Stunden rannen Moirias Tränen. Bis zum Morgen hatte sie noch Zeit, dann sollte keiner mehr sehen, was seit dem Besuch ihres Vaters in ihr vorging und wofür sie keine Lösung sah. Wie auch immer sie es wendete, sie fand nichts, um es wegzuschaffen oder aufzuhalten. Seit sie davon wusste, war es da, mitten in ihrem Leben, und es ließ sich auch nicht rückgängig machen.
Im Gegenteil, es würde weitergehen und sich auswachsen, und weil sie mitwusste, würde sie mitverantworten, verantwortlich sein durch die Entscheidung, die sie traf. Und sie konnte diese durch nichts umgehen. Auch nicht dadurch, dass sie sich nicht entschied. Denn keine Entscheidung war auch eine Entscheidung und zwar dafür, dass die Dinge ohne ihre Einwirkung weiterlaufen würden. So hätte also auch das Folgen.
Ob sie tat oder nicht, ob sie unterließ oder nicht, es würde immer eine Ursache sein. Eine Verursachung, die eine Wirkung nach sich ziehen würde. Jede Auswirkung, die sich daraus ergab, war ihr schrecklich. Doch welche davon sollte sie wählen, welches Übel war das geringere? Wie sehr sie sich auch quälte, sie wusste es nicht.
Wieder begann sie alle Möglichkeiten zu durchdenken und auch, ob sie sich jemandem wie Jesed oder Tamkaru anvertrauen sollte. Doch sie verwarf es wieder. Einmal, weil sie nicht sicher war, ob die beiden darüber Schweigen bewahrt hätten, Jesed würde es sich vielleicht sogar auf seine Weise zunutze machen, eine zusätzliche Gefahr. Zum anderen, weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass einer von ihnen einen Ausweg gekannt hätte.
Längst waren die Laken durchnässt von all den Schluchzern, die sie versucht hatte darin zu ersticken, damit nur keine der Dienerinnen sie hörte. Mehr und mehr kam sie zu der Überzeugung, dass es einen Ausweg gar nicht gab, und tatsächlich nur die zwei Möglichkeiten blieben, zwischen denen sie zu entscheiden hatte. Ließ sie Bel-shalti-Nannar eine Warnung zukommen, dann würde diese nicht eher ruhen, bis sie herausgefunden hätte, wer nach ihrem Leben trachtete. Auf Nebukadnezar fiele ihr Verdacht sehr schnell. Moiria wusste, dass Bel-shalti-Nannar dann nach einer Gelegenheit suchen würde, Nebukadnezar umbringen zu lassen. An einem Ort und in einem Augenblick, da keiner vermuten konnte, dass sie den Auftrag dazu gegeben hatte.
Das also konnte Moiria nicht tun. Ebenso gut hätte sie Bel-shalti-Nannar gleich die Wahrheit von Angesicht zu Angesicht sagen können. Warnte Moiria Bel-shalti-Nannar aber nicht und ließ Nebukadnezar gewähren, dann bliebe zwar er am Leben, aber Bel-shalti-Nannar war in Gefahr. Wie nur sollte Moiria sie davor bewahren, ohne Nebukadnezar ihrer Rache auszuliefern?
Wenn Bel-shalti-Nannar ermordet werden würde, dann müsste sie ewig mit der Gewissenslast leben, ihren Tod nicht verhindert zu haben. Doch nicht nur das. Sie selbst wäre dann Entu. Allein mit der Macht, der Verantwortung, die sie nicht haben wollte. Allein und ausgeliefert all denen, die jetzt noch taten, was Bel-shalti-Nannar wollte, die aber nur auf ihre Stunde warteten.
Ein Spielball würde sie sein, zwischen den Interessen all derer, die je nach Gunst und Gelegenheit für oder gegeneinander arbeiteten. Zwischen all diesen Menschen müsste sie die Zügel von Bel-shalti-Nannar übernehmen, in fliegendem Wechsel, auf einer rasenden Fahrt mit unbekanntem Ziel, über das, wie ihr schien, selbst der Wagen und die Pferde mehr wussten als sie selbst.
Nein, sagte sie sich, nein, das durfte nicht geschehen. Niemals. Den Tag, an dem sie Hohepriesterin werden würde, wollte sie so weit wie möglich von sich schieben. Sie fürchtete sich davor. Wenn er einmal kam, dann sollte er erst in sehr vielen Jahren sein, und sie hoffte, dass sie dann auch bereit dafür sein würde. Vorzeitig, so wie Nebukadnezar sich das dachte, sollte dieser Tag nicht herbeigeführt werden. Er sollte sein, wenn die Zeit dafür war. Jetzt war sie nicht, noch nicht. Sie wollte es nicht.
Moiria sah an den Palastwänden empor, so als ob diese sie trösten konnten oder eine Lösung wussten. Auch die Wände schienen wach zu sein, das ganze Gebäude und die Nacht selbst waren in Bewegung. Das Singen in der Luft und die flackernden Lichter führten ein eigenes Leben.
Moiria hielt die Hände vors Gesicht. Gab es denn kein Entrinnen? Immer stärker stiegen die Übelkeit, die Ablehnung und die Angst in ihr auf. So unvereinbar war alles, dass sie dachte, sie selbst solle zerstört werden, von den Kräften die an ihr zerrten. Das Ansinnen Nebukadnezars, die Forderungen Bel-shalti-Nannars, die Erwartungen, die sie selbst an sich stellte, waren nicht miteinander in Einklang zu bringen. Sie waren unversöhnlich und kämpften gegeneinander, mitten in ihr, genau da, wo es am meisten schmerzte.
Nebukadnezars Besuch heute hatte zunächst so ausgesehen wie all seine Besuche, die von Zeit zu Zeit stattfanden. Die Beiläufigkeit, mit der er sprach, als er von der Familie erzählte. Die Distanziertheit, mit der er sich nach ihrem Befinden erkundigte. Fast hatte sie geglaubt, er wolle schon wieder gehen, als er endlich zur Sache kam und den eigentlichen Grund seines Besuches enthüllte. Und wie er es gesagt hatte, ebenso beiläufig wie all das andere vorher auch, als ob es ganz selbstverständlich sein müsse. So nebenher hatte er es erwähnt, dass sie zuerst gedacht hatte, er scherze.
Doch dann hatte sie sein entschlossenes Gesicht gesehen, wie aus Stein schien es zu sein. Er wünschte Bel-shalti-Nannars umgehendes Ableben, und da dieses bei natürlichem Verlauf wohl noch Jahre auf sich warten ließe, sollte Moiria es mit Gift in Bälde herbeiführen.
Bel-shalti-Nannar! Das konnte er doch nicht verlangen. Niemals konnte er ein solches Ansinnen an sie stellen! Immer noch sah sie sein Gesicht ganz deutlich vor sich. Er hatte nicht damit gerechnet, dass sie von sich weisen würde, was er von ihr wünschte. Er hatte erwartet, dass sie auf seinen Plan eingehen würde, ihm zuliebe, der Familie zuliebe. Sie hatte es ihm angesehen. Er war enttäuscht von seiner Tochter. Ärger und Groll zeigten sich für einen kurzen Augenblick in seinem Mienenspiel, bis er seinen üblichen beherrschten Ausdruck wiederfand. Während sie beide sich angeschwiegen hatten, war in seine Augen ein grauer Schimmer getreten und in seine Mundwinkel etwas Verächtliches.
Wieder packten Moiria die Tränen und schüttelten sie. Warum nur musste alles so sein? Und wie nur, wie sollte es jetzt weitergehen? Was sollte sie tun, jetzt da es Morgen wurde und sie Bel-shalti-Nannar gegenübertreten musste. Dass sie ihr gestern nach Nebukadnezars Besuch nicht mehr begegnet und auch nicht zu ihr gerufen worden war, betrachtete Moiria als außergewöhnlich seltene und glückliche Fügung. Denn Bel-shalti-Nannar hätte ihr sofort angesehen, was sich ereignet hatte.
Nebukadnezar wäre dann vielleicht nicht mehr lebend aus Ur herausgekommen. Dank des gütigen Schicksals, das Moiria noch Aufschub geschenkt hatte, bis sie Bel-shalti-Nannar begegnete, war er inzwischen bestimmt seit dem Abend wieder Zuhause in Uruk. Moiria glaubte, dass er erst von dort aus Weiteres in die Wege leiten würde, jetzt, da er ohne ihre Mithilfe war. Vielleicht blieb noch Zeit, vielleicht lange genug, um doch noch einen Ausweg zu finden.
Doch zunächst war es das Wichtigste, dass Bel-shalti-Nannar nichts merkte. Sie durfte es ihr nicht ansehen. Sie durfte nicht aufmerksam werden, auf das scheußliche, das mulmige Gefühl, dass sich genau zwischen ihrem Herzen und ihrem Nabel festgesetzt hatte. Es musste weg, ganz schnell weg.
Enki sollte kommen. Moiria nahm einen tiefen Atemzug, setzte sich auf und rief nach ihren Dienerinnen. Die Mädchen stürzten herbei. »Holt Enki, rasch!« trug sie ihnen auf. Die Dienerinnen entfernten sich.
Moiria saß voll ungeduldiger Erwartung auf ihrem Bett, als Enki nahte. Er strahlte. Stets war er glücklich, wenn er gerufen wurde und helfen durfte. Sein kugelrundes, gutmütiges Gesicht wippte wie sein ganzer Körper beim Laufen.
Enki, der alles für Bel-shalti-Nannars und Moirias Gesundheit tat, hatte wegen der außerordentlichen Heilkraft, die durch seine Hände strömte, viel Leid erfahren müssen. Er war Gefangengehalten, ausgenützt, unterdrückt und in seiner Kindheit entmannt worden. Auf wundersamen Wegen war er schließlich eines Tages nach Ur in Bel-shalti-Nannars Palast geraten. Er fand Vertrauen und Verständnis und ein Zuhause, das ihm Würde ließ. Seitdem war er für Bel-shalti-Nannars Wohlergehen verantwortlich, und ihr einst sehr angeschlagener Gesundheitszustand besserte sich zusehends.
Als er jetzt Moiria erblickte, verzog sich seine Miene sogleich besorgt. Er fühlte ihre Stirn, dann schüttelte er den Kopf, und tätschelte beruhigend ihre Hand: »Es ist nicht das Fieber.«
»Enki, es geht mir entsetzlich, so furchtbar wie noch nie! Du musst mir helfen!«
Sein liebes Gesicht war ernst und er betrachtete sie forschend. Er streckte seine Hände aus und hielt sie behutsam in einiger Entfernung oberhalb ihres Nabels. Moiria brauchte nichts zu sagen.
Enki wackelte vorwurfsvoll mit dem Kopf. »Das sitzt so fest, es muss schon länger da sein. Was hast du nur wieder angestellt, warum hast du mich nicht eher gerufen?«
»Es ist erst heute Nacht gekommen und ich habe die ganze Zeit nicht geschlafen!«
»Deshalb siehst du so aus, zum Fürchten.«
»Enki, ich spüre es schon, es wird besser, aus deinen Händen strahlt so viel Wärme.«
»Ich tue, was ich kann, das weißt du doch. Bel-shalti-Nannar darf dich auf keinen Fall so sehen. Sonst regt sie sich nur wieder auf und das ist nicht gut für sie!«
Moiria fühlte sich bereits leichter. Wie ein warmer heller Strom floss es aus Enkis Händen und durchrieselte sie. Das Kalte und Dunkle begann sich zu verflüchtigen.
Enki schloss die Augen, während er alle Heilkraft, die strömte und die er zu leiten vermochte, weitergab. Ein paar Tränen rannen dabei über seine dicken runden Wangen.
Moiria ging es immer besser. Das Kalte, Dunkle war lichter geworden. Immer weicher und durchlässiger wurde es, bis es sich vollends auflöste. Sie streckte sich wohlig aus und hätte am liebsten einschlafen mögen. Sie gähnte. Enki nickte zufrieden, tätschelte ihr noch einmal die Hand, dann ging er hinaus.
Schräg unter ihren Haaren hervor sah Moiria auf das Tablett mit den frisch aufgeschnittenen Früchten und dem Tee, das inzwischen hereingebracht worden war. Sie betrachtete es eine Weile, unschlüssig, ob sie aufstehen oder noch liegenblieben sollte. Schließlich raffte sie sich auf. Das scheußliche Gefühl war verschwunden. Sie dehnte sich. Wie gut, dass es einen Enki gab. Und wie gut, dass er verschwiegen war. Falls Bel-shalti-Nannar schon am so frühen Morgen bemerkt hätte, dass Moiria hatte behandelt werden müssen, dann hätte Enki, falls sie ihn darüber befragt hätte, mit liebenswürdigem Lächeln etwas völlig Harmloses gesagt. Beispielsweise, dass er sich plötzlich in Sorge um Moirias Gesundheitszustand befunden habe und bei ihr war, aber zu seiner Freude sagen könne, dass es ihr sehr gut ging. Das war keine Lüge und außerdem musste Bel-shalti-Nannar nicht alles merken.
Moiria nahm einen Spiegel und blickte hinein. Sie sah aus, als ob sie eine erholsame Nacht besten Schlafes und schönster Träume erlebt hätte. Sie gefiel sich. Das war also geschafft. Sie würde später wie immer in Bel-shalti-Nannars Hof gehen können, ohne dass jemand etwas von ihren Sorgen bemerkte.
Sicher kam Ina bald und sie würden erst über Verschiedenes sprechen, das Mädchen gern miteinander bereden. Dann konnten sie sich die Nägel neu mit Blattgold belegen lassen. Ach nein, das war erst gestern geschehen, sie waren noch in Ordnung. Nun dann würde Ina und ihr etwas anderes einfallen. Vielleicht neue Frisuren. Das scheußliche Gefühl war fast verschwunden. Moiria trank ein paar Schlucke und aß ein paar Bissen. Sie würde sich heute etwas sehr Gutes überlegen müssen. Sofort wollte sie damit beginnen, sobald sie angekleidet war.
Die Früchte waren heute nicht richtig süß. Sie versuchte von einer anderen Sorte, auch die schmeckte nach nichts. Im Tee dagegen war zu viel Honig, er war widerlich schal und dabei fast klebrig. Eine Unverschämtheit vom Küchenhaus, so etwas zuzubereiten und eine Schlampigkeit und Nachlässigkeit von ihren Dienerinnen, so etwas überhaupt anzunehmen. Sie würde sie später dafür ausschelten. Jetzt hatte sie keine Lust dazu. Sie wollte auch keine neuen Früchte und keinen neuen Tee. Missmutig schob sie alles von sich.
Sie wusste, dass sie irgendetwas unternehmen musste, ohne jedoch zu wissen, was. Sie wusste, dass sie auf jeden Fall etwas zu tun hatte. Widerwillen erfüllte sie, gegen das Tablett, gegen den Raum und gegen die Unabänderlichkeit. Je länger sie die Früchte voll Unbehagen anstarrte, umso mehr überkam sie die Vorstellung, dass dieser Tag verstreichen würde, ohne dass sie eine Lösung gefunden hätte, dass auch die folgende Nacht und die darauffolgenden Tage und Nächte so vergehen würden.
Das scheußliche Gefühl war wieder da. Es kletterte hoch, durch ihr Herz, in ihren Hals. Es würgte sie und sie hätte laut schreien und das Tablett gegen die Wand schleudern mögen.