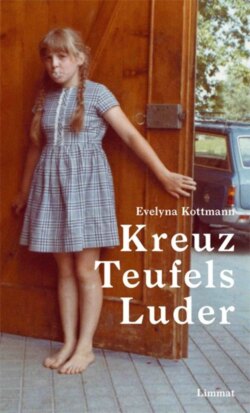Читать книгу Kreuz Teufels Luder - Evelyna Kottmann - Страница 10
Zwei
ОглавлениеIch, Luisa, liebte meinen Bruder Arabat, der sehr ängstlich war, blond gelocktes Haar hatte und wie ein blasser Engel aussah. Wir lebten seit Kurzem in einem Häuschen am Dorfrand, auf einem Fabrikareal, wo es immer nach Eisen roch. Wir waren weggezogen aus einem Haus, das meine Mutter Lilith nicht behalten durfte. Denn es gab dort keinen Strom und kein Wasser, und es war nicht schön dort für uns Kinder.
Ich war blondrot, klein, frech und grenzenlos lebendig. Arabat und ich stritten uns nicht, wir spielten miteinander, und ich gab den Ton an. Meine Mutter Lilith durften wir nicht stören, wenn sie Besuch von Männern hatte. Wir durften dann nur in unserem Zimmer sein. Arabat hielt sich an ihre Anweisungen, ich, Luisa, aber nicht. Mir war im Zimmer langweilig. Manchmal hatte ich Hunger, eigentlich immer, denn Mutter Lilith kochte selten für uns. Also musste ich mir selbst helfen und in der Küche nach etwas Essbarem stöbern. Tisch und Stühle halfen mir, in die höheren Gegenden zu gelangen. Am Abend vor dem Schlafengehen bekam Arabat immer noch Muttermilch. Arabat genoss diese Zweisamkeit am liebsten ungestört, weil die Mutter am Tag kaum Zeit für uns hatte. Ich gewährte ihm seine Zeit. Dieses Muttermilchritual gefiel mir nicht. Ich ertrug diese Nähe nicht.
Mutter Lilith zwang mich manchmal trotzdem an ihren widerlichen Busen, an dem so mancher nuckelte und der so voller verschiedener Gerüche war. Da half nur kräftiges Beissen, um dieser Nähe zu entkommen. Sie suchte sie immer wieder, doch ihre Zuckerstimme nützte nichts und auch nicht ihr süsses Geschwätz: «Meine Prinzessin, mein Schätzeli und Zuckerpüppchen!»
Arabat schlief oft an ihrem Busen ein. Mich brachte Lilith wortlos zu Bett, was wohl als Strafe gedacht war, weil ich ihren Busen ablehnte. Wir standen oft wieder auf, um hungrig in der Küche etwas Essbares zu suchen. Egal ob es ein Glas Gomfi war oder einfach ein wenig Brot, wir assen alles, was unsere Augen sehen und unsere Hände greifen konnten.
Lilith war nachts auf der Jagd nach Männern, und wir waren allein. Wenn gerade ein Zuhälter bei uns wohnte, waren wir bei dem. Die Zuhälter hatten nicht viel übrig für uns Kinder. Sie sassen am liebsten vor einem Harass Bier und Frauen, die wir nicht kannten. Wir mussten nur leise genug sein, dann konnten wir machen, was wir wollten. Wenn kein Zuhälter da war und wir ganz allein waren, ging es laut zu und her. Die Küche wurde zum Bergsteigerparadies. Arabat und ich rückten den Küchentisch vor den grossen Schrank, wo Mutter Lilith meistens ein Kilo Zucker, Schokolade, Brot und verschiedene Gomfis aufbewahrte. Dazu eine Unmenge Raucherwaren und Flaschen mit stark riechendem Wasser, manchmal war es sogar farbig. Wenn wir es probierten, brannte uns der Mund, und wir mussten heftig husten. Und wenn wir zu viel von diesem Zeug getrunken hatten, mussten wir kötzeln. Um an die Flaschen heranzukommen, stellten Arabat und ich einen Stuhl auf den Tisch und auf diesen Stuhl nochmals einen Stuhl. Diese Sache mit dem Tisch und den Stühlen war unser Abenteuer. Wir waren auf Bergtour. Weil Arabat Angst hatte, den Berg zu besteigen, stürmte ich den Gipfel und fiel manchmal auch herunter, wenn er zu beben anfing. Mit der Zeit aber wusste ich genau, wie ich mich hinaufbewegen musste.
Die Nächte, in denen unsere Mutter auf der Jagd war, dauerten lange. Wir hatten viele Ideen, seilten die Flaschen an Schnüren herunter und wieder hoch auf den Gipfel – das war die Kunst des Gleichgewichts. So manche Flasche ging in die Brüche. Solange wir aber alles auf- und wegräumten, würde uns nichts geschehen. Das wussten wir. Oft war ich ganz klebrig von der Gomfi und dem Zucker, sogar meine Haare klebten. Mit der Zeit breitete sich auf meinem Kopf so etwas wie ein Filzteppich aus, denn Waschen war für uns nicht alltäglich, das machte man nur ab und zu. Da wir uns selbst überlassen waren, kam es auch gar nicht darauf an, was für Kleider wir trugen. Alles roch süss und manchmal auch leicht nach Urin. Durfte ich einmal in warmem Wasser baden, fand ich das schön, aber ich vermisste danach den Geruch nach Süssem und Urin. Diese Gerüche verliehen mir ein Wohlgefühl, und ich fühlte mich sicher in meiner Welt.
Wenn wir unsere Bäuche gefüllt hatten, gingen wir schlafen, und ich wickelte mich in das klebrige, süss riechende Leintuch. Arabat wimmerte oft vor sich hin und lullte mich damit langsam in den Schlaf. Arabat war traurig, aber mir gab er mit seinem Wimmern das Gefühl, nicht allein zu sein. Arabat war der einsamste Junge, den es auf der Welt gab. Arabat und ich standen am Morgen immer allein auf, denn Mutter Lilith schlief meist noch und war manchmal gar nicht zu Hause. Dann fing die Suche nach Essen wieder von vorne an. Am Abend gingen wir mit den Kleidern ins Bett und standen am anderen Tag fertig angezogen wieder auf. Wir wechselten die Kleider erst, wenn Mutter Lilith endlich Zeit und Lust dazu hatte, uns frisch einzukleiden. Aber diesen frischen Geruch mochte ich nicht.
Wenn am Morgen niemand zu Hause war, machten Arabat und ich uns auf den Weg in die grosse weite Welt hinaus, obwohl Mutter Lilith und Vater Jakob uns dies verboten hatten. Die Menschen, denen wir draussen begegneten, verstanden wir nicht. Und diese Menschen verstanden auch uns nicht. Die grosse Welt war uns fremd. Aber für mich war sie voller Reize. Ich war sehr neugierig und kannte keine Grenzen. Alles, was ich sehen, riechen und anfassen konnte, war für mich wie ein grosses Abenteuer. Bei diesen Ausflügen in die Welt hinaus konnte ich mein kleines Herz klopfen hören. Das gefiel mir sehr, und ich fühlte mich lebendig. Ich hatte keine Angst. Ich war dort draussen ganz zu Hause.
Oft kam es vor, dass ich aus Gärten Blumen holte. Die Menschen, die mich dabei erwischten, waren lieb und lächelten mich an, auch wenn ich mit ihnen redete und wir uns nicht verstanden. Da ich ein kleines Mädchen war und sehr anders war als andere kleine Mädchen, hatte man nur Mitleid mit mir. Ich wurde sogar mit Essen belohnt. Es war viel besser als das, was ich zu Hause bekam. Ich genoss das Mitleid sehr. Es gab mir das Gefühl, alles nehmen zu dürfen und überall eintreten zu können.
Mutter Lilith freute sich über die Blumen, die ich ihr von den verbotenen Ausflügen mitbrachte, ermahnte mich aber, zu Hause zu bleiben. Meine zerzausten Blumen standen dann im Wohnzimmer, und ich dachte, wie schön der Raum doch war und wie gut es roch. Weil die Blumen, die ich pflückte, im blauen Dunst einen guten Duft verbreiteten, gewöhnte ich mir an, nur solche Blumen zu pflücken, die besonders intensiv dufteten. Mutter Lilith wurde von den Leuten im Dorf oft aufgefordert, mir zu sagen, ich solle das Stehlen, wie sie es nannten, doch unterlassen. Meiner Mutter war das aber einerlei, denn ich wusste mich ja selbständig zu bewegen. So hatte sie ihre Ruhe und musste mich und meinen Bruder nicht beschäftigen.
Einmal aber ging ich viel zu weit. Das brachte Mutter Lilith wieder das Sozialamt ins Haus, wovor sie grosse Panik hatte. Auf Entdeckungsreise im Dorf kamen wir wie so oft an einem Haus vorbei, das einen grossen Reiz auf mich ausübte. Ich wollte dort unbedingt die Umgebung erforschen, und da die Besitzerin immer sehr lieb war, dachte ich nicht an etwas Unrechtes. Es gab dort eine Scheune, an der ein Strauch mit lauter stark duftenden Blüten emporwuchs, und viele fleissige, summende, fliegende Tierchen kamen und gingen, woher und wohin wusste niemand. Mit meinen klebrigen Händen fing ich an zu buddeln, und Arabat half kräftig mit. Die Finger taten mir bald weh und verkrampften sich. Es stellte sich als zu schwierig heraus, den Strauch auszugraben. Er hatte so viele Wurzeln, die sich nicht aus der Erde lösen wollten. Der Strauch konnte nicht loslassen, und das ärgerte mich so, dass ich böse wurde und anfing, seine Blüten abzurupfen. Wütend zerstörte ich seine Wurzeln. Ich stopfte so viele abgerupfte Blüten in meine Kleider, wie ich nur konnte, und auch in die meines Bruders – egal, ob sie wieder herausfielen. Wir stopften uns richtig aus damit. Bald sah der Strauch erbärmlich aus, und mir kam es vor, als würde er weinen, ja sogar schreien, und da überkam mich ein ungutes Gefühl. So schnell und zielgerade waren Arabat und ich noch nie nach Hause gerannt, mit der Angst im Nacken, es könnte uns jemand folgen. Zu Hause angekommen, war ich gar nicht mehr so ausgestopft, und auch Arabat nicht. Es waren nur noch wenige Blüten da, die aber noch immer ihren intensiven Duft verströmten, und wir rochen beide so herrlich!
Mutter Lilith, im Morgenrock, war diesmal gar nicht begeistert. Sie murmelte vor sich hin und nahm einen Schluck aus einer Flasche. Sie schloss uns im Zimmer ein, und da sollten wir bleiben. Vater Jakob war wieder einmal zu Hause, und ihm gefiel das nicht. Die beiden stritten sich laut, als wäre ein Gewitter ausgebrochen. Ich hörte, wie Tisch und Stühle krachten, verzweifelte Schreie – nichts, was mich ängstigte. Wenn die beiden zusammen waren, war das ihr Umgang miteinander. Arabat aber kroch dann immer unter die Decke, wo er für eine Weile blieb, so lange, bis Vater Jakob ins Zimmer trat und uns einen Würfelzucker gab. Ich wusste nicht, warum wir den bekamen, aber er schmeckte und machte uns zufrieden.
Kurz darauf klingelte es an der Tür. Es klingelte öfter bei uns, doch diesmal stand kein Mann vor der Tür, sondern eine Frau, die mit Lilith reden wollte. Vater Jakob hörte, wie Mutter Lilith wetterte. Sie fluchte vor sich hin, liess die Frau kaum zu Wort kommen und bedrohte sie mit einem Stuhl, sodass Vater Jakob eingreifen musste. So hatte ich meine Mutter noch nie gesehen. Wie sie mit fremden Menschen umging, machte mir Angst. Trotzdem beobachtete ich alles ganz genau von der Schlafzimmertür aus, sodass ich, falls es schlimm würde für mich, schnell die Tür schliessen konnte. Die Frau zeigte immer wieder auf mich, wedelte mit Blüten vor sich herum, als wollte sie ihren guten Duft im Raum versprühen. Mutter Lilith drückte sie zur Tür hinaus und Vater Jakob versuchte, Lilith zu besänftigen, was ihm nicht gelang. Es gab lautes Geschrei, bis die Tür zuknallte. Ich schämte mich, denn ich war schuld. Der Strauch hatte mich verraten. Ich, Luisa, war schuldig, weil ich ihm wehgetan hatte. Lilith und Jakob stritten heftig weiter, und Lilith warf Dinge nach ihm – er duckte sich ständig –, bis das Zimmer nicht wiederzuerkennen war für meine Kinderaugen.
Ich schloss die Tür hinter mir zu. Ich war ganz still, denn ich wusste, jetzt musste man die beiden in Ruhe lassen. Ich musste still sein, nicht da sein, mich gab es nicht. Ich musste abwarten, wie immer, wenn sich Vater und Mutter stritten. Ich musste sie ihre farbigen Getränke trinken lassen, und wenn ich ganz still in der Stille verharrte, konnte ich die komischen Geräusche der beiden hören, und ich wusste, bald darauf würde Vater Jakob uns wieder verlassen. Es war immer so, und es machte mir nichts aus. Wenn Vater Jakob gegangen war, kam meistens ein anderer, der brachte uns keinen Würfelzucker. Aber meine Mutter bekam jedes Mal etwas in die Hand, und ich musste an Würfelzucker denken.
Wieder einmal hatte Mutter Lilith bei uns zu Hause ein kleines Männerfest. Wir durften nicht aus unserem Zimmer, obwohl wir nicht schlafen konnten. Ich hatte aber keine Lust mehr, schlaflos im Zimmer zu liegen und diesem Treiben zuzuhören. Es war fürchterlich laut, und der Gesang der Herren machte mir in der Dunkelheit Angst. Ich wollte bei meiner Mutter sein. Ich ging aus dem Zimmer, ohne zu wissen, was mich draussen erwartete. Ich hätte es bleiben lassen sollen.
Bis dahin war das Kinderzimmer für mich ein schützender Ort gewesen, dort konnte mir nichts geschehen. Es war unsere Welt, meine und die meines Bruders. Für mich war unser Zimmer harmonisch und lieb, voller Kinderträume, Farben und Fantasie, auch wenn es unordentlich war. Mein Bruder und ich waren eins in dieser Welt, die nur uns gehörte. Mit dem Öffnen der Tür hatte ich das Tor zur Hölle geöffnet, und es gab kein Zurück mehr. Der scharfe Geruch, die Erregtheit der Stimmen, das völlig Verruchte – das alles drang nun in unser Zimmer, das bis dahin mein Schutzraum gewesen war.
Die Männer sassen auf jeder brauchbaren Fläche, einige standen, die meisten hielten eine Flasche in der Hand und andere nuckelten an braunen, dicken, stinkenden Stumpen, die wie Holz aussahen. Einige hatten dicke Bäuche, andere waren dünn, und bei jedem hing zwischen den Beinen etwas herunter. Bei zweien oder dreien hing es nicht, sondern stand hervor. Es sah aus wie Würste. Manche hatten ihre Würste in den Händen und bearbeiteten sie, alleine oder gegenseitig. Einer beugte sich mit dem Bauch über den Tisch, hielt sich verkrampft mit beiden Händen am Tischrand fest, und ein zweiter hinter ihm war in einer Bewegung, die ich noch nie gesehen hatte. Die Geräusche unter dem Gesang und der Musik waren erschreckend. Meine Mutter sass auf dem Sofa, den Rücken zu mir gewandt. Sie hatte vier Beine, und ihre Arme waren verdreht. Ihr langes, blondes, gelocktes Haar war das einzig Liebliche und Vertraute an ihr. Ich wusste nicht, wo ich war, und dachte, ich hätte mich einfach verirrt. Ich stand da und konnte mich nicht bewegen, ich schaute und schaute und fand doch nichts mir Bekanntes. Ich spürte, wie alles an meinem kleinen Körper hart wurde, ich wurde plötzlich so schwer und konnte kaum mehr atmen. Ich sah Farben an diesen Menschen, die ich noch an keinem gesehen hatte. Ich atmete Gerüche ein, die mein kleines Hirn nicht zuordnen konnte. Ich spürte, wie kleine, eiskalte Tropfen meinen Körper bedeckten und mich zum Frieren brachten. Ich zitterte, und es hörte nicht mehr auf. Ich stand da und konnte nicht zurück ins Bett, meine kleinen Füsse waren wie festgenagelt. Ich war gefesselt, wollte rennen, wollte in mein Zimmer, doch es ging einfach nicht.
Ich weiss nicht, wie lange ich da stand, bis mich einer dieser wurstgreifenden Männer bemerkte und auf mich zukam. Er brummte etwas vor sich hin, und ich starrte einfach in die Menge, ohne etwas zu sehen, als schweiften meine Gedanken weit, weit weg und verliessen mich. Die Männer gingen vom Tisch weg, und ich stand plötzlich darauf wie ein Brett. Für sie war ich wie ein zartes Erdbeerchen, so jung, so frisch, sodass sie mich verzehren wollten. Ich aber wollte ein Radieschen sein, möglichst scharf bei jedem Biss. Die Männer standen rund um den Tisch, klatschten in die Hände, jaulten und grunzten und hatten den Blick dabei immer auf mich gerichtet. Je mehr sie mich mit ihren gierigen Blicken verschlangen, desto leiser wurden die Stimmen und desto mehr verdufteten die Gerüche. Als Mutter Lilith mich lächelnd ansah, spürte ich meinen Körper plötzlich nicht mehr. Ich war aufgelöst, gespalten, meine Augen waren an der Decke und konnten von dort alles mit ansehen. Ich sah meinen kleinen Körper auf dem Tisch, erstarrt. Ich sah, wie Hände diesen kleinen Körper berührten – zu viele Hände. Ich spürte nichts, ich konnte sehen, aber nicht fühlen, auch nicht, als meine Mutter mir die Kleider auszog und mich berührte. Ich wachte klatschnass in meinem Bett auf, und die Angst hielt mich fest in ihrem Griff.
Mit dem Öffnen dieser Tür zur Hölle war mein Kindsein vorbei. Von dieser Nacht an konnte Mutter Lilith mehr Geld verdienen, und mein Körper musste ihr und ihrer Männerwelt dienen. Sie nahm sich jetzt viel mehr Zeit für mich, auch wenn sie müde war von der Nacht. Mutter Lilith wollte, dass ich mit ihr tanze, und dafür stellte sie mich auf den Tisch. Das Tanzen gefiel mir aber nicht, trotz der Musik. Schon wenn sie mich auf den Tisch heben wollte, schrie ich laut in den Raum. Sie konnte mich nicht zum Tanzen bringen, auch nicht, wenn sie Arabat mit auf den Tisch stellte. Kaum war ich hinuntergeklettert, stellte mich die Mutter wieder auf den Tisch. Dieser Kampf mit ihr und dem Tisch ermüdete mich sehr. Ich versuchte, dem Tisch, so gut es ging, fernzubleiben. Ich spielte auch keine Spiele mehr mit ihm. Es gab kein Bergsteigen mehr. Wenn wir einmal gemeinsam assen, setzte ich mich auf den Boden, denn der Tisch war zu meinem Feind geworden, und ich hatte Angst vor ihm.
Von dieser Nacht an hatte ich mit der Angst zu kämpfen, und meine Abenteuerlust war weg. Ich verhielt mich nun wie mein Bruder Arabat, blieb auch oft im Zimmer, in mich gekehrt und unauffällig. Nur manchmal besuchten mich die Lebensgeister doch wieder und ich stellte fest, dass ich noch voller Ideen war und mich wieder spürte. Ich war immer froh, wenn Mutter Lilith nicht da war. Das hiess für mich, dass ich nicht auf den Tisch musste. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte.
Arabat und ich gingen wieder auf Erkundungstour. Wir wohnten inzwischen schon längere Zeit dort, und jeder kannte uns, denn wir waren die Kinder der Vaganten, so nannte man uns. Man hielt im Dorf Sitzungen ab darüber, wie es weitergehen sollte mit uns Vagantenkindern, die inzwischen allen ein Dorn im Auge waren. Das Mitleid war verschwunden. Wir trübten das Dorfbild, man wollte uns nicht mehr. Man hatte einiges in Erfahrung gebracht über Mutter Lilith, und es wurde auch viel geredet. Man wusste, dass Mutter Lilith eine Fahrende war und dass man sie als Kind der Mutter weggenommen hatte. Die Leute machten sich keine Gedanken darüber, welcher Arbeit Lilith nachging. Vielmehr störte es sie, dass Lilith eine Fahrende war, und dafür schämte man sich in der Gemeinde. Alle Augen waren wie Feldstecher auf uns gerichtet, das heisst, auf Mutter Lilith. Die Stadt, aus der wir gekommen waren, forderte die Gemeinde auf, uns Kinder aus diesem Milieu zu holen. Man stritt sich aber noch darüber, wer bezahlen müsse.
Unsere Erkundungstour an einem schönen Tag war der Gemeinde dann aber doch zu viel. Es war heiss, und wir waren uns selbst überlassen. Arabat und ich wanderten zum Dorfbrunnen. Wir mussten dorthin ein schönes Stück Weg unter die Füsse nehmen und grosse Strassen überqueren. Der Weg führte an der Gemeindeverwaltung und am Polizeiposten vorbei. In diesem Dorf thronte die Kirche über dem Dorfbrunnen, und wenn man in die Kirche gelangen wollte, musste man viele Treppen steigen. Der Brunnen erschien unter diesem herrischen Gebäude gar winzig, doch für uns Kleine war er gefährlich.
Wir zogen uns aus und kletterten in den Brunnen, der randvoll mit Wasser gefüllt war und kräftig vor sich hin plätscherte. Das Wasser war kalt, und es ging eine Weile, bis sich unsere Körper dem kalten Nass angepasst hatten. Arabat und ich tobten uns aus, wir waren fröhlich und vergassen unseren Kummer. Es war so heiss, dass der Asphalt sofort wieder trocknete, wenn er mit Wasser in Berührung kam. Uns gefiel das so gut, dass wir kaum nachkamen damit, die Strasse zu benetzen.
Plötzlich standen zwei Uniformierte vor uns. Sie rochen gut und lächelten mich freundlich an. Ich stand immer noch im Brunnen, und beim Anblick ihres Lächelns, das ihre weissen Zähne zum Vorschein brachte, fing ich an zu frösteln. Ich sah das freundliche Lächeln nicht mehr, ich sah nur noch, dass ihre Hände mich packen und aus dem Brunnen heben wollten. Mir war, als stünde ich auf dem Tisch, und ich fing an zu schreien. Ich wollte nicht aus diesem Brunnen, ich wollte nicht angefasst werden. Da konnten sie noch so gut riechen und eine Uniform tragen, das nützte mir nichts. Ehe ich mich versah, fand ich mich schreiend in einem Auto wieder, und das ängstigte mich noch mehr, denn ich war noch nie in so einem Ding gefahren. Der Gestank des Autos kam mir verdächtig vor. Ich schrie vor lauter Verzweiflung, aber es half mir nicht weiter. Einer der Männer drückte mich auf seinen Schoss und hielt mich fest in seinen kräftigen Armen, die mir fast den Atem nahmen. Ich kam mir vor wie eine Zitrone, die ausgepresst wird, und konnte keinen Widerstand leisten. Ich schrie bis zur Erschöpfung, die mich lähmte und ruhig werden liess. Ich ergab mich diesen kräftigen Armen, liess sogar meinen Kopf auf seine Brust sinken und spürte dort ein schnelles Pochen, das mich ganz zur Ruhe brachte.
Arabat hingegen hatte Freude an seiner ersten Autofahrt, die uns nach Hause zu Mutter Lilith brachte. Als die Autotür geöffnet wurde, hielt der Uniformierte mich immer noch fest in den Armen. Ich war froh, von ihm getragen zu werden, denn ich spürte meine Beine nicht mehr und meine Füsse hätten mich nicht getragen, so erschöpft war ich. Der andere Mann führte Arabat an der Hand und klingelte an der Haustür. Mutter Lilith öffnete, und als sie uns mit den beiden Männern erblickte, begannen ihre Augen zu funkeln. Sie riss mich aus den Armen des Uniformierten und zog auch Arabat zu sich heran. Sie schrie, stampfte und schnaubte wie ein Wildschwein. Sie stellte uns so grob in die Wohnung, dass ich hinfiel und mir wehtat.
Die beiden Männer wollten sie besänftigen, ihre Stimmen klangen für mich wie ein Lied. Je sanfter dieses Lied für mich klang, desto mehr erzürnte es aber Mutter Lilith. Ihr Körper bebte, ebenso ihre Stimme, die sich überschlug. Sie kreischte, und ihre Hände fuchtelten durch die Luft. Ich stellte mir vor, wie sie gleich vom Boden abheben würde, und liess mich von diesem Gedanken treiben, bis die Tür knallte und mich in die Wirklichkeit zurückholte. Mutter Lilith stand da, den Rücken fest an die Tür gepresst. Sie bebte noch immer am ganzen Körper, dessen Hitze mir entgegenströmte. Plötzlich brach sie wie ein Sandberg in sich zusammen, schluchzte und kam mir nicht mehr so stark vor. Auch die Hitze war weg, und ich hätte Mutter Lilith mit dem kleinen Finger umstossen können. Ich stand da und sah sie an und verstand gar nichts von diesem Leben, auch wenn ich noch so viel darüber nachdachte.
Als sich Mutter Lilith von dem Schrecken erholt hatte und uns wieder anlächeln konnte, stellte sie das Radio ein. Musik ertönte, und sie sang mit. Immer wenn sie mitsang, hiess das für mich, dass ich bald auf dem Küchentisch tanzen musste. Ich fügte mich und stieg auf den Tisch, zur Freude meiner Mutter, die ganz entzückt war von meinem kindlichen Tanz.
*
Nach dem Besuch der Uniformierten zogen wir noch am gleichen Tag weg in einen anderen Kanton. Wir durften nichts mitnehmen, liessen alles stehen und liegen – nicht einmal unsere Spielsachen packte Mutter Lilith ein. Wieder brachen wir in ein frei stehendes Haus ein, abseits vom Dorf, wo wir keinen Kontakt mit der Bevölkerung hatten. Auch keinen Strom, das Kerzenlicht musste genügen. Und alle Wasserhähne waren versiegelt. Wasser holten wir mit dem Eimer aus dem Fluss.
Dank einem der vielen Männer, die Mutter Lilith kannte, zogen wir von dort bald weiter an einen Ort, wo wir wieder Licht und Wasser hatten. Wichtig war, dass wir eine Bleibe weit weg von den anderen Bewohnern hatten. So konnte meine Mutter den Männern ihre Dienste anbieten, ohne die Harmonie der Gemeinde zu stören. Sobald wir jeweils einen Ort fanden, wo wir bleiben durften, lud meine Mutter all ihre Herren und auch neue zu einem ausschweifenden Abend ein. Ich wurde dann am Nachmittag davor gewaschen, und meine Haare wurden zurechtgemacht, sodass sie leicht und luftig waren und gut rochen. Mir war immer angst und bange, und mein kleines Herz wurde schwer, es fühlte sich an, als rutschte es in mir hinunter. Dann konnte ich nicht Pipi machen vor Angst, mein kleines Herz könnte mit hinauswollen.
Am Anfang stand ich in einem schönen, geblümten, orangefarbenen Kleidchen da, auf das ich stolz war, in weissen Kniesöckchen und hellblauen Lackschuhen. Mein rotblondes Haar war zu zwei kleinen, lockigen Schwänzchen hochgebunden, manchmal auch nur zu einem. Für solche Abende hatte ich auch ein besonderes Höschen, das mir sehr gut gefiel, denn hinten hatte es rosa Rüschen. Was ich anhatte, zogen andere Mädchen an Festtagen und für die Kirche an, um niedlich auszusehen. Warum durfte ich nicht auch am Tag niedliche Kleider tragen, warum nur in der Nacht und für Mutter Lilith und ihre Welt? Ihre Welt war doch nicht meine!
Auf dem Tisch tanzend in der Tiefe der Nacht, bei lautem Männergesang und schlechtem Geruch, holte ich die Dämonen herbei, damit diese Teufelin sie voll und ganz befriedigen konnte. Meine Mutter zog mich Stück für Stück aus und trieb es vor meinen Augen. Wenn sie und der Mann sich der Lüsternheit hingaben, richteten beide ihre Augen auf meinen kleinen Körper, sie lächelnd und der Mann voller Lust, wie ein Stier stossend und mit tiefem Geröhre!
Das reizvolle Höschen mit den Rüschen durfte ich je nach Kundschaft länger oder weniger lang tragen, bis es mir ebenfalls ausgezogen wurde. Dann legte mich meine Mutter auf den Tisch und eine Kälte überkam mich und meine Kinderseele verliess diesen kalten Körper und meine Augen sahen von der Decke herab dem Treiben dort unten zu, denn die Dämonen hatten nun freie Bahn, sie durften sich an dem Frischfleisch vergehen, jeder auf seine Weise. Meine Mutter schaute dem Treiben in ihrer rot-schwarzen Reizwäsche zu.
Wenn meine Seele zu langsam war, um sich von mir zu entfernen, und meine Augen bei mir blieben und nicht zur Decke hochgingen, dann taten die Männerpranken meinem Körper weh. Die Gummis, die mein Haar zusammenhalten sollten, wurden mir vom Kopf gerissen. Das sanfte Streicheln wurde grob, aus den Berührungen wurden Schläge. Meine Händchen wurden zu Fliessbandarbeiterinnen an ihren prallen Würsten, und die Flüssigkeit, die sich über mich ergoss, rieben sie in meinen Körper ein und leckten ihn dann ab. Ich wurde zum Leckerbissen. Wenn ich meine Beinchen nicht spreizen wollte, tat es Mutter Lilith für mich, und wenn ich zu schreien anfing, gab sie mir einen Klaps. Eine blaue Büchse mit fettiger Creme lag immer griffbereit. Es schmerzte dann weniger beim Einführen der Finger. Meistens war der erste Finger, der in mich eindrang, der meiner Mutter, dann kamen andere nach. Sie bedienten sich an allen drei Öffnungen meines Körpers, die beliebteste war die kleine Scheide, dann der Mund und der After. Der war nicht so beliebt, weil ich schnell blutete. Meine Seele und meine Augen lernten mit der Zeit, vor den Fingertaten das Weite zu suchen, und so fühlte ich keinen Schmerz. Von den Kunden durfte keiner seine Wurst in den After oder die Scheide stecken, dafür war Mutter Lilith zuständig. Mein kleiner Mund musste den Männern genügen.
Manchmal, wenn die Dämonen Durst hatten oder rauchen mussten, hatten mein Körper und ich eine Pause. Dann kamen meine Seele und meine Augen zurück. Ich lag da, in Schmerzen gebadet, während die Mutter mit den anderen rauchte und trank. Kälte und Hitze plagten meinen Körper abwechselnd weiter, am schlimmsten waren die Krämpfe in Bauch, After und Scheide, als würde ein Messer mich zerschneiden. Das heftige Pochen meines kleinen, gebrochenen Herzens erinnerte mich daran, dass ich noch lebte. Und manchmal gelang es mir, wenn ich noch die Kraft dazu hatte und wieder auf den Füssen stehen konnte, die Dämonen und ihre Hölle unbemerkt zu verlassen. Wenn ich die Kraft dazu nicht mehr hatte, wurde mein Kinderkörper weiter geschunden, über Stunden, die nicht vergehen wollten. Wenn ich das Zwitschern der Vögel hören konnte oder ein kleines Licht der Dämmerung erkannte, dann wusste ich, dass es bald vorbei sein würde.
Nach solchen Höllennächten schlief ich oft auf dem Tisch ein. Meine Mutter fand es nicht nötig, mich ins weiche Bett zu legen, sie deckte mich nur zu und überliess mich dem Morgen und seinen Armen. Sie aber legte sich mit einem der Gäste oder der Zuhälter ins weiche Bett und stand nur noch auf, um die Tür für einen Freier zu öffnen und sich dann gleich wieder hinzulegen. So missbraucht und geschunden, wie ich einschlief, wachte ich auch auf und konnte diesen Dreck nicht abwaschen. Arabat holte mich meistens in den Tag. Und wenn ich mein Herz dann immer noch rennen hörte, wusste ich, dass ich noch lebte, dass ich noch riechen und hören konnte, dass Arabat mein Bruder war, dass ich einen Vater hatte, eine Mutter, dass es Tisch und Stuhl gab. Und dass es da sogar eine schwarze Katze gab.
Plötzlich war sie einfach da gewesen, wie aus dem Nichts aufgetaucht. Am selben Tag, an dem meine Mutter mir sagte, dass ich ein Geschwisterchen bekommen würde. So, wie ich die Schwester meines Bruders sei, komme noch jemand dazu, der viel kleiner sei als ich und viel schlafen würde. Mir schien, dass die Katze zu viel war, denn die ass ja auch. Sie bekam von der Mutter jeden Abend etwas zu essen, und wir hatten manchmal nichts. Sie durfte sogar auf dem Bett der Mutter schlafen und manchmal auf ihrem Schoss sitzen. Diese Katze konnte nicht bei uns bleiben, diese Katze musste weg.
Eine Zeit lang geschah nicht viel, ausser dass ich auf dem Tisch tanzen musste. Der Tisch hatte sich fest in meine Kinderwelt geschoben, die Hölle hatte mich immer wieder und machte, dass ich fast keinen Hunger mehr hatte. Ich verwandelte mich in ein kleines Höllengerippe. Das Bäuchlein meiner Mutter wuchs. Und die schwarze Katze strich dauernd um mich herum und berührte meine Beine. Manchmal schnurrte sie dabei.
Vater Jakob tauchte auf und verschwand im Zimmer meiner Mutter. Es dauerte nicht lange, bis wir Schreie hören konnten, es rumpelte und Türen knallten. Arabat verschwand unter seiner Decke. Vater Jakob war dieses Mal genauso wütend wie Mutter Lilith. Die beiden schaukelten sich gegenseitig auf in ihrem Zorn. Wieder flogen uns Gegenstände um die Köpfe. Und dieses Mal würde der Vulkan ausbrechen. Meine Mutter öffnete plötzlich das Fenster, rannte Jakob schnaubend entgegen, packte ihn, hob ihn in die Luft, rannte mit ihm auf das Fenster zu und warf ihn mit voller Kraft hinaus. Für einen kurzen Augenblick herrschte Ruhe, gerade so lange, dass ich einmal ein- und ausatmen konnte. Mein Mund stand offen, ich staunte darüber, dass mein Vater fliegen konnte. Meine Mutter befahl mir, nach ihm zu schauen, und ich lief, so schnell ich konnte, zu ihm hinaus. Vater Jakob lag reglos da, ich kniete mich zu ihm hin und sah ihn einfach an. Sein Bauch und sein Gesicht waren zum Boden gerichtet und sein Rücken und Hinterteil Richtung Himmel. Wohin seine Beine und Arme zeigten, fand ich nicht recht heraus. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, nur seine Ohren, und da tropfte Blut heraus. Ich sah einen Fremden vor mir liegen. Meine Mutter rief etwas von oben herab, was ich nicht verstand. Dann kam ein Auto mit Blaulicht, ohne Sirene, mit Frauen oder Männern, die sich um Jakob kümmerten, ihn auf einer Bahre ins Auto schoben. Vater Jakob war nun für sehr lange Zeit weg. Der Sturz aus dem Fenster hatte ihm beide Arme und Beine gebrochen.
Nun wusste ich, wie ich es anstellen konnte, dass die schwarze Katze unser Haus verliess. Ich musste ihr nur das Fliegen beibringen. Ich öffnete das Fenster, schaute hinunter, ob Arabat seinen Posten bezogen hatte, nahm die Katze und warf sie hinaus. Unten knallte sie auf den harten Boden und war ganz benommen. Arabat brachte sie mir dann wieder hinauf und ich knallte sie nochmals aus dem Fenster. Das Spiel mit der Katze ging so lange, bis der Tod sie endlich packte.
Da lag sie nun mit offenen Augen, und ihr Zünglein hing heraus. Plötzlich wollte ich, dass die Katze wieder lebendig wäre. Ich warf Steine nach ihr. Doch sie blieb einfach reglos liegen. Ich trat die Katze mit den Füssen, versuchte sie auf die Pfoten zu stellen. Aber sie fiel in sich zusammen, ihr Zünglein draussen und mit halb geöffneten Augen. Ich gab meine Versuche auf, sie wieder lebendig zu machen, und legte sie an die Hausmauer. Keiner, der zur Mutter kam, bemerkte die tote Katze. Und da Mutter Lilith nicht nach draussen ging, lag die Katze noch eine ganze Weile da, sodass ich sie immer wieder besuchen konnte. Ich machte noch einen letzten Versuch und legte ihr Futter hin, ich dachte, wenn sie Hunger hätte, würde sie gewiss aufwachen. Manchmal war das Futter dann weg, aber die Katze lag immer noch da, und auf ihr immer mehr Tierchen. Ich nahm an, dass die Katze aufwachte und frass, weil das Futter ja weg war, wenn ich nachschaute. Also brachte ich immer wieder neues hin und immer mehr kleine Lebewesen gesellten sich zur Katze. Ich konnte beobachten, wie die kleinen, weissen Würmchen auf ihr herumturnten, sich aus ihren Augen und in ihren Mund bohrten, sogar in den kleinen Nasenlöchern gingen sie ein und aus. Mit der Zeit stank es sehr. Die weissen Würmchen begannen mich zu ekeln, und dieses Todesfressen faszinierte mich nicht mehr. Mutter Lilith trauerte der schwarzen Katze noch lange nach und hoffte, sie komme wieder. Aber ich wusste es besser, ich hatte ein Geheimnis, das Geheimnis vom Tod.
Wieder zogen wir um, weil man uns unserer Mutter wegnehmen wollte. Wir wohnten nun in einem alten Käserhaus. Die neue Käserei war nicht allzu weit davon entfernt. Jeden Morgen und jeden Abend konnte ich die Bauern mit ihren Traktoren und Anhängern mit den grossen Milchkannen beobachten. Sie brachten die Milch ihrer Kühe dorthin. Die Bauern und der Käser hatten dicke Oberarme, denn eine solche Kanne war sehr schwer. Wir hatten nun regelmässig Milch zu trinken. Wir tranken viel, hatten aber trotzdem Hunger. Mutter Lilith kam mit dem Geld nicht aus, weil sie eine Menge Trink- und Rauchwaren, Schminke und Schuhe für sich brauchte. Oft hatten wir zu wenig Milchbatzen.
Aber Mutter Lilith war schlau und weihte uns in die Kunst der Elstern ein. Arabat und ich mussten in der Käserei sein, bevor die ersten Bauern ihre Milch brachten. Die Käserfrau hatte dann schon alles vorbereitet, auch die Kasse mit den Milchbatzen lag immer offen da. Meistens waren der Käser und die Käserin noch beschäftigt, bevor das Eintreiben der Milch begann, und so waren wir allein in der Käserei. Arabat hielt das Milchchübeli in der Hand und ich hatte meine Hand in der Kasse, um mir ein paar Batzen zu greifen. Hatte ich die Batzen, so standen wir wartend da, bis die Milchbauern kamen und es kesselte und laut wurde. Wenn dann die Käserin kam, streckte ich ihr die Hand mit den Batzen hin, die ich mir vorher genommen hatte, und wir bekamen so viel Milch, wie es dafür gab. Manchmal hatten wir ein ganzes Chübeli voll, meistens jedoch nur ein halbes. Meine Hand war zu klein und zu zart, um genügend Batzen für ein volles Milchchübeli zu greifen. Mutter Lilith war stolz auf mich, weil ich das mit dem Milchholen so gut machte. Sie konnte sich auf mich verlassen und es ganz uns beiden überlassen. Und für mich war klar, dass ich das Geld nehmen durfte, weil es ja so offen dalag.
Nach einer Weile zogen wir wieder um, damit meine Mutter in Ruhe gebären konnte. Es war keine Geburt im Spital, die kleine Mascha kam zu Hause in unsere Welt. Ich durfte mit Vater Jakob die Nachgeburt im Wald vergraben. Wir gruben mit den Händen ein tiefes Loch in die Erde, Vater Jakob legte die Nachgeburt hinein und übergoss sie mit einer ganzen Flasche von dem stark riechenden Wasser. Vorher nahm er noch einen grossen Schluck davon. Unsere Hände deckten die Nachgeburt, gesegnet mit diesem Feuerwasser, mit Erde zu. Ich durfte Holz sammeln und es, dort wo die Nachgeburt im Dunkeln lag, auf einen Haufen legen. Als wir genug Holz hatten, kam Mutter Lilith mit Arabat und der kleinen Mascha dazu. Mascha sah man nicht, sie war in eine Decke eingewickelt. Papier wurde zwischen die Hölzer gestopft und noch eine Flasche Feuerwasser geopfert, dann kamen die rot-, gelb- und blauorangen Flammen. Es zischte, krachte und rauchte.
Mir war, als wollten die Flammen mir etwas sagen, doch ich konnte es nicht verstehen, wie so vieles. Ich starrte in die Flammen und spitzte die Ohren. Ich sah das Feuer und seine Farben. Und manche Farben, die ich darin sah, konnte ich auch an den Menschen, Pflanzen und Tieren erkennen. Das Feuer weckte in mir das Bedürfnis, es zu berühren. Das helle Licht der Flammen berührte sanft meine Seele und liess mich am Zauber seiner Wärme teilnehmen. Ich wurde selbst zu einer Flamme und tanzte, knisterte, krachte und rauchte mit dem Feuer. Zum ersten Mal erlebte ich Glück. Und dieses Glück gefiel mir viel, viel besser als das Tanzen auf dem Tisch. Das Glück fühlte sich so warm an. Das Tanzen aber war eisige Kälte. Bald darauf rief die Teufelin aber wieder ihre Dämonen aus der Hölle. Das Opfer lag schon auf dem Tisch bereit. Mascha durfte nicht auch ein Höllenopfer werden.
Die Tage gingen dahin und nichts veränderte sich bei uns zu Hause. Tagein, tagaus dasselbe. Ich hatte bloss ein Kind mehr, um das ich mich sorgte und kümmerte, damit niemand es anfassen möge. Die Männer kamen und nahmen mich und meine Mutter. Mutter Lilith wurde wieder schwanger, und bald war auch Bruder Alioscha unter uns. Mutter Lilith zog mit uns weiter, diesmal aber direkt in die Arme der Behörden. Vater Jakob hatte dafür gesorgt, dass wir endlich von ihr weggeholt wurden. Er konnte es nicht mehr mit ansehen, wie wir leben mussten. Helfen konnte er uns nicht, denn er konnte sich selbst nicht helfen. Weil es bei der Gemeinde ein Hin und Her gegeben hatte und keiner die Verantwortung dafür übernehmen wollte, wer was und wie viel bezahlen müsse, ging Vater Jakob schliesslich zu Leuten, die schon bei Lilith und ihrer Mutter im Spiel gewesen waren. Jakob wurde von ihnen mit offenen Armen empfangen, und dann ging es blitzschnell. Wir Kinder kümmerten sie nicht allzu sehr, sie fragten kaum nach, warum und wieso. Es genügte ihnen, zu wissen, dass meine Mutter eine Fahrende, eine Vagantin war. Und weil mein Vater kein Fahrender war, durfte er wünschen, wo er uns haben wollte. Er wollte uns in seiner Nähe haben.
10. Juni 1963,
Akte einer Schweizer Stadt
Mit Entscheid vom 14. August 1962 hat die Vormundschaftsbehörde der Stadt über Arabat und Luisa eine Erziehungskontrolle angeordnet und gleichzeitig die Wegnahme der beiden Kinder aus dem elterlichen Haushalt beschlossen.
Vater Jakob ist am 25. August 1962 von der Stadt fortgezogen. Die zuvor längere Zeit von ihm getrennt lebende Ehefrau Lilith hat die Stadt ebenfalls verlassen. Sie ist nun zu ihrem Jakob zurückgekehrt und auch die Kinder Arabat und Luisa haben wieder Aufnahme in der Familiengemeinschaft gefunden. Daraus ergibt sich, dass die Vormundschaftsbehörde der Stadt zur Führung der Erziehungskontrolle nicht mehr zuständig ist und die Massnahme nach Art. 284 ZGB nicht mehr vollziehen kann. Auf Grund dieser Situation ersuchte die Vormundschaftsdirektion der Stadt am 3. April 1963 die nun zuständige Vormundschaftsbehörde des neuen Kantons die Erziehungskontrolle zu übernehmen und die rechtskräftig beschlossene Wegnahme der Kinder durchzuführen. Eine Antwort auf dieses Gesuch ist bis jetzt nicht eingegangen.
21. Oktober 1965,
Protokoll der neuen Wohngemeinde
(...) Die mit Schlussnahme vom 13. Juni 1963 vormundschaftlich eingesetzte Erziehungs-Kontrollperson Herr Pfarrer Reinhard erstattet Schlussbericht in der Angelegenheit der Familie Jakob, Lilith, deren Kinder Arabat und Luisa.
Dem Bericht ist zu entnehmen dass beide Elternteile ihrer Erziehungsaufgabe nicht gewachsen seien und dass eine Gefährdung der Kinder durch das charakterliche Benehmen der Eltern (Nikotin, Alkohol, Herumziehen etc.) bestehe. Herr Pfr. Reinhard kommt in seinem Bericht zum Schluss, dass eine Überwachung und Betreuung der Erziehung der Kinder auch in Zukunft nötig ist.
Auszug von Pfr. Reinhard
Ich habe die Familie einige Male besucht. Zuerst hatte ich den Eindruck, dass die Kinder sehr vernachlässigt waren. Ich habe der Mutter zugesprochen, sich hier ein wenig aufzuraffen. Leider war die oft nicht daheim. Dafür traf ich einen Mann, der im Hause war. Es schien mir, dass durch die Erziehungskontrolle die Eltern doch wenigstens besorgt waren im Haus bessere Ordnung zu halten und die Kinder ein wenig mehr zu pflegen.
Ich musste die Feststellung machen, dass die Eltern (zum Teil mit den Kindern) viel unterwegs waren.
Um eine Unterstützung wurde ich nur einmal in der ersten Zeit ihrer Niederlassung gebeten.
Einer Überwachung und Betreuung werden die Kinder auch in Zukunft bedürfen. Die beiden Eltern sind ihrer Erziehungsaufgabe nicht gewachsen, vor allem wird das charakterliche Benehmen der Mutter und der Männer die ein und ausgehen (Nikotin, Alkohol, viel auswärts sein, keine religiöse Bedürfnisse) die Kinder sehr gefährden. (...)
8. November 1965,
Protokoll der neuen Wohngemeinde
Als Erziehungskontrollperson wird ernannt Frau Alice am Hübeliweg mit dem Auftrag, periodische Kontrollen durchzuführen und dem Gemeinderat Mitteilung zu machen, falls sich Massnahmen im Sinne von Art. 283/85 ZBG aufdrängen sollten. Nach Ablauf von 2 Jahren ist dem Gemeinderat über die Erziehungskontrolle schriftlich Bericht zu erstatten.
9. Dezember 1965,
Schreiben der Gemeindepolizei
Im Gemeinderat ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass die im Dollhaus wohnhafte Frau Lilith in sittlicher Beziehung zu Klagen Anlass gebe. Es sei deshalb die Frage zu prüfen, ob die Kinder der dort lebenden Lilith in sittlicher Beziehung nicht gefährdet seien.
Wir ersuchen Frau Alice, diese Feststellung auf ihre Richtigkeit zu prüfen und uns Bericht erstatten zu wollen.
21. Mai 1966,
Brief von Zuhälter Pietro an den Gemeinderat
Nach Beschreibung von Frau Alice wollen sie Lilith zwei Kinder wegnehmen, so wie sie sagen wenigstens zwei! Ich bin bis Jetzt für diese Frau und deren Kinder aufgekommen, seit Vater Jakob aus dem Haus ist.
Ich habe sie während der Scheidung unterstützt. So wie Frau Alice mir sagte sind die Kinder in Ordnung und finde es nicht nötig das die Kinder fort müssen, ich habe ja Anfangs Januar unterschrieben das ich für alle sorgen werde. Wenn sie die beiden Kinder holen wird der Frau und mir grosses Leid angetan. Ich hoffe sie übersehen die Schreibfehler, da ich sonst nur Italienisch schreibe, und nur mich wehren möchte um mein Recht.
Hochachtungsvoll
Grüsst
31. Mai 1966,
Schreiben der Gemeindepolizei
Prekäre Familienverhältnisse
Bei der Gemeindepolizei gingen in letzter Zeit häufig Klagen ein, dass die Familienverhältnisse bei der Fam. Lilith stets prekärer werden.
Wir verweisen auf den Bericht vom 15. Dez. 1965.
Es zeigte sich, dass Vater Jakob seit einem Monat nicht mehr bei der Familie nächtigt. Seit dem November 1965 ist ein anderer Mann bei der Frau, anfänglich ca. 1 Monat. Er arbeitete an verschiedenen Stellen und konnte keine halten. Er wurde bei der letzten Stelle fristlos entlassen, da er nur gelegentlich zur Arbeit erschien und zudem verlangte er stets Vorschuss.
Dieser Mann äusserte sich mir gegenüber, dass er unter allen Umständen Lilith heiraten werde!!!
Vor ca. 3 Monaten zog noch ein anderer Mann noch zu Lilith. Seit der Mann bei Lilith wohnte kümmerte er sich nirgends um einen Arbeitsplatz. Auf dem Betreibungsamt ist der Mann Fr. 1759.– eingeschrieben.
Der Mann wurde von mir aufgefordert, das Haus zu verlassen. Bei allen Kontrollen stellte ich fest, dass die Kinder ärmlich gekleidet sind. Zudem wurden wir von den Nachbarn dieser Familie aufmerksam gemacht, dass die Kinder bei ihnen Geld und Brot betteln. Ausserdem hat Mutter Lilith Lebensmittelschulden Fr. 166.–.
Am 26. Mai 1966 hatten sie zum Mittagessen Hundefleisch. Die Wohnung ist ihnen seit dem 13. Januar 1966 gekündigt. Eine andere haben sie bis jetzt noch nicht.
Wir schildern ihnen diese Umstände, weil in nächster Zeit fürsorgliche Massnahmen getroffen werden müssen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
[Der Gemeindepolizist]
1. Juni 1966,
Brief des Gemeindeammanns an Zuhälter Pietro
Dem Gemeinderat ist bekannt geworden, dass Sie nicht regelmässig Arbeiten. Wir sehen uns deshalb veranlasst, Sie wegen dieses arbeitsscheuen Lebenswandels allen Ernstes zu verw[arnen und Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Personen, die sich der Gefahr eines Notstandes und der Verarmung aussetzen gemäss Art. 370 ZGB unter Vormundschaft gestellt werden müssten. Wir wären veranlasst gegen sie vormundschaftliche Massnahmen zu ergreifen, falls Sie in Zukunft nicht regelmässig arbeiten sollten.
Hochachtungsvoll
Im Namen des Gemeinderates
1. Juni 1966,
Brief des Gemeinderates an Frau Alice
(...) Wir übermitteln Ihnen beiliegend die zwei Zuschriften an die beiden Zuhältern von Frau Lilith, sowie den Bericht der Gemeindepolizei über die Familienverhältnisse vom 31. Mai 1966 mit dem Ersuchen, zu diesen Akten Stellung nehmen zu wollen. Der Gemeinderat wird sowohl die beiden Herren auffordern, sofort für regelmässige Arbeit zu sorgen, ansonst der Gemeinderat gehalten wäre, entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Der Zuhälter Kurt hat in der Gemeinde keine Schriften deponiert, weshalb ihm auch Wegweisung angedroht wird. Wie uns der Herr Gemeinderat mitteilt, wäre Vater Jakob bereit, zwei der vier Kinder auf seine Kosten und freiwillig in das Kinderheim zu verbringen. Wir ersuchen Sie, mit ihm in dieser Angelegenheit zu sprechen und von ihm eine schriftliche Erklärung zu verlangen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Im Namen des Gemeinderates
25. Juni 1966,
Schreiben der Gemeindepolizei
Wir stellen fest, dass Frau Lilith mit den Kindern und ihren beiden Zuhältern Kurt und Pietro um 20 Uhr unsere Gemeinde fluchtartig verlassen hat!
Vater Jakob hat seinen Wohnsitz immer noch in unserer Gemeinde.
Mit vorzüglicher Hochachtung
[Gemeindepolizei]
9. November 1966,
Schreiben der Leitung einer Organisation
Mit einem Schreiben haben wir das Gerichtspräsidium der Stadt ersucht, im Ehescheidungsverfahren Mutter Lilith und Vater Jakob die vorsorglichen Massregeln gemäss Art. 145 ZGB in Bezug auf die Versorgung der Kinder zu treffen.
Als Begründung für diese Massnahme haben wir festgestellt, dass der Stadtrat, als Vormundschaftsbehörde am 14. August 1962 die Wegnahme der Kinder verfügt hat. (Diese Verfügung wurde im Beschwerdeverfahren am 18. Februar 1963 sanktioniert)!
Da sich für die Kinder in der Zeit nichts geändert hat, sei eine Wegnahme der Kinder dringend erforderlich.
Das Gerichtspräsidium teilt uns nun mit, das bis heute kein Präliminarbegehren eingegangen sei, gestützt auf welches die Verhältnisse der Familie zu regeln wären.
Wir bitten Sie, das administrative Verfahren im Sinne von Art. 283 und 284 ZGB durchzuführen und die Kinder zu versorgen!
Mit freundlichen Grüssen
7. Januar 1967,
Bericht von Frau Alice
Am 2. Januar 1967 besuchte ich gemeinsam mit meinem Mann die Familie Lilith in ihrer Wohnung. Bekanntlich lebt Vater Jakob nicht zuhause bei Lilith und Kindern, doch ist ein anderer Mann anwesend, ein Untermieter, wie Frau Lilith mir mitteilte.
Obwohl wir unangemeldet vorsprachen, fanden wir eine gut aufgeräumte Wohnung vor. Die Kinder waren sauber gekleidet. Alle vier Kinder entwickeln sich nach unserem Dafürhalten absolut normal. Anzeichen einer Unterernährung oder seelischern Verwahrlosung konnten wir nicht beobachten. Mutter Lilith erwartet ihr fünftes Kind.
Gesprächsweise sind wir auf die Frage der Versorgung der Kinder in einer Anstalt eingegangen. Mutter Lilith wehrte sich energisch.
Wir haben Mutter Lilith in Anwesenheit des dort lebenden Mannes dringend gebeten, in Bezug auf die Ehe, nun endlich geordnete Verhältnisse anzustreben.
Anschliessend möchten wir festhalten, dass sich eine Versorgung der Kinder aus den oben erwähnten Beobachtungen nicht aufdrängt, dass die finanziellen Mittel aber sehr knapp sein dürften (Mietzinsrückstand) und sich Massnahmen eher in diesem Bereich aufdrängen dürften.
Mit freundlichen Grüssen
Frau Alice
11. Januar 1967,
Schreiben des Fürsorgeamtes
Bekanntlich ist der Fall Mutter Lilith die am 18. Juni 1966 in eine andere Gemeinde fortzog, neuerdings aktuell geworden.
Folgende Erkenntnisse haben wir gewonnen
1. Die Familie wurde von Frau Alice, die durch den Gemeinderat mit dem Schreiben vom 8. Nov. 1965 mit der Erziehungskontrolle über die vier Kinder beauftragt worden war, häufig besucht und intensiv betreut.
Ich selber habe die Familie nur wenige Male besucht, dabei aber leider nie befriedigende Verhältnisse angetroffen. Die vier Kinder waren in einem Zimmer eingesperrt – die Mutter lag um 11 Uhr noch im Bett, ein andermal waren sie ebenfalls aus der Stube ausgeschlossen und hatten im kalten Gang, zum Teil dürftig bekleidet, sich zu verweilen, Küche und Stube in bedenklicher Unordnung.
Als durch die Gegenwart sowohl von Vater Jakob als auch von einem anderen Mann im gleichen Haushalt immer grössere Probleme und Schwierigkeiten entstanden, tendierte das Fürsorgeamt in Richtung Wegnahme der beiden älteren Kinder.
Vater Jakob war schliesslich mit einer Platzierung in ein Kinderheim einverstanden. Im letzten Moment weigerte er sich indessen, die entsprechende Erklärung zu unterzeichnen.
Am 18. Juni 1966 zogen die Leute weiter und entzogen sich damit unserer Einflusssphäre.
2. Aus dem Bericht von Frau Alice ist zu entnehmen, dass die Kinder im gegenwärtigen Milieu zu belassen seien.
3. Unsere Stellungnahme ist folgende:
Man tut der Mutter einen Dienst, wenn man Ihr die Kinder belässt. Ob aber auch den Kleinen?
Die Familie stösst bei jeder Gemeinde an und fällt mir ihrem Verhalten auf. Mutter Lilith lebt mit verschiedenen Männern in unsittlicher Weise im Konkubinat. Vater Jakob teilt immer wieder Lilith mit den bei ihr lebenden vorbeikommenden Männern.
Die Szenen spielen sich immer gleich ab, auch wenn sie weiterziehen.
Dieses sich teilen von verschiedenen Männern ist ernstlich bedenklich.
Ob das körperliche-seelische Wohl der Kleinen einigermassen gewährleistet ist, ist fraglich.
Ein wichtiges Moment in unsere Frage spielt der Umstand, dass Mutter Lilith das 5te Kind erwartet. Sie hat verschiedentlich gedroht, dass ein Familiendrama entstehe, (sie meint damit, dass sie sich selber und die Kleinen umbringen würde), wenn man auch nur eines der Kinder wegzunehmen versuche.
Das Problem um die Kinder kann nicht für sich gesondert behandelt werden, sondern steht in engstem Zusammenhang mit den Problemen der Eltern. Es muss eine Gesamtlösung angestrebt werden. Es ist für die Familie auch psychologisch erträglicher, wenn die Regelung der Kinderfrage im Rahmen des immer freiwillig angestrebten Entscheidungsprozesses geschieht. Wichtig aber, im Interesse der Kinder, ist nun unbedingt eine beschleunigte Prozessführung und eine rasche Entscheidung darüber, was mit den Kindern zu geschehen hat (bloss nicht vor der Geburt des 5. Kindes!). Aus menschlichen Erwägungen sollten sodann auf keinen Fall alle Kinder miteinander weggenommen werden, – und bei auch nur einigermassen günstiger Weiterentwicklung nur als vorübergehende Massnahme.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Fürsorgeamt
12. Januar 1967,
Brief von Frau Alice an das Fürsorgeamt
Wie uns scheint dramatisiert der Gemeindeschreiber den ganzen Fall sehr, um das Konkubinat von Mutter Lilith bald aus seinem Arbeitsbereich herauszubekommen. Unsere Ansicht wird durch verschiedene Berichte von Gemeindemitgliedern bestärkt.
Wir stellen fest, dass diese Leute weder mit materiellen noch mit geistigen Gütern gesegnet sind. Das Konkubinat von Mutter Lilith wird nicht von langer Dauer sein. Wir sind der Ansicht, dass man das ganze Problem reifen lassen muss.
Auf eine Wegnahme der Kinder reagieren die Leute bitter. Hilfe aus der Armenkasse wirt nicht gewünscht.
Neben der fürsorgerischen Seite, welche der materiellen wenn immer möglich vorgezogen werden sollte, ist auf die ernormen Auslagen, welche eine Versorgung der Kinder verursachen würde, hinzuweisen.
Ich beantrage, dem Gemeinderat zu empfehlen, Frau Lilith und ihre Kinder armenrechtlich gem. Konkordat zu unterstützen. Eine solche Massnahme dürfte vorerst für die zahlungspflichtigen Gemeinden die billigste und nach Ansicht von mir für die Familie auch die beste Lösung sein.
Mit freundlichen Grüssen
Frau Alice
10. Februar 1967,
Schreiben der Vormundschaftsbehörde
Frau Lilith und ihre Kinder wurden auf die Strasse gestellt. Die Frau und Ihre vier Kinder haben Unterschlupf gefunden bei Vater Jakob.
Hinsichtlich Hausrat ist folgendes festgestellt worden:
Es ist ein einziges Bett vorhanden, in das sich Vater Jakob und die vier Kinder teilen, (3 Kinder schlafen auf der Obermatratze, nur dürftig bedeckt, – Vater Jakob und Luisa benützen die Untermatratze). Frau Lilith schläft auf dem alten Sofa im kleinen Stübli.
Den Kindern fehlt es an Kleidern, sie tragen defekte, schmutzige Kleidchen.
Das Dringendste haben wir den Kindern im Anschluss an den Hausbesuch aus den Mitteln des Fürsorgefonds sofort angeschafft.
Das jetzige Logis ist für die Kinder absolut ungeeignet.
Zudem duldet Vater Jakob es nur als rein vorübergehend, kurzfristige Lösung.
Menschlich-psychologische Situation:
Sie ist im Prinzip die genau gleiche wie vor einem Jahr, 4 Kinder, 2 bis vier Männer und eine Frau.
Die Kinder sind oft alleine, sogar tagelang.
Folgende Lösung:
Die vier Kinder sind vorläufig wegzunehmen.
Für die Durchführung ist polizeiliche Hilfe unerlässlich. Auf Grund einer telefonischen Besprechung mit dem Bezirksammann, mit dem wir den überaus heiklen Fall näher diskutierten, sowie einer Besprechung zwischen Herrn Gemeinderat und der Kantonspolizei wird vorgeschlagen, dass die Kinder durch je einen Gemeinde- und einen Kantonspolizisten abgeholt werden. Die Aufgabe der Fürsorgerin wird darin bestehen, das Möglichste zu tun, dass die weitere Betreuung der Kinder soweit nur immer denkbar auch die spärlichen Ansätze einer positiven Zusammenarbeit mit der Mutter nicht zum vornherein zerschlagen werden. Sie wird die Kleinen ins Heim begleiten, nicht aber dabei sein bei der Abholung im Hause der Mutter.
Die Frage: wohin platzieren wir die Kinder, ist bis zur Stunde trotz intensiver Bemühung noch nicht gelöst.
Die Geschwister sollten wenn immer möglich beieinander bleiben.
Hochachtungsvoll
[Vorsteher der Vormundschaftsbehörde]
Die Kantonspolizei, der Bezirksschreiber und eine Frau standen vor der Haustür. Mutter Lilith war mit uns Kindern alleine zu Hause. Es war schon dunkel. Als die Türglocke verstummt war, klopfte es an der Tür. Meine Mutter schaute aus dem Fenster. Ein Schrei, dann sammelte sie uns hastig zusammen, ich spürte, wie ihr Körper zitterte, als wollten tausend kleine Flämmchen zu einem grossen Feuer werden. Auch ihre Stimme zitterte, und wir bekamen es mit der Angst zu tun. So kannte ich meine Mutter nicht. Wenn wir alleine waren oder wenn ein Freier für sie vor der Tür stand, war sie anders. Sie nahm den einjährigen Alioscha auf den Arm und drückte ihn fest an sich. Mascha, noch keine zwei Jahre alt, krallte sich vor Angst an Mutter Liliths Bein. Und Arabat hielt Mascha mit einer Hand, die zur Faust wurde, am Röckchen fest. Ich stand losgelöst von den anderen da, und mein Herz klopfte so schnell, als wollte es aus mir hinausspringen und wegrennen.
Ich meinte, den Tod riechen zu können. Meine Mutter stürzte mit Alioscha auf dem Arm, Mascha an ihrem Bein und Arabat an Maschas Röckchen in die Küche und holte sich ein Messer. Mascha fiel hin, meine Mutter fast mit ihr, Mascha schrie und Alioscha begann zu weinen. Arabat weinte mit. Und ich stand immer noch einfach da. Ich kam mir verlassen vor, wollte an diesem wilden Durcheinander nicht teilnehmen, wünschte mir aber eine menschliche Berührung.
«Aufmachen, hier ist die Kantonspolizei!», tönte es durch die Tür. Mit Alioscha im Arm, Mascha am Bein, Arabat im Schlepptau und dem Messer in der Hand öffnete Mutter Lilith die Tür und schrie den uniformierten Männern ins Gesicht. Sie fuchtelte wild mit dem Messer herum und im Handgemenge hielt sie es plötzlich auf Alioscha gerichtet. In diesem Augenblick stand allen der Atem still. Ich war die Einzige, die schrie. Ich tat es aus voller Kehle, als hätte ich gerade den Todesstoss bekommen. Meine Mutter liess das Messer fallen, als hätte ihr mein Schrei bewusst gemacht, was sie in ihrer Verzweiflung vorgehabt hatte. Dann ging alles ganz schnell: Alioscha wurde ihr aus dem Arm gerissen, Mascha von ihrem Bein gezerrt und Arabat, der sich noch immer an Maschas Röckchen klammerte, gleich mit. Und ich, Luisa, stand immer noch da, ganz allein. Ich glaubte schon, sie hätten mich vergessen. Da trat die Frau zu Mutter Lilith und sagte: «Reissen Sie sich doch zusammen, Sie bekommen sie ja wieder!» Mit diesem Satz nahm sie meine Hand und führte mich ganz ruhig zur Tür hinaus. Ich wusste, sie hatte meine Mutter angelogen.
Es wurde eine lange Fahrt in die Nacht hinein mit drei weinenden Kindern. Ich war still, schaute in die Dunkelheit, grelle Lichter rasten an mir vorbei. Alioscha kötzelte weinend vor sich hin, und es roch unangenehm. Die grellen Lichter wurden immer zahlreicher, und dann hielten wir plötzlich an und mussten aussteigen. Ich stand vor einem Tor. Es kam mir riesig vor und begann sich langsam zu bewegen. Zum Vorschein kam eine von Kopf bis Fuss schwarz gekleidete Gestalt. Sie hatte ein Gesicht mit zwei Augen, einer Nase und einem Mund, so wie wir, aber keine Ohren und auch keine Haare. Stattdessen hatte diese Gestalt etwas Weisses über der Stirn und trug ein schwarzes, langes Tuch. Sie machte mir Angst, und ich blieb stehen. Doch dann wurde ich sanft, aber bestimmt hineingeschubst. Ich hörte, wie das grosse Tor mühevoll ins Schloss fiel, es stöhnte wie meine Mutter, wenn sie mit einem Mann zugange war. Ich wurde über viele kleine Kieselsteinchen weitergeschubst bis zu einer grossen Tür, wo noch mehr schwarze Gestalten warteten.
Wir gelangten in einen langen Gang aus roten Steinen, und manche der Steine bewegten sich unter meinen Füssen. Es gab keine Fenster, dafür riesige Wände und an der Decke hingen grosse Lampen, viel zu grosse. Zu Hause hatten wir nur kleine. Es roch nach nichts, und mich fröstelte. Am Ende des Ganges war wieder eine Tür, und ich musste auch dort hindurch. Wir kamen in einen riesigen Raum mit vielen Tischen und Stühlen, der zu Fangis und Versteckis einlud. Eine Wand bestand ganz aus Fenstern, und man konnte die Nacht draussen gut sehen. Ich konnte sie sogar fühlen. Wir mussten uns setzen und ein wenig warten, zusammen mit einer dieser Gestalten, die man hier Schwester nannte. Das schien mir doch etwas seltsam, denn meine Mutter hatte ja immer kleine Schwestern mit in die Familie gebracht, und die sahen gar nicht aus wie diese. Ich wollte zu dem grossen Fenster laufen und in die Nacht schauen, doch die Schwester hielt mich mit der Hand zurück und befahl mir, mich wieder hinzusetzen. Aber das Warten dauerte mir einfach zu lange, und ich rannte los, um die Tische herum und zum grossen Fenster. Mascha wollte mir nach, aber sie hatte noch zu kurze Beine. Ich kletterte auf das Fensterbrett, presste mein Gesicht an die kalte Scheibe und sah in die tiefe, dunkle Nacht hinaus. Ich konnte nichts erkennen. Mein Herz wurde schwer, und ich weinte.
Die anderen Schwestern kamen zurück und stellten uns in eine Reihe. Nur Alioscha durfte sich auf den Tisch setzen. Eine der Schwestern musste mich vom Fenstersims holen, denn ich wollte von dort nicht mehr weg. Als sie mich zu packen versuchte, rannte ich los und schwupps, ging das Fangisspiel los. Da ich viel kleiner war als die Schwester, konnte ich unter den Tischen durchschlüpfen und ihr entkommen. Es war herrlich, so herumzutoben, schneller und flinker zu sein als die Frau in ihren schwarzen, langen Tüchern. Ich vergass meine Angst. Noch zwei Schwestern liessen sich von meiner Freude am Fangis anstecken, und das freute mich sehr. So hatte ich noch nie mit Grossen spielen dürfen. Die Krönung wäre gewesen, wenn auch die schwarzen Frauen sich getraut hätten, unter den Tischen durchzukriechen. Sie beugten sich aber nur unter die Tische, sodass ihre Köpfe ganz rot wurden, und riefen mir etwas zu. Aber ich verstand es nicht.
Ein Mann spielte schliesslich den Köder: Er verführte mich mit Schokolade. Er schob mir kleine Stücke unter den Tisch. Süss schmeckten diese braunen Schokoladentäfelchen, und ich wollte noch mehr davon haben. Also kroch ich unter dem Tisch hervor. Es gab dann aber nur noch ein letztes, kleines Stück, bevor er mich packte, lachte und mich zurück in die Reihe zu meinen Geschwistern stellte. Die anderen bekamen jetzt auch Schokolade als Belohnung für ihr strammes Warten. Aber dann fing dieser Mann an, Alioscha anzufassen. Und so tanzte ich wieder aus der Reihe, um besser sehen zu können, was mit Alioscha geschah. Die schwarzen Frauen hielten Stifte in der Hand. Sobald der Mann etwas sagte, hatten sie allerhand zu schreiben. Auch das gefiel mir nicht. Ich fürchtete, sie könnten Alioscha damit zum Verschwinden bringen, dass man ihn am Ende nur noch auf dem Papier sehen könnte. Der Mann fuhr mit einem Kamm über Alioschas Köpfchen, starrte dann auf den Kamm, schüttelte den Kopf und lächelte Alioscha an. So wie er ihn anlächelte, war das ein gutes Zeichen für mich.
Alioscha sollte auch den Mund aufmachen, was ihm nicht gefiel, und er weinte bitterlich vor sich hin, als der Mann ihm den Mund öffnete. Doch Alioscha, gar nicht dumm, biss ihm dafür mit seinen wenigen spitzen Zähnen den Finger wund. Ich war stolz auf ihn, weil er sich so gut wehren konnte. Es wurde noch allerhand an diesem kleinen, weinenden Kind herumgefingert und dann aufgeschrieben. Als sie damit fertig waren, nahm eine Schwester Alioscha auf den Arm und verschwand mit ihm. Es ging so schnell, dass ich nicht wusste, wohin. Ich spürte, wie mein Körper sich verkrampfte und mein Herz schreien wollte, aber nicht konnte. Meine Hände ballten sich zu Fäusten, die sich wie Feuer anfühlten. An Mascha durfte kein Mann heran! Ich schrie und tobte und stampfte mit den Füssen, so fest ich konnte, weil seine Hände nicht von Mascha liessen. Ich krümmte mich auf dem Boden und über mir war diese fremde, schwarze Frau, die mich fest umklammerte. Ich konnte sie atmen hören. Endlich liess der Mann Mascha los, mein Körper entspannte sich, das Feuer wich aus meinen Fäusten, das Schreien in mir hörte auf. Mein Herz musste nicht mehr rasen, und ich hörte, wie es zu summen begann.
Dann wurde Mascha weinend von einer schwarzen Frau aus dem grossen Saal getragen und war auch verschwunden. Arabat und ich waren nun allein mit zwei Schwestern und diesem Mann. Arabat liess alles mit sich machen. Seine Augen waren leer. Ich konnte darin so wenig erkennen wie in der schwarzen Nacht vor dem Fenster. Nur war es in seinen Augen nicht schwarz, sondern grau, nicht einmal eine Träne, gar nichts war da. Auch Arabat verschwand mit einer Schwester. Sie hatte keine schönen Farben um sich herum, und ich traute ihr nicht. In meiner Seele wusste ich, dass Arabat nichts Gutes geschehen würde, aber Arabat lief mit ihr mit. Ich blieb allein zurück mit dem Mann und der letzten Schwester. Der Mann wollte mit mir dasselbe tun wie mit meinen Geschwistern, aber ich liess es nicht zu. Ich wehrte mich mit heftigen Bissen, sodass er nicht an mich herankam und mich schliesslich mit der Schwester aus dem Raum gehen liess. Sie wollte mir die Hand reichen, ich ergriff sie aber nicht. Wir gingen wieder diesen langen Gang entlang, und wieder gab es eine Tür, die sich öffnete, und ich musste hinein ins Ungewisse. Ich stand vor einer langen Holztreppe, die sich die Wand entlangschlängelte. In der Mitte jeder Stufe war ein kleiner, geblümter Fleck, den ich mir auf den Knien genauer anschauen musste. Die Schwester wartete geduldig auf mich. Ich fuhr mit der Hand über den Fleck, und er kratzte, nur nicht an jenen Stellen, wo er ganz glatt war – als hätte er dort keine Haare, die ihm zu Berge standen. Ich musste an ihm riechen, und er roch nach vielen verschiedenen Füssen.
Die Blümchen luden mich ein, auf sie zu treten und die Treppe hochzugehen. Ich achtete darauf, dass ich immer schön auf die glatte Stelle trat, denn dort hatte es fast keine Blümchen. Diese Treppe war lang, ich hatte noch nie so viele Stufen hinaufsteigen müssen, und meine Beine mussten viel arbeiten. Ich wurde müde und setzte mich auf eine Stufe. Die Schwester setzte sich neben mich und redete zu mir, doch ich verstand das meiste nicht. Ich schaute sie nur an. Es war seltsam, ein Gesicht zu sehen, aber keine Ohren und keine Haare. Ihre Augen strahlten, als sässen zwei kleine Flammen darin. Die Schwester nahm behutsam meine Hand und ich liess es zu, denn sie war so warm und freundlich und zart. Ich musste weiter die Treppe hoch. Da war wieder eine Tür und neben der Tür ein Stuhl, auf dem eine schwarz eingehüllte Frau mit einem Buch in der Hand sass. Die beiden Schwestern begrüssten sich, und es ging weiter die Treppe hoch, es schien kein Ende zu nehmen. Es kam mir vor, als würde ich in den Himmel steigen. Endlich müde im Himmel angekommen, öffnete sich für mich eine letzte Tür, und ich sah einen grossen Raum mit vielen, vielen Betten. Es war unheimlich still. Die Schwester hielt den Finger vor den Mund, was wohl bedeutete, dass ich nicht mehr atmen sollte. Das versuchte ich, aber ohne ein- und auszuatmen konnte ich nicht weitergehen, also blieb ich einfach stehen, bis ich nicht mehr konnte und nach Luft ringen musste. Die Schwester hob mich vorsichtig auf den Arm und trug mich zwischen den vielen Betten hindurch an ein Fenster, das ein wenig Licht in den grossen Raum hereinliess.
Nun war ich am Ende meiner Reise angekommen. Ich musste mich ausziehen und ein neues Kleidchen anziehen, das nach Seife roch. Ich wurde behutsam in ein Bett gelegt und zugedeckt. Eine Weile sass die Schwester neben mir, wachsam. Ich war müde von der Fahrt, und das Licht in ihren Augen liess mich in die Welt der Träume reisen. Als ich erwachte, blickte ich in die Nacht hinaus, in den Himmel, und ich konnte die Sterne leuchten sehen. Ich sah Alioscha, Mascha und Arabat vor mir, die alle weinten. Ich glaubte zu hören, wie sie meinen Namen riefen: «Luisa, Luisa, wo bist du? Komm uns holen!» Ich setzte mich auf und ihr Rufen verstummte. Ich rieb mir heftig die Augen und spitzte die Ohren. Ich konnte nur die unheimliche Stille hören in diesem viel zu grossen Raum mit diesen vielen Betten. Ich wagte kaum zu atmen. Ich schaute in den Schlafsaal und bemerkte, dass in jedem Bett ein Häufchen lag, das sich aufblies wie ein kleiner Ballon und dann die Luft wieder herausliess.
Ich hatte Heimweh nach meinen Geschwistern. Zu Hause schliefen wir immer zusammen in zwei Betten. Ich fühlte mich einsam ohne ihre Wärme. Ich kletterte aus dem Bett und machte mich so leise wie möglich auf die Suche nach ihnen. Ich lief von Bett zu Bett und schaute in die schlafenden Gesichter. Um sie zu erkennen, musste ich mich auf die Zehenspitzen stellen und mich im Gleichgewicht halten. Aber keines der Gesichter gehörte zu meinen Geschwistern. Auch mit der Nase konnte ich sie nicht ausfindig machen, denn ein strenger Seifengeruch lag in der Luft. Ich ging wieder zurück zu meinem Bett, kletterte hinein und deckte mich zu. Ich schaute in die Nacht hinaus, hoch hinauf zu den leuchtenden Sternen, die friedlich vor sich hin strahlten, bis meine Augenlider schwer wurden.
Als ich erwachte, standen lauter kichernde Mädchen um mich herum und zupften und rupften an meiner Decke und meinem Kleidchen. Sie kamen mir vor wie wild gewordene Vögel, die schon lange nichts mehr zu picken gehabt hatten. Es machte mir Angst, und ich versteckte mich unter der Decke. Aber sie wurde mir gleich wieder weggezogen, und eine der Schwestern stand neben mir mit Kleidern in der Hand. Eine andere hatte ihre liebe Mühe, die Mädchenhorde zusammenzutrommeln.
Die Schwester nahm mich bei der Hand. Ich war froh um ihre Hand, denn ich fühlte mich verloren. Ich glaubte, wir würden nun zu meinen Geschwistern gehen, hinaus und die grosse Treppe hinunter. Doch wir gingen durch einen Gang, den ich nicht kannte, und eine andere Treppe hinunter. Es roch muffig, es stank. Auf den Steinstufen hätten meine kleinen Füsse zehnmal Platz gehabt. Wieder ging eine Tür für mich auf, und ich befand mich in einem hohen Raum mit Steinmauern und kleinen, schmalen Fenstern. Die Luft war rauchig und feucht. Es roch nach Seife. An der Wand stand ein Gefäss, gross wie ein Boot, unter dem ein Feuer brannte. Als mir die Schwester das Kleidchen auszog, wusste ich: Da musste ich hinein. Ich wollte nicht in diese grosse Pfanne, ich wollte nicht gekocht werden und stampfte und schrie, als wäre der Teufel hinter mir her. Hatte man Arabat, Mascha und Alioscha auch gekocht?
Mein Schreien und Stampfen half nichts. Ich wurde in den Topf gesetzt und plötzlich umgab mich eine angenehme Wärme. Ich hörte auf zu schreien. Aber kaum gefiel mir etwas, kam wieder etwas, was ich hasste: Meine Haare wurden nass gemacht, eingeseift und ausgespült, es brannte in den Augen. Dann wurde ich aus der Pfanne gehoben und trocken gerieben, vom Kopf bis zu den Füssen. Ich roch nur noch nach Seife, wie alle anderen in diesem Haus. Ich war nun eine von ihnen. An meinen Haaren wurde herumgerupft und mit einem Messer hantiert. Meine Kopfhaut juckte. Mein Haar wurde nicht zu zwei Schwänzchen gebunden, wie meine Mutter es machte, sondern eng geflochten. Meine Kopfhaut juckte.
Geputzt und gestriegelt, durfte ich dieses Gemäuer endlich verlassen, und ich fühlte mich, als hätte ich nun auch noch meine Seele verloren. Ich, Luisa, war mir fremd. Ich roch nicht mehr wie Luisa. Ich stieg die dicke Steintreppe hinauf und gelangte in den Saal, den ich schon kannte. Es war laut, und die vielen Tische und Stühle waren von Kindern besetzt. Ich liess mich auf einen freien Stuhl fallen und wartete, bis meine Seele wieder zu mir zurückfand. Ich sass bei vielen Mädchen am Tisch, und wir reichten uns die Hände. Die Mädchen sangen ein Tischgebet, und endlich durfte ich etwas essen. Es schmeckte mir nicht. Das Brot war sauer und machte mir Bauchweh.
Dann verging Tag um Tag, und ich gewöhnte mich allmählich an die Grösse dieses Kinderheims. Aber das Heimweh nach meinen Geschwistern wurde immer stärker. Sie waren in einem anderen Gebäude bei den Säuglingen und Kleinkindern untergebracht. Mein Bruder Arabat war zwar im selben grossen Gemäuer wie ich, doch die Buben und Mädchen wurden getrennt. Nur die Mahlzeiten im grossen Speisesaal durften wir drei Mal am Tag zusammen mit den Buben geniessen, unter strenger Aufsicht und in absoluter Stille. Am Anfang und am Schluss der Mahlzeiten wurde gesungen. Ich war sehr einsam unter den vielen Mädchen. Das meiste, was sie sagten, konnte ich nicht verstehen, weil wir zu Hause nur Jiddisch, Jenisch und Hebräisch sprachen. Ich war in einem fremden Land, unter fremden Menschen.