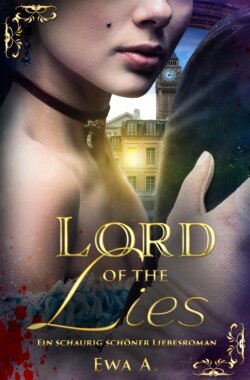Читать книгу Lord of the Lies - Ein schaurig schöner Liebesroman - Ewa A. - Страница 9
Kapitel 5
ОглавлениеEinem Schatten gleich bewegte er sich durch den Wald. Wie konnte eine schmächtige Person so schwer sein? Er hatte geglaubt, die Baroness durch den Park zum Ufer der Themse zu tragen, wäre ein kleineres Problem, als sie in einem unbeobachteten Moment zu betäuben und zu verschleppen. Aber da hatte er sich getäuscht. Es war wesentlich leichter gewesen, den beiden jungen Frauen aus dem Zelt zu folgen und hinter den Büschen auf den Augenblick zu warten, bis die Baroness allein auf der Bank zurückgeblieben war. Dass er dunkle Kleidung trug, gereichte ihm, wie immer in diesen Situationen, zum Vorteil und machte ihn in der Finsternis fast unsichtbar. Da die Baroness durch die Droge sowieso schon schwach und benebelt auf der Bank gesessen hatte, war es einfach gewesen, ihr aus dem Hinterhalt ein Äther-getränktes Tuch über Mund und Nase zu stülpen. Sie war gar nicht mehr in der Lage gewesen, sich gegen einen Überfall zu wehren. Es hatte danach nur Sekunden gebraucht, ihren schlaffen Körper in die Büsche zu ziehen und fortzuschleifen. Sofort hatte er sich dann mit ihr in das naheliegende Wäldchen verzogen, das neben den Panoramawegen entlang, um den See herum wuchs. Zwar wurde dieser Forst ab und an von Querpfaden durchbrochen, die von den Gärten zum Seeufer führten, aber dennoch würde sie hier drin niemand finden. Was ihm allerdings den Marsch erschwerte, waren das Unterholz, das unebene Gelände und vor allem die Röcke der Baroness, die er auf den Schultern trug. Er hatte ihr eine schwarze Decke umgelegt, damit ihre helle Kleidung nicht in der Dunkelheit auffallen würde, aber auch die hatte ein Gewicht und bewahrte die Spitzenbesätze ihrer Röcke nicht davor, im Gestrüpp hängenzubleiben. Mehr als einmal war er deswegen gestrauchelt, was zum einen schmerzhaft für seine Fußgelenke und zum anderen zeitraubend war. Er würde ewig brauchen oder sich noch die Knochen brechen wegen diesem Firlefanz.
Schnaubend hielt der Mann inne und warf seine Last auf den Waldboden. Mit einem leisen Ächzen richtete er sich gerade auf, drückte seinen Rücken durch und hielt den Atem an, um in die Finsternis hineinzuhorchen. Von Weitem konnte er die Musik des Orchesters im Tanzzelt hören, ab und an auch ein lautes Rufen. Er schloss daraus, dass man bereits mit der Suche nach ihr begonnen hatte. Hastig zog er unter seiner Weste einen kurzen Dolch hervor, schlug die Decke beiseite und durchtrennte die Schulternaht des Oberkleides. Dies besaß eine lange Schleppe und hatte großes Gewicht. Danach suchte der Mann nach dem Rockbund an ihrer Taille und schnitt diesen ebenfalls entzwei. Mit einem beherzten Ruck riss er die Röcke auf und konnte auf diese Weise die junge Frau geradewegs aus den Kleidern heben. Erneut warf er sie sich über die Schulter und nahm die dunkle Decke wieder auf, um ihren hellen Leib darunter zu verbergen. Die Baroness war nun um einiges leichter als zuvor, da sie nur noch unzureichend mit Mieder und Unterhose bekleidet war. Diese Tatsache störte den Mann nicht und genauso wenig erregte sie ihn.
Obwohl er ein Mann im besten Alter war ,vor Gesundheit sprühte und es von ihm erwartet wurde, hatte ihn der Körper einer Frau noch nie fasziniert. Die reinen, unbefleckten Kinderleiber waren es, die ihn stimulierten, wobei ihm das Geschlecht egal war. Wenn er dann noch die Angst in ihren großen Augen sehen konnte, fühlte er sich so mächtig, wie ein Gott. Deshalb betraute der Meister auch ihn mit der Aufgabe, die Jungfrauen zu beschaffen. Denn allein bei ihm konnte Samael mit Bestimmtheit davon ausgehen, dass sie noch als Jungfrauen im Tempel ankamen. Im Gegenzug konnte er darauf bauen, dass er in den folgenden Messen Gelegenheit bekam, seine sexuellen Fantasien auszuleben. Nicht alle seiner Zirkelbrüder waren von diesen Zeremonien angetan. Lediglich Voland konnte sich ab und an dafür begeistern, wenn das Kind nicht zu jung war und seinen Vorlieben entsprach. Samael dagegen vollführte die Rituale bloß aus einem Zweck: um dem Herrn der Fliegen zu huldigen. Der Herr der Fliegen, der Name war wirklich passend, wenn er an die von Maden befallenen Köpfe dachte. Mochte Samael diese als Opfergaben bezeichnen, er selbst nannte sie Trophäen.
Just in dem Moment, als der Teufelsanbeter sich Mut zuredete, sein Ziel bald zu erreichen, hörte er eine Gruppe von Männern näherkommen. Deren lautes Gejohle und Gelächter dröhnte durch den Wald, sodass es ihm schwerfiel, die Richtung auszumachen, aus der sie auf ihn zukommen würden. Panisch sah der Schatten sich um, ob eine bewegende Lichtquelle ihm den Standort der Männer verraten würde. Doch wegen der Lichter am Wegesrand benötigten die Störenfriede keine weiteren Laternen oder Fackeln.
Er musste die Baroness verstecken, sofort. Auf gar keinen Fall durfte er mit dem verdächtigen Ballast auf seinen Schultern gesehen werden. Später, wenn die Männer weitergezogen waren, könnte er sie wieder abholen. Sie hier im Wald abzulegen, war kein guter Plan, denn entweder könnten die Männer über sie stolpern oder er würde sie womöglich nicht mehr finden. Nein, vielleicht war am Seeufer ein verlassener Tempel oder eine Laube, was ihm als zuverlässiges Versteck dienen konnte.
Zügig zwängte er sich durch das Unterholz zum Ufer und musste enttäuscht feststellen, dass nichts dergleichen vorzufinden war, auf was er gehofft hatte. Lediglich eine gestrandete Gondel lag am Ufer des Sees. Da kein Weg hierherführte, weit und breit niemand auf der Wiese zu sehen war, die lärmenden Männerstimmen jedoch immer näherkamen, entschied sich der Entführer, sein Opfer in der Gondel zu verstecken. Er bugsierte die Baroness in das Boot und breitete die schwarze Decke über ihr aus. Das fehlende Licht ließ sie im tiefen Bauch der Gondel mit der Dunkelheit eins werden. Niemand würde hier die junge Frau entdecken. Eilig machte sich der Teufelsanbeter davon, mit der Absicht, sein Opfer wieder abzuholen.
*
Bradford ging zu seinen Freunden zurück, die ihn allesamt mit einem schadenfrohen Grinsen empfingen.
»Hattest wohl kein Glück, Brad?!«, feixte Fenton ihm entgegen.
Edvard bot ihm ein Glas Sekt an, mit einem gutgemeinten Trost. »Würde jede zusagen, würde es seinen Reiz verlieren.«
»Ich dachte, der Reiz läge in etwas anderem als in einem Tanz«, sinnierte Grant.
Bradford nahm das Glas mit einem Nicken an. »Der Reiz liegt schon im Tanz, Grant, nur nicht in dem, der auf dem Parkett stattfindet.«
Das Lachen seiner Freunde zeigte ihm, dass sie seine Anspielung verstanden hatten und seine Meinung teilten.
»Wo ist eigentlich Lester abgeblieben?«, fragte Bradford und sah sich nach seinem engsten Freund um. »Hat er schon seine Auswahl getroffen? Wer ist es diesmal?«
Fenton zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, wo er sich immer rumtreibt. Kaum waren wir im Zelt angelangt, war er schon wieder verschwunden.«
»Wenn Lester der Hafer sticht, fackelt er nun mal nicht lange«, erwiderte Edvard darauf.
Grant grunzte missmutig. »So viel Hafer gibt es gar nicht, wie es den andauernd sticht.«
»Ach, kommt, Kameraden! Besorgen wir uns ein paar Flaschen von Shutterfields teurem Wein und suchen unseren Freund. Mit den Weibern wird es heute eh nichts mehr. Saufen wir uns den Abend lieber schön.« Mit einem Schluck leerte Bradford sein Glas.
Vielleicht würde der Sekt ihm helfen, denn er war auf einmal schrecklich müde. Frische Luft und Bewegung würden ihm sicher besser bekommen als trübseliges Herumlungern an der Tanzfläche. Außerdem würde er sonst den ganzen Abend zu der entzückenden Baroness hinüberstarren, was er vermeiden wollte und sich bisher streng verboten hatte. Wenigstens darin war er erfolgreich gewesen. Verflucht, er sollte die Kleine aus seinem Gedächtnis verbannen. Er suchte keine Ehefrau, sondern etwas anderes. Nie würde Bradford Kenneth Lyndon heiraten, soviel stand mit Sicherheit fest.
»Von mir aus, lasst uns gehen. Die Ballsaison hat erst angefangen. Demnach haben wir den ganzen Sommer noch Zeit, um die unschuldigen Rehlein zu erlegen.« Fenton drehte sich um und machte sich zu einem der Zeltausgänge auf.
Edvard schüttelte den Kopf und folgte ihm. »Mein Freund, ich befürchte, dass du von uns der Erste sein wirst, der von einem dieser Rehe zur Strecke gebracht wird.«
»Zum Teufel, dann hätte dieses ewige Süßholzgeraspel von dem Kerl endlich ein Ende. Ich verstehe nicht, warum die Weiber auf sein Geschwafel überhaupt hereinfallen«, brummelte Grant.
Bradford stellte sein Glas auf einem Tisch ab und klopfte seinem Freund auf den Rücken. »Das liegt vermutlich daran, dass du kein Weibsbild bist, mein Guter.«
»Der Herrgott sei gepriesen dafür!«, meinte Grant lakonisch, woraufhin Bradford lachte.
»Wohl wahr! Du gäbst nämlich eine schreckliche Jungfer ab und eine hässliche obendrein.«
Gut gelaunt suchten die zwei schließlich ihre Freunde, die schon mit mehreren Flaschen Wein vor dem Zelt auf sie warteten. Sogar Lester hatte sich eingefunden, um dessen Schultern Bradford brüderlich seinen Arm legte.
»Wie ich sehe, bist du ebenfalls erfolglos von der Jagd zurückgekehrt?«
Lester grinste und hob ihm eine entkorkte Weinflasche vor die Nase. »Mehr oder weniger.«
Bradford schwankte, seine Lider wurden immer schwerer und trotzig griff er nach der Flasche, um sich einen kräftigen Schluck zu genehmigen. Wenn ihm das nicht half, wieder munter zu werden, dann vielleicht ein Bad im See.
Sechs leer getrunkene Flaschen später torkelten die Freunde im Dunkeln am See entlang. Bradford hing laut schnarchend über Lesters und Edvards Schulter, die ihn mit sich schleiften.
»Verdammt, iss der schwer«, lallte Edvard und Lester keuchte.
»Ich kann nich mehr!«
Daraufhin ließ er Bradfords Arm los, der sofort in sich zusammensackte und den betrunkenen Edvard fast mit umriss. Diesem blieb nichts anderes übrig, als seinen Freund ebenso freizugeben. Mit einem dumpfen Laut landete Bradford im Gras und stieß einen lautstarken Schnarcher aus.
Grant taumelte zu seinem schlafenden Freund und beugte sich über ihn. »Vielllleicht … iss er leii-leichter, wenn wir …«, ein Hicksen unterbrach ihn, »… wennnn wir ihn auuus… aussiehen.«
Fenton grölte: »Guter Einfall, Granty. Machen wir den Duke nackig!«
Kichernd machten sich die vier Freunde daran, Bradford zu entkleiden. Mit vielen »Hui« und »Was ’n das?« flogen die Klamotten durch die Gegend und nach kurzer Zeit lag ein nackter Duke Lyndon auf der Wiese.
»Soll’n wir ihn hier lasssen?«, rief Edvard mit hoher Stimme und schwankte bedenklich.
Lester legte sich einen Finger auf den Mund und nuschelte: »Pssst! Nich sooo laut, sons wecken wir ihn nnnoch.«
»Hey, guckt mal! Da is ’n Boot«, zischte Grant und zeigte auf die Gondel, welche am Ufer des Sees gestrandet war.
»Wo?«, fragte Fenton lallend und schaute in den Wald. »Da iss nirgens ’n Boot, Mann. Ich seh nur ’n Haufen … Dingens, so grünes Ssseug.«
Grant packte seinen orientierungslosen Freund, drehte ihn zu dem See und deutete auf die dunkle Silhouette der Gondel.
»Nich dort! Da, im Wassa!«
Edvard gluckste: »Packen wir Brrrads Kleida da rein!«
»Neiiiin!«, flüsterte Lester aufgeregt und erhob seinen Zeigefinger. »Ich weiß wasss viel Bessererees.« Ruckartig zeigte er auf den See und schwankte dabei. »Wir packen Brad da rein!«
Nachdem alle begeistert zugestimmt hatten, schleppten sie Bradford mit vereinten Kräften zur Gondel.
»Oh, da iss sogar ’ne Decke drin. Na, da hattas schön kuschschelig!«, nickte Edvard, als sie ihn in das Boot legten.
Fröhlich prustete Lester: »Dann brauchta die Kleida ja nich mehr.«
Grant stemmte sich gegen die Gondel und versuchte, sie ins Wasser zu schieben.
»Was machst du ’nn da?«, fragte Fenton und hickste.
Grant schüttelte bedröppelt den Kopf. »Iss doch ’n Boot. Und Boote schwimmen.«
Das klang logisch in den Ohren der drei anderen und sie nickten zustimmend. Gemeinsam wuchteten sie die Gondel in den See. Zwar rutschten sie dabei aus, wurden nass und dreckig, aber das war den vieren egal. Zufrieden grinsend verharrten sie am Ufer und sahen zu, wie die Gondel mit ihrem Freund gemächlich auf die Mitte des Gewässers zu trieb.