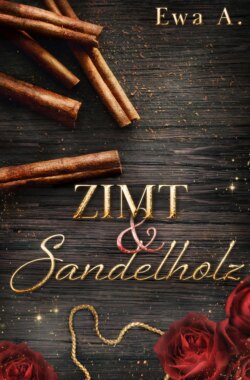Читать книгу Zimt und Sandelholz - Ewa A. - Страница 5
2. Verlorenes Zuhause
Оглавление4 Wochen zuvor
Es war keiner dieser goldenen Herbsttage, die man im Oktober sehnsüchtig erwartet, weil sie Erinnerungen an einen unbeschwerten Sommer schenken. Vielmehr war es einer dieser trostlosen, an denen sich nur allmählich die feuchtschweren Nebelschwaden des Morgens auflösten und die trübe Nachmittagssonne hinter dem grauen Wolkenvorhang erahnen ließen. Wir fuhren in unserer alten Schrottlaube die enge Straße in dem kleinen, abgeschieden gelegenen Dorf entlang. Als ich vermutete, dass wir demnächst das Ziel unserer Reise erreichen würden, drosselte ich das Tempo. Bald kam das Grundstück in Sicht, dessen hohe Bäume schon von Weitem auszumachen waren. Vieles hatte sich verändert. Zwar stand noch der schmiedeeiserne Zaun, aber das Gebäude war nicht mehr wie einst von dieser Stelle aus zur Gänze zu sehen. Im Gegensatz zu früher verbarg es sich nun hinter den kahlen Laubbäumen. Während ich den Blinker betätigte und auf die Einfahrt zusteuerte, stöhnte meine Tochter neben mir auf dem Beifahrersitz laut auf.
»Oh Gott, Mama«, fuhr sie mich an und zog die Kopfhörer ihres Walkmans von den Ohren. Die munteren Klänge von Come on Eileen der Dexy’s Midnight Runners schallten leise ins Autoinnere und standen im krassen Widerspruch zu meiner Gefühlslage.
»Sag mir jetzt bitte nicht, dass das da ab heute unser Zuhause sein soll?« Joan warf mir aus ihren grünen Mandelaugen einen vorwurfsvollen Blick zu.
Obwohl es mir das Herz zusammenzog und ich meiner sechzehnjährigen Tochter gerne etwas anderes gesagt hätte, erstickte ich kurz und schmerzlos ihren letzten Hoffnungsschimmer. »Doch.«
Ihr Gesichtsausdruck nahm an Frustration zu. Schweigend legte sie die Kopfhörer auf ihren Schoß nieder und machte die Musik aus.
Verwundert stellte ich fest, dass die Flügel des Gartentores, die einst einen imposanten Empfang bereitet hatten, vergessen vor sich hin rosteten.
Wie konnte das sein? Meine Mutter war von jeher darauf bedacht gewesen, das Anwesen in Schuss zu halten. Seltsam.
Das Tor stand offen, sodass ich langsam in die gekieselte Auffahrt einbiegen konnte. Irritiert bemerkte ich, dass der Garten, der ehemals einer gepflegten Parkanlage geglichen hatte, stark verwildert war. Die Buchsbäume mussten schon jahrelang nicht mehr gestutzt worden sein, denn ihre frühere akkurate Form gehörte der Geschichte an. Unerbittlicher Efeu hatte sie im Würgegriff und drohte sie, unter einer Flut von Schlingen und Blättern zu ersticken. Den armen zartgliedrigen Zierpflanzen erging es genauso, wie es mir einst ergangen war.
Erinnerungen an die penibel geformten Kegel stiegen in mir auf, die den damaligen englischen Rasen geziert hatten. Im Stillen fragte ich mich, was passiert war, dass meine Mutter von der strikten Pflege ihres Hab und Guts abgelassen hatte. Kein einziges Unkraut oder Moos hatte sie in jener Zeit auf dem satten Grün geduldet. Doch nun war es eine verwahrloste Wiese, voll von verblühten Disteln, wüsten Brombeersträuchern und wild wuchernden Hagebutten.
Unter den hohen Linden konnte ich, inmitten des Gestrüpps, den halb verrosteten Eisenpavillon ausmachen, in dem ich als Kind gern gespielt hatte. Ein beklemmendes Gefühl erfasste mich und ich ließ meinen Blick dem Haus entgegenschweifen, das langsam näherkam.
Das früher strahlende Weiß der Fassadenfarbe war nur noch ein düsteres Grau. Die langen Fensterläden waren morsch und so sehr beschädigt, dass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen konnten. Ihre zerfallenen Reste baumelten teilweise nur noch an einem Scharnier. Die Verwahrlosung des Anwesens konnte nichts Gutes verheißen.
Freude brachte ich mit diesen Gemäuern ohnehin nicht in Verbindung. Schmerz, Einsamkeit, Wut und Leid waren die Gefühle, die ich beim Anblick meines ehemaligen Heims empfand und daran hatte sich nichts geändert.
Eine dunkle Furcht befiel mich und ließ mir die Nackenhaare stehen. Es schien, als trage das Haus nun endlich das Unheilvolle zur Schau, welches seit jeher in ihm gärte und mich verfolgte.
So sehr der Zahn der Zeit auch an ihm genagt hatte, ich hätte es immer wieder erkannt. Niemals war dieses Gebäude in meinen Erinnerungen verblasst. Nicht, dass ich es in all den vergangenen Jahren nicht versucht hätte, es zu vergessen. Nach wie vor fand es den Weg in meine ruhelosen Träume. Oder zumindest Teile von ihm.
Allein der Gedanke an diese Träume, in denen ich den langen, dunklen Flur des Obergeschosses entlangeile, der einfach kein Ende nehmen will, ließ einen Schauder meinen Rücken hinunterlaufen.
Ich fuhr den Wagen vor das Garagentor, dessen taubengrauer Lack bereits großflächig abgeblättert war, und schaltete den Motor mit einem Seufzen aus.
»Glaub mir, Joan, wenn wir eine andere Wahl hätten … Aber die haben wir nicht und mir fällt es mindestens genauso schwer wie dir, deiner Großmutter gegenüberzutreten.«
Verzweifelt umklammerte ich das Steuerrad und schloss in stummer Resignation meine Lider. Ich wusste, was mir bevorstand. Sie würde mir das Gefühl geben, versagt zu haben und damit nicht hinter dem Berg halten. Sie - meine Mutter, Sophie Vanderblant, Witwe des angesehenen, leider viel zu früh verstorbenen, Bankdirektors Jakob Vanderblant. Süße Wehmut befiel mich, als mir mein Vater in den Sinn kam. Er war der einzige Elternteil, mit dem ich meine wenigen, glücklichen Kindheitserinnerungen in Verbindung brachte.
Joan streichelte sacht meinen Rücken und rettete mich vor meinen düsteren Gedanken. »Komm schon Mama, so schlimm wird es nicht werden. Es ist ja nur vorübergehend, das schaffen wir auch noch.«
Ich öffnete wieder die Augen. Die tröstenden Wörter taten gut, denn diesmal würde ich hier nicht alleine sein. Mit einem gequälten Lächeln wandte ich mich meiner Tochter zu.
»Du hast Recht... wir werden uns so schnell wie möglich ein neues Leben aufbauen.« Ich holte tief Luft. »Nun, was wirst du zu deiner Großmutter sagen, die du noch nie gesehen hast?«
Joan zeigte mir ein freches Grinsen und glich dadurch noch mehr dieser Frau, vor deren Begegnung wir uns gegenseitig Mut zusprachen.
»Hallo Großmutter natürlich. Was bleibt mir sonst übrig?«
Wir stiegen aus und hievten unsere Existenz, die in vier Koffer und zwei Reisetaschen Platz gefunden hatte, aus dem Kofferraum. Ein flaues Gefühl im Magen, das mich mahnte, jemand beobachte uns, ließ mich über die Schulter zum Fenster neben dem Hauseingang schauen. Doch ich konnte niemanden dahinter entdecken. Wir schleppten unser Gepäck vor die Eingangstür und nach kurzem Zögern betätigte ich die Klingel. Mein Herz pochte und meine Handinnenflächen wurden feucht. Fahrig strich ich über den hellen Stoff meines schmalgeschnittenen Rocks und zog den Saum meines Blazers glatt. Aufatmend blickte ich zu Joan, die ihre toupierte Mähne noch mehr in erwünschte Unordnung brachte. Im selben Moment ging die Tür meines ehemaligen Zuhauses auf, doch zu meiner Überraschung, stand ich nicht meiner Mutter gegenüber, sondern einem großgewachsenen, wildfremden Mann.
Seine kräftigen Augenbrauen zogen sich mürrisch zusammen, indessen er mich unverhohlen musterte. Sekundenlang starrten wir uns gegenseitig stumm an. Trotz seines dichten dunklen Bartes waren seine markanten Gesichtszüge nicht zu übersehen, allerdings ebenso sein Unwille. Offensichtlich gefiel ihm nicht, was er sah. Wahrscheinlich gab er sich mit solchen Leuten wie mir ungern ab, denn unterschiedlicher hätte unser jeweiliger Kleidungsstil nicht sein können. Vermutlich stempelte er mich in dem teuren Designerkostüm, mit den elegant frisierten Wellen und den hohen Pfennigabsätzen als verzogenes, arrogantes Püppchen ab. Zugegebenermaßen steckte auch ich ihn gedanklich bereits, aufgrund seiner Erscheinung, in die Schublade der fanatisch müsliliebenden Naturschützer. Ich schätzte, dass er in etwa meinem Alter gleichkam, was bedeutete, dass er die Dreißig knapp überschritten haben musste. Allerdings schien ihn dies keineswegs davon abzuhalten, seine schwarzen Haare außergewöhnlich lang zu tragen und sie zu einem unachtsamen Pferdeschwanz im Nacken zusammenzubinden. Dies entsprach weder der momentanen Frisurenmode noch dem Anblick der Männer, in deren Umfeld ich mich die letzten Jahre bewegt hatte. Mein Exmann, Paul, wäre vermutlich auch nie auf die Idee gekommen, ein Jeanshemd, das voller Flecken und halb zerrissen war, außerhalb seiner Hose herumflattern zu lassen. Letztere sah an dem Fremden keinen Deut besser aus als sein Hemd und gab mir, dank zwei riesiger Löcher, noch einen unerwünschten Blick auf ein Paar beharrte Männerknie frei. Es war wahrlich ein Wunder, dass er keine Sandalen trug, sondern Turnschuhe, die entgegen meiner Erwartungen seine Füße vollständig verhüllten.
Wie kam es, dass solch ein abgerissener Typ im Haus meiner Mutter herumlungerte?
Ich wollte gerade den Mund aufmachen, als der Mann mir zuvorkam.
»Was wollen Sie? Und wer zum Teufel sind Sie überhaupt?«, fragte er barsch. Zugleich versperrte er uns den Eingang, indem er sich in legerer Haltung gegen den Türrahmen lehnte und die Hand nicht von der Klinke nahm.
Seine dunkelbraunen Augen glitzerten grimmig und aus reinem Trotz richtete ich mich zur vollen Größe auf.
»Ich bin Vivien Vanderblant und will zu meiner Mutter.« In all dem Hochmut, zu dem ich fähig war, hob ich eine meiner Augenbrauen an und ließ meinen Blick abschätzend über seine Gestalt gleiten. »Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Der Gärtner?«
In einem hämischen Lächeln entblößte er seine beachtlich weißen Zähne. »Sieht der Garten etwa danach aus, als ob ein Gärtner ihn pflegen würde?« Anscheinend erwartete er keine Antwort, denn mit einem Kopfschütteln verschränkte er die Arme vor der Brust und fuhr in seiner Rede fort. »Sie sind also Sophies Tochter, Vivien?« Abermals wanderte sein Blick über meine Kleider. Doch diesmal verriet auch die Tonlage seiner tiefen Stimme, dass er sich bereits ein Urteil über mich gebildet hatte, welches alles andere als freundlich ausfiel. »Das erklärt natürlich einiges.«
Nach dieser Unverschämtheit zog ich scharf die Luft ein und schüttelte meine braunen Wellen in einer erhabenen Geste über die Schultern. »Dürfte ich jetzt bitte meine Mutter sprechen, sie erwartet uns.«
Ein unechtes Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit. »Klar.«
Mit einem Kopfnicken deutete er ins Hausinnere und stieß gleichzeitig die Tür weiter auf, damit wir eintreten konnten. Tatenlos wartete er, bis Joan und ich unsere Koffer über die Schwelle gewuchtet hatten und verschloss dann die Haustür.
»Von mir aus könnt ihr euer Gepäck hier in der Diele stehen lassen. Dann braucht ihr es nicht allzu weit schleppen, wenn ihr gleich wieder verschwinden wollt.«
Joan und ich wechselten vielsagende Blicke. Auch sie war irritiert und fragte sich wahrscheinlich, wohin uns das alles führen sollte. Der große Fremde kehrte uns den Rücken zu und ließ uns einfach stehen. Offenbar ging er davon aus, dass wir ihm folgen würden. Noch während er den Flur entlangschritt, begann er, zu rufen: »Hey, Sophie, es ist tatsächlich deine Tochter. Du hattest recht, sie scheint ziemlich auf dich angewiesen zu sein.«
Verbissen schluckte ich die Wut hinunter, die in mir brodelte. Das Traurige war, dass ich das nicht zum ersten Mal zwischen diesen Wänden tat. Zu gut konnte ich mich an das ohnmächtige Gefühl erinnern, welches mich letztlich von hier fortgetrieben hatte. Und doch war ich wieder hier gelandet. Herzlich willkommen Zuhause, dachte ich zynisch.
Zögerlich schritten Joan und ich dem Unbekannten nach, der uns in seiner unhöflichen Art sogar seinen Namen verschwiegen hatte. Er führte uns den Gang entlang, direkt zur Wohnstube. Wenn man sechzehn Jahre in einem Haus gewohnt hatte, vergaß man dessen Raumaufteilung nicht so schnell. Besonders, wenn die Ausstattung und das Mobiliar noch genauso aussahen wie früher. Der Marmorboden schimmerte nach wie vor in dem sandfarbenen Beige, während es dieselben barocken Konsolen und Spiegel der Vergangenheit waren, die den Gang säumten. Dieser Umstand beflügelte mein Gedächtnis und ich konnte schon die gepolsterte Eckbank der Wohnstube vor mir sehen, auf der wir unsere täglichen Mahlzeiten eingenommen hatten. In diesem Raum hatte meine Mutter die Nachmittage mit Handarbeit oder Lesen verbracht, wenn sie nicht eine ihrer illustren Teegesellschaften im gegenüberliegenden Salon abhielt, der um einiges nobler eingerichtet war. In der gewöhnlichen Stube hingen keine großen, beeindruckenden Familienporträts der väterlichen Vanderblants oder mütterlichen Hohenröcks. Kein goldener, dreiarmiger Kerzenhalter würde hier auf einer Tafel zu finden sein. Lediglich ein kleines Stillleben zierte die Wände, welche von einer Tapete mit zartem Blumenmuster überzogen waren. Statt des Kandelabers dekorierte in der Stube eine Vase mit einem Strauß Strohblumen den kleinen Tisch, da war ich mir sicher. Sogar der Geruch, der im Haus in jeder Ecke waberte, war nach all den Jahren der gleiche. Es war eine Mischung aus der Holzmöbelpolitur und dem Parfüm meiner Mutter, einem süßen Veilchenduft. Der Knoten in meinem Magen wurde fester und dann war es soweit.
Der Fremde hatte die Stubentür aufgestoßen und war zur Seite getreten. Ich fand mich meiner Mutter von Angesicht zu Angesicht gegenüber.
Entsetzt hielt ich die Luft an. Denn diese alte, in sich zusammengesunkene Frau, die da vor mir in einem Sessel saß, hatte nur entfernt Ähnlichkeit mit meiner drakonischen Mutter, vor der ich in jungen Jahren geflüchtet war.