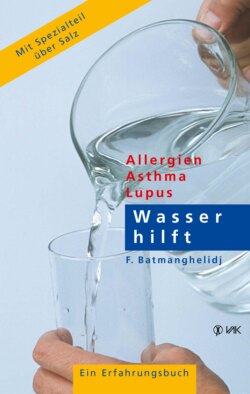Читать книгу Wasser hilft - F Batmanghelidj - Страница 12
Оглавление2
Asthma und Allergien
Der Atemvorgang
Um Asthma zu verstehen, muss man eine gewisse Vorstellung von der Anatomie der Lunge und der Brust haben. Die Abbildungen 1 bis 7 erklären die mechanischen Aspekte der Atmung. Darüber hinaus erkläre ich, wie die Luftmenge, die wir zum Atmen benötigen, durch eine unzureichende Wasserzufuhr beeinträchtigt wird.
Durchschnittlich atmen wir zwölfmal pro Minute und tauschen jedes Mal 500 Kubikzentimeter Luft aus. Der durchschnittliche Luftaustausch bei der normalen Atmung beträgt circa 6 000 Kubikzentimeter Luft pro Minute. Kurzatmige können bis zu fünfzigmal pro Minute atmen und dabei jeweils circa 3 000 bis 4 000 Kubikzentimeter einatmen – wenn ihre Luftwege offen sind. Sie können diese Luftaustauschfrequenz allerdings nicht sehr lange durchhalten. Die Physiologie der Ausatmung kann dabei nicht mithalten und die ausgetauschte Luftmenge sinkt drastisch.
Die nasalen Luftwege haben drei sehr wichtige Funktionen. Die Falten in der Mittelwand zwischen den beiden Durchgängen teilen den Luftstrom in drei Ströme auf jeder Seite mit engem Kontakt zur feuchten Schleimhaut. Dadurch wird die Luft feucht und auf eine angenehme Temperatur erwärmt; gleichzeitig werden gelöste Partikel herausgefiltert, die an der feuchten Oberfläche der Nasenschleimhaut haften bleiben.
Abbildung 1: Der Brustkorb enthält fünf Lungensegmente oder -lappen. Die beiden linken Lappen füllen die linke Seite des Brustkorbs aus. Die drei rechten Lappen, der obere, mittlere und untere Lappen, füllen den rechten Brustkorb aus. Die Lungen sind von der Brustwand durch eine dünne, seidige Membran, die Pleura (Brustfell), abgetrennt, wodurch sich die Lungenflügel ausdehnen und zusammenziehen können, ohne an der Brustwand zu haften. Das Herz liegt zwischen dem rechten und dem linken Lungenflügel, etwas mehr nach links.
Die Ausdehnung der Brust erzeugt ein Vakuum und zieht Luft in die Lungen
Abbildung 2: Der sozusagen auf dem Kopf stehende Bronchialbaum mit seinen kleineren Ästen – den Bronchiolen –, der sich nach unten und außen ausbreitet, dient als Gerüst für die unzähligen Alveolarsäckchen, in denen der Gasaustausch in der Lunge stattfindet. Von oben beginnend sorgen unterbrochene Knorpelringe für die feste, röhrenähnliche und gleichzeitig elastische Struktur und Form des Bronchialbaums. In seinen unteren Ausläufern bestehen die Bronchiolen aus knorpellosen Ringen weichen Muskel- und Fasergewebes. Bei Kindern sind die Luftröhren kleiner und der Knorpel ist weniger ausgeformt und fest. Deshalb können sich bei Kindern die Luftwege fester verschließen.
Abbildung 3: An den Bronchiolen sind die Alveolarsäckchen oder Alveolen befestigt. Sie ähneln Trauben, die mit ihren Stängelchen am Stängel festsitzen. In der Lunge sind diese Stängelchen und Stängel Luftröhren, durch die Luft in die Alveolen hinein- und wieder herausfließt. Bei Asthma ziehen sich die Bronchiolen zusammen und blockieren das Fließen der Luft nach oben und außen. Die Alveolarsäckchen bleiben übermäßig aufgeblasen. Stellen Sie sich statt Ihrer Lunge einmal Trauben vor, wobei die einzelnen Trauben der Lunge voller Luft anstelle von Saft sind. Wäre ihre Haut ausgetrocknet, würden sie einfallen und könnten ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Deshalb sind bei Wassermangel die Alveolarsäckchen übermäßig mit Luft gefüllt und von der Außenluft »abgeschottet«: So können sie ihre Form und Feuchtigkeit bewahren. Nur bei guter Durchfeuchtung sind die Alveolarsäckchen für den Luftaustausch offen.
Abbildung 4: Die Brusthöhle ist nach unten abgedichtet und von der Bauchhöhle durch ein muskuläres »Gewölbe«, das Zwerchfell, getrennt. Zieht sich diese Wölbung zusammen, so wird sie flacher und zieht die unteren Rippen mit nach unten. Gleichzeitig drückt sie den Bauchinhalt nach unten, wodurch mehr Platz in der Brusthöhle erzeugt wird. Durch das so entstandene Vakuum wird Luft in die Lungen gezogen. So also atmen wir Luft in die Lunge ein.
Benutzen wir nur das Zwerchfell zum Einsaugen der Luft in die Lungen, wird dieser Vorgang als Bauchatmung bezeichnet. Die Bauchatmung ist eine flache Atmung; die Lungen werden nicht vollständig mit Luft versorgt. Die Bauchmuskeln unterstützen hier die Atmung, indem sie sich entspannen, wenn das Zwerchfell den Bauchinhalt nach unten drückt.
Abbildung 5: Nach dem Gasaustausch und während des Herauspressens der Luft in den Lungen nach außen entspannt sich das Zwerchfell und erlangt seine gewölbeähnliche Form. Die unteren Rippen kehren in ihre Ruheposition zurück und der elastische Rückstoß der Lungen presst die mit Luft gefüllten Lungenflügel zusammen. Die Luft wird bis zum Ende des Ausatmungsvorgangs herausgedrückt. Bei ruhiger Atmung werden normalerweise circa 500 Kubikzentimeter der Gesamtkapazität der Lunge von circa 5500 Kubikzentimetern ausgetauscht.
Beim tiefen Atmen ist die Brustwand selbst beteiligt, indem sie sich aktiv ausdehnt und wieder zusammenzieht. Die Rippen werden nach oben gezogen, um den Brustraum zu vergrößern. Bei einer sehr tiefen Atmung beträgt die ausgetauschte Luftmenge circa 3 000 bis 3 500 Kubikzentimeter.
Abbildung 6: Die Bewegungen der Brustwand und des Zwerchfells reichen nicht aus, um die Luft gleichmäßig aus den Alveolen (Alveolarsäckchen) in der gesamten Lunge herauszupressen. In der Lunge gibt es unzählige Alveolarsäckchen. Jedes einzelne muss die beim Einatmen aufgenommene Luft wieder abgeben. Hier ist das Geheimnis: Beim Einatmen zieht das gleiche Vakuum, das die Luft einzieht, auch winzige Wassermoleküle in alle Alveolarsäckchen ein. Wassertröpfchen haben die natürliche Eigenschaft, sich gegenseitig anzuziehen. Sie kommen zusammen und formen größere Wassertropfen, welche die Innenwände der Alveolarsäckchen bilden.
Die Kraft, welche die Wassermoleküle zusammenzieht, wird als Oberflächenspannung des Wassers bezeichnet. Diese Kraft wirkt auch auf die Wände der Alveolarsäckchen und zwingt sie sich zusammenzuziehen, wenn die Wassermoleküle sich zusammenbinden. Die Kraft, die durch die Oberflächenspannung des Wassers in den Alveolarsäckchen erzeugt wird, trägt zu der Rückstoßkontraktion des Lungengewebes selbst bei und sorgt dafür, dass sich die Alveolarsäckchen gleichmäßig in der gesamten Lunge zusammenziehen und einen großen Teil der in ihnen enthaltenen Luft herauspressen.
Leistungssportler und Schwerkranke, die ums Überleben kämpfen, zeigen deutlich, wie sehr die Atmung beansprucht wird, so durch schweres Atmen oder starke Expansion und Kontraktion der Brust. Patienten mit solchen Atemproblemen werden heute in einem Sauerstoffzelt oder durch künstliche Sauerstoffzufuhr über einen Nasenschlauch versorgt, damit ihr Kampf um Sauerstoff sich verringert. Junge Sportler haben die größte Lungenkapazität.
Husten
Bei Husten, der bei Menschen mit Atmungsproblemen auftritt, werden sehr schnell circa zwei Liter Luft in die Lunge eingezogen; anschließend schließen sich die Stimmbänder und der Kehldeckel (Epiglottis) auf der Luftröhre sehr eng. Gleichzeitig ziehen sich die Bauchmuskeln und die Muskeln, welche die Rippen miteinander verbinden, kraftvoll zusammen und üben großen Druck auf die Luft in den Lungen aus. Dann öffnen sich schlagartig Stimmbänder und Kehldeckel weit, die Luft in der Lunge bricht heraus und jedes lose Partikel in der Bahn wird zu einem Projektil mit einer Geschwindigkeit von circa 120 bis 160 Kilometern pro Stunde.
Der Husten ist eine Art Reinigungsmechanismus des Lungengewebes, das sich in ständigem Kontakt mit Partikeln befindet, die in der durch die Nase eintretenden Atemluft gelöst sind. Bei Lungeninfektionen und Reizung der Luftröhren (Bronchus und Bronchiolen) wird der Hustenreflex ausgelöst und der Betreffende kann bis zur Erschöpfung husten. Diese Art des Hustens ist normalerweise trocken und kann sehr lästig werden. Asthmatiker haben gewöhnlich einen solchen trockenen Husten, kurz bevor ihre Atemnot und das Ringen um Luft offensichtlich werden. Es ist dieser anfängliche Husten, der als primärer Indikator eines bevorstehenden Asthmaanfalls erkannt werden sollte. Der Husten scheint durch den gleichen Prozess verursacht zu werden, der die Schleimsekretion zum Verstopfen der Bronchiolen anregt.