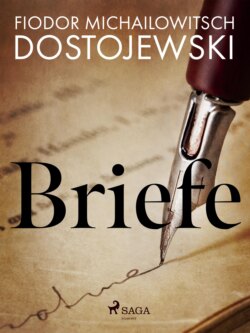Читать книгу Briefe - Fjodor M. Dostojewski - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XXI.
An den Bruder Michail, [Aus Omsk], den 22. Februar 1854
ОглавлениеEndlich kann ich mit dir etwas ausführlicher und, wie mir scheint, auf einem zuverlässigeren Wege sprechen. Bevor ich dir aber auch nur eine Zeile schreibe, muß ich dich fragen: sag' mir um Gottes willen, warum hast du mir bisher keine einzige Silbe geschrieben? Durfte ich denn das von dir erwarten? Glaube mir, in meiner einsamen und isolierten Lage verfiel ich einigemal in vollständige Verzweiflung, denn ich glaubte, du seist nicht mehr am Leben; ganze Nächte lang machte ich mir Gedanken, was wohl mit deinen Kindern werden wird, und ich verfluchte mein Schicksal, weil ich ihnen nicht helfen konnte. So oft ich aber hörte, daß du bestimmt am Leben bist, wurde ich wütend (dies kam aber nur in krankhaften Stunden vor, deren ich recht viel erlebt habe), und ich begann dir bittere Vorwürfe zu machen. Doch auch solche Zustände vergingen; ich entschuldigte dich, ich bemühte mich, Rechtfertigung für dich zu finden, beruhigte mich, so oft ich eine fand, und gab kein einziges Mal meinen Glauben an dich auf: ich weiß, daß du mich liebst und mich im guten Andenken bewahrst. Ich habe dir einen Brief durch unseren Stab geschrieben. Du hast ihn unbedingt bekommen müssen; ich habe von dir Antwort erwartet und keine bekommen. Hat man dir denn verboten, mir zu schreiben? Ich weiß aber, daß es erlaubt ist, denn ein jeder von den hiesigen politischen Sträflingen bekommt mehrere Briefe im Jahre. Auch Durow hat einige Briefe bekommen; wir fragten oft bei der Behörde an, wie es mit der Korrespondenz stehe, und man bestätigte uns, daß man wohl das Recht habe, Briefe zu schreiben. Mir scheint, ich habe den wahren Grund deines Schweigens erraten. Du warst zu faul, auf die Polizei zu gehen; und wenn du auch einmal hingegangen bist, so hast du dich wohl bei der ersten abschlägigen Antwort beruhigt, die dir irgendein Beamter, der den Sachverhalt nicht genau kennt, gegeben haben mag. Du hast mir dadurch viel egoistischen Kummer gemacht. Ich dachte mir: wenn er sich wegen eines Briefes nicht bemühen will, wird er sich doch sicher auch in irgendeiner wichtigeren Sache nicht bemühen wollen! Schreibe und antworte mir so schnell als möglich, schreibe mir, ohne eine Gelegenheit abzuwarten, offiziell, schreibe möglichst genau und ausführlich. Ich bin jetzt wie ein von einem Brotlaib abgeschnittenes Stück; ich möchte wieder anwachsen, kann es aber nicht. Les absents ont toujours tort. Sollte denn dieser Satz auch bei uns beiden stimmen? Sei aber unbesorgt, ich glaube an dich.
Es ist schon eine Woche vergangen, seit ich das Zuchthaus verlassen habe. Diesen Brief schicke ich dir streng geheim, sage niemandem nur eine Silbe davon. Ich werde dir übrigens auch noch einen offiziellen Brief durch den Stab des Sibirischen Armeekorps schicken. Aus den offiziellen Brief antworte mir sofort, auf diesen aber – bei der ersten passenden Gelegenheit. Du mußt übrigens auch im offiziellen Brief sehr ausführlich schreiben, was du in diesen vier Jahren erlebt hast. Was mich betrifft, so hätte ich dir gerne ganze Bände geschrieben. Da aber meine Zeit auch zu diesem Brief kaum ausreicht, werde ich dir nur das Wichtigste mitteilen.
Was ist das Wichtigste? Was war für mich in der letzten Zeit am wichtigsten? Wenn ich es mir überlege, komme ich zur Einsicht, daß dieser Brief auch für das Wichtigste viel zu wenig Raum bietet. Soll ich dir denn davon, was in meinem Kopfe vorgeht, was ich durchgedacht, was ich durchgemacht, was für Überzeugungen ich gewonnen und zu welchen Schlüssen ich gekommen bin, mitteilen? Ich kann diese Aufgabe gar nicht übernehmen. Eine solche Arbeit ist absolut unausführbar. Ich liebe es nicht, eine Arbeit nur halb zu tun; nur einiges sagen – hieße nichts sagen. Du hast jetzt übrigens meinen ausführlichen Bericht in Händen: lies ihn und entnimm ihm, was du willst. Es ist meine Pflicht, dir alles mitzuteilen, und darum beginne ich mit meinen Erinnerungen.
Weißt du noch, wie wir uns getrennt haben, du mein Teurer, Geliebter? Kaum warst du von mir fortgegangen, als man uns drei: Durow, Jastrschembskij und mich fortführte, um uns einzuschmieden. Genau um Mitternacht, d. h. am Weihnachtsabend (1849) wurden mir zum erstenmal Fesseln angelegt. Sie wogen etwa zehn Pfund und erschwerten außerordentlich das Gehen. Dann setzte man uns in offene Schlitten, einen jeden für sich mit einem Gendarmen, und so verließen wir auf vier Schlitten, der Feldjäger eröffnete den Zug, Petersburg. Mir war es schwer ums Herz, und die vielen verschiedenartigen Eindrücke erfüllten mich mit wirren und unbestimmten Gefühlen. Das Herz lebte noch von einer eigentümlichen Unruhe, und sein Schmerz war daher gedämpft. Doch die frische Luft wirkte auf mich belebend, und da man gewöhnlich vor einem jeden neuen Lebensabschnitt eine besondere Lebendigkeit und Rüstigkeit empfindet, so war ich im Grunde genommen durchaus ruhig. Ich betrachtete aufmerksam alle festlich erleuchteten Häuser von Petersburg und nahm von jedem einzelnen Abschied. Man führte uns an deiner Wohnung vorbei, und bei Krajewskij waren die Fenster festlich erleuchtet. Du hattest mir gesagt, daß es bei ihm eine Weihnachtsfeier und einen Christbaum geben würde, und daß deine Kinder mit Emilie Fjodorowna hingehen wollten; vor diesem Hause wurde mir entsetzlich traurig zumute. Ich nahm gleichsam Abschied von den Kinderchen. Sie taten mir so sehr leid, und selbst nach Jahren dachte ich an sie oft mit Tränen in den Augen. Man führte uns über Jaroslawl; nach drei oder vier Stationen machten wir beim ersten Morgengrauen in Schlüsselburg halt und kehrten in ein Wirtshaus ein. Wir tranken den Tee mit solcher Gier, als ob wir seit acht Tagen nichts genossen hätten. Nach den acht Monaten Gefängnis machten uns die sechzig Werst Schlittenfahrt einen Appetit, an den ich noch heute mit Freude denke.
Ich war in guter Laune, Durow plauderte ununterbrochen, und Jastrschembskij äußerte ungewöhnliche Befürchtungen über die Zukunft. Wir alle bemühten uns, unsern Feldjäger näher kennen zu lernen. Er war ein guter Alter, uns sehr freundlich gesinnt, ein Mann, der schon manches in seinem Leben gesehen hatte; er hatte schon ganz Europa mit Depeschen bereist. Unterwegs hat er uns viele Gefälligkeiten erwiesen. Er hieß Kusma Prokofjewitsch Prokofjew. Er ließ uns u. a. in einen geschlossenen Schlitten umsteigen, was uns sehr willkommen war, denn der Frost war fürchterlich.
Der zweite Tag war ein Feiertag; die Kutscher, die auf den verschiedenen Stationen abwechselten, trugen Mäntel aus grauem deutschem Tuch mit hellroten Gürteln; in den Dorfstraßen war kein Mensch zu sehen. Es war ein herrlicher Wintertag. Man führte uns durch die entlegeneren Teile des Petersburger, Nowgoroder und Jaroslawler Gouvernements. Es waren lauter unbedeutende Städtchen, in großem Abstande voneinander. Wir fuhren aber an einem Feiertag, und daher gab es überall genug zu essen und zu trinken. Die Fahrt war entsetzlich. Wir waren zwar warm gekleidet, doch saßen wir zehn Stunden ununterbrochen im Schlitten und hielten nur auf fünf bis sechs Stationen; es war fast unerträglich. Ich fror bis ans Herz und konnte mich in den warmen Zimmern der Stationen kaum wieder erwärmen. Merkwürdigerweise hatte ich mich bei dieser Fahrt vollständig erholt. In der Gegend von Perm hatten wir einmal nachts einen Frost von vierzig Grad. Das möchte ich dir nicht empfehlen. Es war recht unangenehm. Traurig war der Augenblick, als wir über den Ural fuhren. Die Pferde und die Schlitten versanken im Schnee. Ein Schneesturm wütete. Wir stiegen aus dem Schlitten – es war Nacht – und warteten stehend, bis man die Schlitten wieder herauszog. Um uns herum wütete der Schneesturm. Wir standen an der Grenze von Europa und Asien, vor uns lag Sibirien und die geheimnisvolle Zukunft; hinter uns – unsere ganze Vergangenheit; es war sehr traurig, Tränen traten mir in die Augen. Unterwegs strömten die Bauern aus allen Dörfern zusammen, um uns zu sehen; obgleich wir gefesselt waren, verdreifachte man für uns auf allen Stationen die Preise. Kusma Prokofjewitsch nahm die Hälfte unserer Auslagen auf seine Rechnung, so sehr wir uns auch dagegen sträubten; auf diese Weise hatte ein jeder von uns während der ganzen Reise nur fünfzehn Rubel Auslagen gehabt.
Am 12. Januar (1850) kamen wir nach Tobolsk. Nachdem man uns der Obrigkeit vorgestellt und durchsucht hatte, wobei man uns unser ganzes Geld abnahm, führte man mich, Durow und Jastrschembskij in eine eigene Zelle; die übrigen, Spjeschnjow usw., die vor uns angelangt waren, saßen in einer anderen Abteilung, und wir bekamen einander während der ganzen Zeit fast nicht zu sehen.
Ich hätte dir gerne ausführlicher über unsern sechstägigen Aufenthalt in Tobolsk und über die Eindrücke, die dieser Aufenthalt auf mich gemacht, berichtet. Hier reicht mir aber der Raum dazu nicht aus. Ich will dir nur sagen, daß die große Teilnahme und Sympathie, die uns dort entgegengebracht wurden, uns wie ein großes Glück für alles frühere entschädigt haben. Die Sträflinge aus der früheren Zeit (Anmerkung des Übersetzers: Die nach Sibirien verbannten Teilnehmer am Staatsstreich vom 14. Dezember 1825 (Dekabristen).) (vielmehr ihre Frauen) sorgten für uns wie für Verwandte. Diese herrlichen, in fünfundzwanzigjährigen Leiden und Selbstaufopferung erprobten Seelen! Wir bekamen sie nur flüchtig zu sehen, denn man hielt uns streng; sie schickten uns aber Kleider und Nahrungsmittel, trösteten und ermutigten uns. Ich hatte viel zu wenig Kleider mitgenommen und mußte es bereuen.
Sie schickten mir sogar Kleider. Schließlich verließen wir Tobolsk und kamen nach drei Tagen nach Omsk.
Schon in Tobolsk zog ich Erkundigungen über meine zukünftigen Vorgesetzten ein. Man sagte mir, daß der Kommandant ein sehr anständiger Mensch sei, dafür aber der Platzmajor Kriwzow eine ganz außergewöhnliche Canaille, ein kleinlicher Barbar, Trunkenbold, Schikaneur, kurz, das größte Scheusal, das man sich vorstellen kann. Gleich am Anfang nannte er uns beide, mich und Durow, Dummköpfe und versprach, uns beim ersten Vergehen körperlich züchtigen zu lassen. Er war bereits seit zwei Jahren Platzmajor und machte die schrecklichsten Gesetzlosigkeiten; nach zwei Jahren kam er dafür vors Gericht. Gott hatte mich vor ihm bewahrt. Er kam zu uns immer sinnlos betrunken (nüchtern habe ich ihn überhaupt nie gesehen), suchte sich irgendeinen nüchternen Sträfling aus und prügelte ihn, unter dem Vorwande, daß dieser betrunken sei. Manchmal kam er nachts zu uns und bestrafte irgend jemand, weil der Betreffende auf der linken und nicht auf der rechten Seite schlief, weil er im Schlafe sprach oder schrie, kurz, für alles, was ihm in seiner Betrunkenheit gerade einfiel. Mit einem solchen Menschen mußte ich also auskommen können, und dieser Mensch schrieb über uns monatliche Berichte nach Petersburg.
Die Zuchthäusler hatte ich noch in Tobolsk kennen gelernt; in Omsk machte ich mich bereit, mit ihnen vier Jahre Zusammenleben zu müssen. Es sind rohe, gereizte und erbitterte Menschen. Der Haß gegen den Adel ist grenzenlos; sie empfingen uns, die wir alle vom Adel sind, feindselig und mit Schadenfreude. Sie hätten uns am liebsten aufgefressen, wenn sie nur gekonnt hätten. Urteile übrigens selbst, in welcher Gefahr wir schwebten, da wir mit diesen Leuten einige Jahre lang zusammenleben, essen und schlafen mußten, und dabei nicht einmal die Möglichkeit hatten, uns wegen der uns ständig zugefügten Beleidigungen zu beschweren.
»Ihr Adelige habt eiserne Schnäbel, ihr habt uns zerhackt. Früher, als ihr Herren wart, habt ihr das Volk gepeinigt, und jetzt, wo es euch schlecht geht, wollt ihr unsere Brüder sein.«
Dieses Thema wurde vier Jahre lang behandelt. Hundertfünfzig Feinde wurden nicht müde, uns zu verfolgen; dies war ihr Vergnügen, ihre Zerstreuung, ihr Zeitvertreib; den einzigen Schutz gewährte uns unsere Gleichgültigkeit und moralische Überlegenheit, die sie anerkennen und ehren mußten; auch imponierte ihnen, daß wir uns ihrem Willen nicht fügen wollten. Sie waren sich stets bewußt, daß wir über ihnen standen. Von unsern Vergehen hatten sie nicht den geringsten Begriff. Wir schwiegen auch selbst darüber, und darum konnten wir einander nicht verstehen; wir mußten die ganze Rachsucht und den ganzen Haß, den sie gegen den Adel empfinden, über uns ergehen lassen. Wir hatten es da sehr schlecht. Das Militärzuchthaus ist viel ärger als das gewöhnliche.
Die ganzen vier Jahre verbrachte ich hinter den Kerkermauern und verließ das Gefängnis nur dann, wenn ich zur Zwangsarbeit hinausgeführt wurde. Die Arbeit war schwer, doch nicht immer; zuweilen verließen mich bei schlechtem Wetter, bei Regen, oder im Winter bei unerträglichem Frost meine Kräfte. Einmal mußte ich vier Stunden bei einer Extraarbeit verbringen, und zwar bei solchem Frost, daß das Quecksilber einfror; es waren vielleicht vierzig Grad unter Null. Ich hatte mir einen Fuß erfroren. Wir wohnten alle zusammen in einer Kaserne. Stelle dir einen alten, baufälligen hölzernen Bau vor, der schon längst abgebrochen werden soll und zu nichts taugt. Im Sommer ist es darin unerträglich heiß und im Winter unerträglich kalt. Alle Dielen sind verfault. Auf dem Fußboden liegt der Schmutz einige Zoll hoch, man kann jeden Augenblick ausgleiten und hinfallen. Die kleinen Fenster sind so eingefroren, daß man auch am Tage kaum lesen kann. Die Eisschicht auf den Fensterscheiben ist an die drei Zoll dick. Von den Decken tropft es, von allen Seiten zieht es. Wir sind zusammengepfercht wie die Heringe in einem Faß. Man heizt den Ofen mit sechs Holzscheiten; im Zimmer ist es dabei so kalt, daß das Eis nicht einmal auftaut; der Dunst ist unerträglich; und so geht es den ganzen Winter lang. In der gleichen Stube waschen die Sträflinge ihre Wäsche und machen dabei alles so naß, daß man sich gar nicht rühren kann. Von der Abenddämmerung bis zum Morgen ist es uns verboten, die Kaserne zu verlassen, die Kasernen werden versperrt; im Vorraum wird ein großer Holztrog zur Verrichtung der Notdurft aufgestellt, und man kann daher kaum atmen. Alle Zuchthäusler stinken wie die Schweine; sie sagen, daß sie nicht anders leben können, denn sie seien doch nur Menschen. Wir schliefen auf bloßen Brettern; einem jeden war nur ein Kopfkissen erlaubt. Wir bedeckten uns mit kurzen Halbpelzen, und die Füße blieben die ganze Nacht bloß. So froren wir ganze Nächte hindurch. Flöhe, Läuse und anderes Ungeziefer gab es Scheffel voll. Im Winter bekamen wir dünne Halbpelze, die gar nicht wärmten, und Stiefel mit niederen Schäften; so mußten wir in den Frost hinausgehen.
Zu essen bekamen wir Brot und eine Kohlsuppe; die Suppe mußte laut Vorschrift ein viertel Pfund Fleisch pro Kopf enthalten; man tat aber Hackfleisch hinein, und so bekam ich nie ein Stück Fleisch zu sehen. An Feiertagen bekamen wir einen Brei, doch fast ganz ohne Butter. An Fasttagen – Kohl und sonst nichts. Ich habe mir gründlich den Magen verdorben und hatte oft an schweren Verdauungsstörungen zu leiden.
Daraus kannst du selbst ersehen, daß man hier ohne Geld gar nicht leben kann; hätte ich kein Geld, so wäre ich ganz bestimmt zugrunde gegangen; kein einziger Sträfling könnte dieses Leben ertragen. Ein jeder tut aber irgendeine Arbeit, die er verkauft; und so verdient jeder Sträfling einige Pfennige. Manchmal trank ich Tee und kaufte mir ein eigenes Stück Fleisch; dies war meine Rettung. Sich des Rauchens zu enthalten war ganz unmöglich, denn sonst konnte man bei dem Gestank ersticken. Dies alles wurde hinter dem Rücken der Aufseher getan.
Ich lag oft krank im Spital. Meine Nerven waren so zerrüttet, daß ich einigemal epileptische Anfälle bekam; es kam übrigens ziemlich selten vor. Ich habe auch noch Rheumatismus in den Beinen. Abgesehen davon, fühle ich mich recht wohl. Denke dir noch zu allen diesen Annehmlichkeiten hinzu, daß es beinahe unmöglich war, sich ein Buch zu verschaffen, und wenn ich mir schon eines verschaffte, so mußte ich es heimlich lesen; ewige Feindseligkeit, Geschrei und Zank um mich herum; ständige Bewachung, die Unmöglichkeit, auch nur einen Augenblick für sich allein zu sein; und so ging es ohne Abwechslung vier Jahre lang; du wirst mir also glauben, wenn ich dir sage, daß es mir nicht gut ging. Denke dir außerdem die ewige Angst, mir irgendeine Bestrafung zuzuziehen, die Fesseln und die vollständige Unterdrückung des Geistes – dies ist das Bild meines Lebens.
Ich will dir gar nicht sagen, welche Wandlungen meine Seele, mein Glaube, mein Geist und mein Herz in diesen vier Jahren durchgemacht haben. Ich müßte lange erzählen. Doch die ewige Konzentration, die Flucht in mich selbst vor der bitteren Wirklichkeit, brachten ihre Früchte. Ich habe jetzt viele neue Bedürfnisse und Hoffnungen, an die ich früher nie gedacht habe. Dies sind aber für dich lauter Rätsel, und darum gehe ich daran vorüber. Ich will nur noch das eine sagen: vergiß mich nicht und hilf mir. Ich brauche Bücher und Geld. Schicke es mir, um Christi willen.
Omsk ist ein ekelhaftes Nest. Es gibt hier fast keine Bäume. Im Sommer – Hitze und Winde, welche Sandwolken mitbringen, im Winter – Schneestürme. Von der Natur habe ich fast nichts gesehen. Das Nest ist schmutzig, fast ausschließlich von Militär bewohnt und im höchsten Grade liederlich. Ich meine das einfache Volk. Hätte ich hier nicht einige Menschen gefunden, so wäre ich wohl gänzlich zugrunde gegangen. Konstantin Iwanowitsch Iwanow behandelt mich wie einen Bruder. Er hat für mich alles getan, was er nur konnte. Ich schulde ihm Geld. Wenn er einmal nach Petersburg kommt, bedanke dich bei ihm. Ich schulde ihm fünfundzwanzig Rubel. Womit kann ich aber seine Freundlichkeit bezahlen, seine ständige Bereitwilligkeit, jede meiner Bitten zu erfüllen, seine Aufmerksamkeit und seine Sorge um mich, wie um einen Bruder? Und er war nicht der einzige, dem ich dies alles zu verdanken habe. Bruder, es gibt sehr viel edle Menschen in der Welt.
Ich habe schon geschrieben, daß mich dein Schweigen oft quälte. Ich danke dir für die Geldsendung. In deinem nächsten Brief (wenn auch in einem offiziellen, denn ich weiß noch nicht, ob es mir jetzt möglich ist, mit dir zu korrespondieren) – in deinem nächsten Brief schreibe mir so ausführlich als möglich von allen deinen Angelegenheiten, von Emilie Fjodorowna, den Kindern, allen Verwandten und Bekannten, auch von denen in Moskau, wer lebt und wer gestorben ist, und von deinen Geschäften; schreibe mir auch, mit welchem Kapital du das Geschäft (Anmerkung des Übersetzers: M. M. Dostojewskij besaß um jene Zeit eine Tabak- und Zigarettenfabrik.) begonnen hast, ob es einträglich ist, ob du etwas besitzest, und schließlich, ob du mich mit Geld unterstützen, und wieviel du mir jährlich schicken kannst. Mit dem offiziellen Brief schicke mir aber kein Geld; höchstens, wenn ich keine Deckadresse finden sollte. Vorläufig gib auf allen Sendungen Michail Petrowitsch als Absender an (du verstehst doch?). Vorderhand habe ich aber noch Geld; dafür habe ich keine Bücher. Wenn es dir möglich ist, so schicke mir die Zeitschriften für dieses Jahr, wenigstens die »Vaterländischen Annalen«. Was ich aber unbedingt brauche, ist folgendes: ich brauche (sehr notwendig) ältere Historiker (in französischer Übersetzung), neuere Historiker: Guizot, Thierry, Thiers, Ranke usw., volkswirtschaftliche Werke und die Kirchenväter. Wähle die billigsten und kompaktesten Ausgaben aus. Schicke sie mir umgehend. Man hat mich nach Semipalatinsk, das beinahe in der kirgisischen Steppe liegt, kommandiert; die Adresse werde ich dir noch mitteilen. Hier ist sie übrigens für jeden Fall: »Semipalatinsk, Sibirisches Linienregiment, Bataillon Nr. 7, dem Gemeinen F. D.« Dies ist die offizielle Adresse. An diese Adresse schreibe mir deine Briefe. Doch für die Bücher werde ich dir eine andere mitteilen. Vorläufig schreibe mir aber als Michail Petrowitsch. Merke dir, daß ich vor allen Dingen ein deutsches Wörterbuch brauche.
Ich weiß nicht, was mich in Semipalatinsk erwartet. Der Dienst läßt mich ziemlich kalt. Was mir aber nicht gleichgültig ist: bemühe dich für mich, verwende dich für mich bei irgend jemand. Ob man mich nicht in einem Jahr oder in zwei Jahren nach dem Kaukasus versetzen kann? – dann wäre ich wenigstens im europäischen Rußland! Dies ist mein sehnlichster Wunsch, vergib es mir um Christi willen! Bruder, vergiß mich nicht! Ich schreibe dir und schalte und walte über alles, selbst über dein Vermögen. Mein Glaube an dich ist aber noch nicht erloschen. Du bist mein Bruder und du hast mich geliebt. Ich brauche Geld. Ich muß von irgend etwas leben, Bruder. Diese Jahre sollen nicht unnütz vergehen. Ich brauche Geld und Bücher. Was du für mich ausgibst, ist kein verlorenes Geld. Wenn du mir Geld gibst, wirst du damit deine Kinder nicht berauben. Wenn ich nur am Leben bleibe, werde ich dir alles mit Zinsen und Zinseszinsen zurückgeben. In sechs Jahren, vielleicht auch früher, werde ich ja sicher die Erlaubnis bekommen, meine Werke zu drucken. Es kann ja vieles anders werden, ich schreibe jetzt aber keinen Unsinn. Du wirst von mir noch hören.
Wir werden uns bald wiedersehen, Bruder. Ich glaube daran wie an das Einmaleins. In meiner Seele ist alles klar. Ich sehe meine ganze Zukunft und alles, was ich vollbringen werde, deutlich vor mir. Ich bin mit meinem Leben zufrieden. Ich fürchte nur Menschen und Willkür. Wie leicht kann ich zu einem Vorgesetzten geraten, der mich aus irgendeinem Grunde nicht leiden mag (es gibt solche!), der mich auf Schritt und Tritt verfolgen und mit dem strengen Dienst zugrunde richten wird; ich bin aber sehr schwach und selbstverständlich nicht imstande, die ganze Last des Soldatenlebens zu tragen. Man sagt mir zum Trost: »Dort sind lauter einfache Menschen.« Ich fürchte aber die einfachen Menschen mehr als die komplizierten. Menschen sind, übrigens, überall Menschen. Selbst unter den Raubmördern im Zuchthause habe ich in diesen vier Jahren Menschen kennen gelernt. Glaube mir, es gibt unter ihnen tiefe, starke und schöne Naturen, und es machte mir oft große Freude, unter einer rohen Hülle Gold zu finden. Und das war nicht ein einzelner Fall, auch nicht zwei, sondern mehrere Fälle. Die einen flößten Respekt ein, die anderen waren absolut schön. Ich habe einen jungen Tscherkessen (der wegen Raubmord nach Sibirien verschickt worden war) in der russischen Sprache und im Lesen unterrichtet. Wie dankbar war er mir! Ein anderer Zuchthäusler weinte, als ich von ihm Abschied nahm. Ich hatte ihm allerdings manchmal Geld gegeben, es war aber so wenig. Sein Dank dafür war aber grenzenlos. Mein Charakter ist inzwischen schlechter geworden; ich war im Umgange mit den Leuten launisch und ungeduldig. Sie nahmen Rücksicht auf meinen geistigen Zustand und ertrugen alles ohne zu murren. Apropos: wieviel volkstümliche Gestalten und Charaktere habe ich im Zuchthause kennen gelernt! Ich habe mich mit ihnen eingelebt, und glaube sie daher gut zu kennen. So viele Lebensläufe von Landstreichern und Räubern habe ich kennen gelernt, und überhaupt das ganze traurige Leben des gemeinen Volkes! Meine Zeit habe ich überhaupt nicht unnütz verbracht. Ich habe ja das russische Volk so gut kennen gelernt, wie es nur wenige kennen. Darauf bin ich etwas eitel. Ich hoffe, daß diese Eitelkeit verzeihlich ist.
Bruder! Schreibe mir unbedingt über alle wichtigsten Vorfälle in deinem Leben. Schicke die Briefe nach Semipalatinsk, und nichtoffiziell, wie du schon weißt. Schreibe mir von allen unseren Bekannten in Petersburg, von der Literatur (möglichst viel Einzelheiten) und schließlich von den Unsrigen in Moskau. Wie geht es unserem Bruder Kolja? Was macht (und das ist noch viel wichtiger) Schwester Sascha? Ist der Onkel noch am Leben? Was treibt Bruder Andrej? Ich schreibe der Tante durch Schwester Wera. Um Gottes willen, halte diesen Brief streng geheim und verbrenne ihn: du könntest durch ihn verschiedene Leute kompromittieren. Vergiß nicht, lieber Freund, mir Bücher zu schicken. Vor allen Dingen Geschichte und Volkswirtschaft, »Vaterländische Annalen«, Kirchenväter und Kirchengeschichte. Schicke mir die Bücher nicht alle auf einmal, doch sobald als möglich. Ich verfüge über dein Geld, als ob es mir gehörte; doch nur, weil mir deine gegenwärtige Lage unbekannt ist. Schreibe mir ausführlich über deine Verhältnisse, damit ich irgendeine Vorstellung darüber habe. Merk dir aber, Bruder: die Bücher sind mein Leben, meine Nahrung, meine Zukunft! Verlaß mich nicht, um Gottes willen. Bitte! Versuche doch die Erlaubnis zu bekommen, mir die Bücher auch ganz offiziell zu schicken. Sei übrigens vorsichtig. Wenn es auf dem offiziellen Wege geht, so schicke sie mir offiziell. Wenn es aber nicht geht, so schicke sie durch den Bruder Konstantin Iwanowitschs, an seine Adresse. Man wird sie mir übergeben. Konstantin Iwanowitsch kommt übrigens selbst in diesem Jahre nach Petersburg; er wird dir alles erzählen. Was er für eine Familie hat! Und was für eine Frau! Sie ist eine junge Dame, Tochter des Dekabristen Annenkow. Was für ein Herz, was für ein Gemüt, was haben sie alles durchmachen müssen!
Ich werde mich bemühen, mir in Semipalatinsk, wohin ich mich in acht Tagen begebe, eine neue Deckadresse zu verschaffen. Ich bin noch nicht ganz gesund, muß daher hier noch etwas bleiben. (Schicke mir den Koran und die » Critique de raison pure« von Kant), und wenn du die Möglichkeit haben wirst, mir etwa nichtoffiziell zu schicken, dann noch unbedingt Hegel; besonders aber Hegels »Geschichte der Philosophie«. Davon hängt meine ganze Zukunft ab. Um Gottes willen verwende dich für mich, daß man mich nach dem Kaukasus versetzt; suche von kundigen Menschen zu erfahren, ob man mir gestatten wird, meine Werke zu drucken, und auf welchem Wege ich um diese Genehmigung nachsuchen kann. Ich will in zwei oder drei Jahren um Erlaubnis nachsuchen. Ich bitte dich, mich so lange auszuhalten. Ohne Geld werde ich vom Soldatenleben erdrückt werden. Also bitte!
Vielleicht werden mich im Anfang auch die andern Verwandten irgendwie unterstützen? In diesem Falle möchten sie das Geld dir einhändigen, und du sollst es mir schicken. In meinen Briefen an die Tante und an Wera bitte ich sie übrigens nie um Geld. Sie können es selbst erraten, wenn sie überhaupt an mich denken.
Filippow schenkte mir vor seiner Abreise nach Sebastopol fünfundzwanzig Rubel. Er ließ sie beim Kommandanten Nabokow zurück, und ich wußte nichts davon. Er glaubte, daß ich kein Geld hätte. Eine gute Seele! Alle Unsrigen leben in der Verbannung nicht schlecht. Toll hat die Strafe abgebüßt und lebt jetzt recht ordentlich in Tomsk. Jastrschembskij ist in Tara, seine Zeit geht eben zu Ende. Spjeschnjow ist im Irkutsker Gouvernement; er hat dort allgemeine Liebe und Achtung gewonnen. Ein merkwürdiges Schicksal hat dieser Mensch! Wo und unter welchen Umständen er auch erscheint, überall bringen ihm selbst die unzugänglichsten Menschen Ehrfurcht und Achtung entgegen. Petraschewskij ist nach wie vor nicht bei Sinnen; Mombelli und Lwow sind gesund; der arme Grigorjew hat gänzlich den Verstand verloren und befindet sich im Spital. Und wie geht es bei euch? Siehst du noch manchmal Frau Pleschtschejew? Was macht ihr Sohn? Von Sträflingen, die auf der Durchreise hier waren, habe ich gehört, daß er am Leben ist und sich in der Festung von Orsk befindet; Golowinskij soll längst auf dem Kaukasus sein. Was macht deine Literatur und dein Interesse für die Literatur? Schreibst du etwas? Was macht Krajewskij, und wie sind deine Beziehungen zu ihm? Ostrowskij gefällt mir nicht, von Pissemskij habe ich nichts gelesen, vor Druschinin habe ich Ekel. Eugenie Tur hat mich entzückt. Auch Krestowskij gefällt mir.
Ich hätte dir gern noch viel mehr geschrieben, es ist aber inzwischen so viel Zeit vergangen, daß mir auch dieser Brief Schwierigkeiten macht. Es kann ja nicht sein, daß sich unser Verhältnis irgendwie verändert haben soll. Küsse deine Kinder. Können sie sich noch an Onkel Fedja erinnern? Grüße alle Bekannte; halte aber diesen Brief streng geheim. Leb wohl, leb wohl, mein Teurer! Du wirst noch von mir hören und mich vielleicht auch sehen. Ja, wir werden uns ganz bestimmt wiedersehen! Lebe wohl. Lies aufmerksam alles, was ich dir schreibe. Schreibe mir möglichst oft (wenn auch offiziell). Ich umarme dich und alle Deinigen unzähligemal.
Dein Dostojewskij.
P. S. Hast du meine Kindergeschichte (Anmerkung des Übersetzers: Gemeint ist »Der kleine Held«. Diese Erzählung erschien erst im Jahre 1857 in den »Vaterländischen Annalen«, unter dem Pseudonym M-ij.), die ich in der Festung geschrieben habe, erhalten? Wenn sie in deinen Händen ist, so fange damit nichts an und zeige sie niemand. Wer ist Tschernow, der im Jahre 1850 einen »Doppelgänger« geschrieben hat?
Auf Wiedersehen!
Dein Dostojewskij.