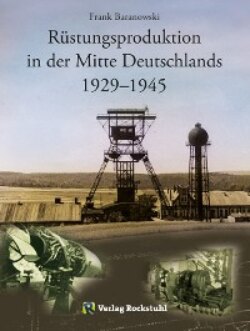Читать книгу Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929 – 1945 - Frank Baranowski - Страница 13
Die systematische Erfassung von Rüstungsbetrieben durch die Reichswehr
ОглавлениеDie Voraussetzungen einer ungleichartigen rüstungskonjunkturellen Entwicklung in beiden Gebieten schuf die Reichswehr bereits Anfang der 1920er Jahre, indem sie insgeheim und hinter dem Rücken der Reichsregierung, getarnt als „Organisations-Kriegsspiel“,1 Wiederaufrüstungspläne schmiedete, sie in den Folgejahren zielstrebig weiter betrieb und mit finanziellen Mitteln, teils aus „schwarzen Kassen“, Einfluss auf die Rüstungsforschung wie auch die materielle Rüstung nahm. Eines der Hauptziele der Alliierten nach Ende des Ersten Weltkrieges hatte darin bestanden, Deutschlands „potentiel de guerre“ zu vernichten. Dem Reich wurde im Versailler Vertrag auferlegt, die Produktion von Rüstungsgütern gen Null zu fahren. Soweit eine Herstellung von Waffen, Munition und Kriegsgerät in Deutschland in geringem Umfang noch möglich blieb, wurde sie auf wenige von den Alliierten zu genehmigende Fabriken begrenzt. Alle anderen Anlagen zur Anfertigung, Lagerung, Herrichtung oder Konstruktion von kriegsverwendbarem Material mussten innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Inkrafttreten des Vertrages geschlossen werden. „Für die Anfertigung von Kriegsgerät bestimmte Werkzeuge und Maschinen“ waren – bis auf den geringen Bedarf der wenigen zugelassenen Firmen – an die Alliierten abzugeben oder zu vernichten.2
Selbst die noch zugestandene Rüstungsproduktion unterlag erheblichen Restriktionen. Die Herstellung bestimmter Waffen und Kampfmittel, etwa von Panzern, Flugzeugen, schweren Geschützen und Gaskampfstoffen, war gänzlich verboten. Weder durften jährliche „Höchstfertigungszahlen“ überschritten noch Kriegsmaterial aus dem Ausland importiert werden. Besonders einschneidend wirkte sich für die deutsche Industrie das Verbot der Ausfuhr von Rüstungsgütern aus, entfiel so doch die Möglichkeit, unter dem Deckmantel von Exporten wichtige Betriebsmittel und Einrichtungen vor der Demontage oder Vernichtung zu retten.3 Um die Einhaltung der Beschränkungen ständig zu überwachen, hatten die Siegermächte eine Interalliierte Militär-Kontroll-Kommission (IMKK) zusammengestellt, die befugt war, sich jederzeit frei im Land zu bewegen.4 Angesichts der massiven Kontrolle der IMKK blieb dem Gros der Rüstungslieferanten des Ersten Weltkrieges zunächst nichts anderes übrig, als ihre Produktion auf zivile Güter umzustellen. Zur Umgehung dieser Begrenzungen durch den Versailler Vertrag versuchten jedoch größere Unternehmen wie Rheinmetall und Zeiss, zumindest Teile ihrer Rüstungskapazitäten ins neutrale Ausland zu verlagern, vor allem nach Österreich und in die Niederlande. Soweit das in geringem Umfang möglich war, geschah es zumeist über die Gründung von Tochterunternehmen im Ausland oder mittelbar über die Beteiligung an ausländischen Firmen.5
Mehr noch als die Industrie war die Reichswehr selbst von den Bestimmungen des Versailler Vertrages existenziell betroffen. Er legte die Stärke des Heeres auf 100.000 Mann, der Marine auf 15.000 Mann fest. Bis ins Detail wurde die Gliederung der künftigen deutschen Streitkräfte vorgeschrieben. Bewaffnung, Ausrüstung und Munitionsbestände durften ein bestimmtes Soll nicht überschreiten, der Besitz von schweren Geschützen, Panzern, Flugzeugen und Gaskampfstoffen wurde völlig untersagt.6 Die Reichswehroffiziere waren nicht gewillt, diesen Zustand auf Dauer hinzunehmen. Sie gingen davon aus, dass die Maßnahmen des Versailler Vertrages lediglich temporären Charakter hätten und am Ende nur die Restauration der Monarchie und die Wiederherstellung der privilegierten Stellung des Militärs stehen könne. General von Seeckt, seit Juli 1919 Chef des Truppenamtes, de facto des Generalstabes der Reichswehr, hatte auf der Konferenz von Spa im Juli 1920 erfolglos versucht, durch Zugeständnisse den Alliierten wenigstens ein 200.000-Mann-Heer abzuringen. Noch am Tag seiner Rückkehr aus Spa, dem 10. Juli 1920, legte er, nunmehr Chef der Heeresleitung, in einem Bericht den Offizieren im Reichswehrministerium die Vergeblichkeit seiner Mission angesichts der alliierten Unnachgiebigkeit dar.7 Anfang 1921 sah von Seeckt zwei Möglichkeiten, eine Revision der Rüstungsbeschränkungen zu erreichen, zum einen die Milderung der Vertragsbedingungen durch Konzessionen der Alliierten, zum anderen die einseitige Aufkündigung des Vertrages durch Deutschland, sobald die Kräftekonstellation dies ermögliche.8 Nach seinen Erfahrungen vom Juli 1920 dürfte von Seeckt keine Erwartungen auf erneute Verhandlungen gerichtet haben. Vielmehr regte er zu dem Zeitpunkt den Aufbau eines 63 Divisionen starken Heeres an und schlug den Umbau der Reichswehr zum „Führerheer“ vor. Flankierend forderte von Seeckt, sich mit der Industrie in Verbindung zu setzen, um „zur Verteidigung in jedem Zeitabschnitt die Mittel zu gewinnen“ und „die technische Überlegenheit zu erreichen“.9
Am 15. Juli 1921 hatte die IMKK 30 Betrieben die Zulassung zur Rüstungsproduktion erteilt; 1927 erweiterten die Siegermächte den Kreis um drei Unternehmen.10 Autorisierte Firmen waren u. a. der Krupp-Konzern und die Vereinigte Stahlwerke AG für die Erzeugung von Geschützrohren und Panzerplatten. Die Sprengstoffherstellung und die Entwicklung neuer Sprengstoffe waren für die Dynamit-Nobel AG und die Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff AG (WASAG) genehmigt. Simson & Co. in Suhl besaß als einziges Unternehmen die Zulassung für die Fabrikation von Handfeuer- und Maschinenwaffen. Elektrische Geräte, Scheinwerfer und Kommandogeräte wurden von der Siemens-Schuckert AG produziert. Die Entwicklung von Nachrichtengeräten konzentrierte sich bei Telefunken und bei der Lorenz AG. Carl Zeiss Jena entwickelte und lieferte optische Vorrichtungen für das Heer und die Marine. Auch die Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik AG (Rheinmetall) und die Borsig AG waren als Rüstungsproduzenten zugelassen.11 Die Gebrüder Thiel-Seebach GmbH in Ruhla lieferte Granatzünder.12 Obwohl die genannten Firmen damit die Produktion der ihnen zugewiesenen Rüstungsgüter wieder hätten aufnehmen können, unterblieb das zunächst, weil es die Reichsregierung wegen der „innerpolitischen Spannungen und […] der pazifistischen Einstellung der Masse der Arbeiterschaft“ untersagte.13 Erst nach den Unruhen in Bayern hob das Kabinett im Mai 1924 das Verbot auf. Bis die Betriebe die ihnen erlaubte Produktion wieder aufgenommen hatten, vergingen weitere Monate, teilweise Jahre.14
In Fortsetzung seiner revisionistischen Ziele hatte Hans von Seeckt Ende 1923 die Planungsaufgabe für ein Kriegsheer von 2,8 Millionen Mann gestellt. Neben 63 Felddivisionen und 39 Grenzschutzdivisionen sowie fünf Kavelleriedivisionen waren Ersatztruppen (450.000), Heerestruppen – also Ergänzungstruppen (395.000) – und Luftstreitkräfte (154.000) vorgesehen.15 Ein erster Entwurf lag bereits im Dezember 1923 vor und wurde von den Mitarbeitern des Truppenamtes in den folgenden Jahren weiter überarbeitet und modifiziert. Dieser „Große Plan“ war eine detaillierte Beschreibung der Reichswehr in einem unterstellten Kriegsfall, untergliedert nach Kommandobehörden, Infanterie, Kavallerie, Artillerie und Luftstreitkräfte.16 Schnell stellte sich heraus, dass sich das Konzept mittelfristig nicht nur wegen fehlender finanzieller Mittel nicht durchsetzen ließ. Im Juni 1925 führte der Nachschubstab des Heereswaffenamtes (Deckname „Andreas“) eine „Prüfung der praktischen Durchführbarkeit des Kriegsorganisationsplanes“ durch. In der Stellungnahme des zuständigen Sachbearbeiters heißt es, dass der „Gedanke, mit Hilfe von Kriegsspielen die Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit der Rüstungsarbeiten, Mobilmachungsvorarbeiten und Mobilmachungsarbeiten nach Umfang und Aufbau zu prüfen“, begrüßenswert sei. Er regte an, im Rahmen dieses „Kriegsspiel-Beispiels“ die Verteilung der Rüstung (d. h. der entsprechenden Produktionsaufträge) auf die Fabriken und die Auslandsbeschaffungen zu klären sowie Entwürfe für die materielle Mobilmachung durch Umstellung der Industrie zu Kriegszwecken und die Auftragserteilung an die Fabriken zu erstellen. Als erster Schritt müsse festgestellt werden, was in den heimischen Fabriken in dem vorgesehenen Zeitraum produziert werden könne.
Eine solche Erfassung gestalte sich allerdings als sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. So seien, „veranlasst durch das Versailler Diktat […] in den letzten Jahren enorme Zerstörungen und vielfache Zerstreuungen der Produktionsmittel in Deutschland vorgenommen worden“. Hierdurch hätten sich die Fertigungsmöglichkeiten wesentlich geändert. Statische Angaben, soweit sie nicht aus jüngster Zeit stammen, seien daher wertlos. Erschwert werde dies dadurch, dass die betroffenen Firmen aus Gründen der Konkurrenz und Anwesenheit der IMKK nur sehr ungern Einblick in ihre Produktionsverhältnisse gäben. Damit fehle dem ‚Spiel‘ augenblicklich die wichtigste Grundlage. „Diese Mängel in Fabrikenkenntnis und Organisation werden ganz gleich, ob für Rüstungshauptzeit, Kriegszeit, Ausgangslage, ‚Einlagen‘ immer wieder hervortreten. Ohne genaue Kenntnis der Leistungsfähigkeit der Industrie und ohne fertige Spitzenorganisationen bleibt jedes derartige Kriegsspiel Fantasie“. Ebenso wurden Zweifel an der Kriegsorganisation in der bis dahin vorgeschlagenen Form erhoben, die sich „noch nicht als Gebäude für ein Kriegsspiel“ eigne. So seien in der Spitzenorganisation noch grundsätzliche Fragen unentschieden und der weitere Ausbau unfertig.17
Dennoch ließ das Militär keinen Zweifel daran, dass „jedes Liebäugeln mit der Möglichkeit einer friedensmäßigen Heereserweiterung […] im Sinne unserer Arbeiten ebenso Utopie wie das Liebäugeln mit der schwindenden Größe der alten Armee“ sei.18 Bis 1924 unterhielten die einzelnen Beschaffungsabteilungen des Waffenamtes unterschiedlich intensive Beziehungen zu den Rüstungsproduzenten, und völlig unkoordiniert waren auch die Waffenkäufe, die sie dort tätigten. Das führte zum Teil zu chaotischen Zuständen bei der Ausrüstung. Zur Abhilfe wurden im November 1924 die einzelnen Fachabteilungen dem Nachschubstab des Waffenamtes untergeordnet, der zwei Aufgaben hatte. In einem ersten Schritt sollte er den rüstungswirtschaftlichen Ist-Stand ermitteln und fortlaufend Unterlagen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie liefern, um so Mobilmachungspläne auf eine wirtschaftliche Grundlage zu stellen. In einem zweiten Schritt sollte der Nachschubstab Kontakt mit weiteren Betrieben aufnehmen, die zur planmäßigen Vorbereitung auf den Kriegsfall geeignet erschienen.19 Auf der Basis der Firmenliste vom Dezember 1924 entstand eine erste Bedarfsplanung in Form von 36 Deutschlandkarten, in denen in „Innerdeutschland“ heranzuziehende Firmen verzeichnet waren.20 Schon in dieser Aufstellung ist eine Struktur beabsichtigter Rüstungszentren erkennbar. Nach diesen frühen Planungen sollten 45 % des Bedarfs an Optischen Gerät in Jena, 25 % in Berlin produziert werden, und etwa drei Viertel des Gesamtbedarfs an Patronenhülsen aus Magdeburg (45 %), Berlin (28 %), Nürnberg (12 %) und Hannover (7 %) stammen. Die Herstellung von Pistolen war zentral in Sömmerda (28 %) und Berlin (68 %) vorgesehen. Die Werke der chemischen Industrie und der Sprengstoffherstellung waren desgleichen für wenige Standorte bestimmt.21 Die Festlegungen dieser Kartendarstellungen waren jedoch nur von begrenzter Aussagekraft, denn sie beruhten zum Teil noch auf Daten, die das Waffen- und Munitions-Beschaffungs-Amt (Wumba) in der Spätphase des Ersten Weltkrieges erhoben hatte.22
Im September 1925 ergänzte der Nachschubstab seine Aufrüstungspläne um ein „Rüstungshandbuch für die industrielle Mobilisierung“, das die Grundlagen der materiellen Rüstung der Reichswehr umriss.23 In Abkehr von der militärischen Praxis des Ersten Weltkriegs ließ sich der Nachschubstab von drei Grundannahmen leiten. Erstens: Das deutsche Militär dürfe lediglich Bestände an Waffen halten, die nicht im Entferntesten für den Kriegsfall ausreichten. Zweitens: Da Rüstungsgüter ohnehin rasch veralten, sei es sinnlos, sie illegal in großem Stil zu horten. Drittens: Bei Ausbruch eines Krieges werde „ein zusammengeballter Massenbedarf an allem was eine Wehrmacht brauche, eintreten“. Deshalb könne die von der Reichswehr anzustrebende materielle Rüstung nicht in Form einer illegalen oder legalen Beschaffung von Material für einen Krieg geschehen, sondern müsse sich auf die Vorbereitung der Industrie auf eine Massenfertigung von Rüstungsgütern konzentrieren. Diese fortan als „fabrikatorische Vorbereitung“ laufenden Maßnahmen boten neben niedrigeren Kosten den Vorteil einfacher Tarnung.24
Die Abkehr von einer Bevorratung war eine Innovation, die aus den Zwängen des Versailler Vertrages heraus geboren wurde und eine Modernisierung der Reichswehr zu einer Verteidigungsarmee bedeutete.25 Da die Reichswehr mit einem schnellen Eindringen der Alliierten in die Grenzregionen rechnete, waren die Planungen des Nachschubstabes zunächst auf ein als „Rumpf-“ oder „Innerdeutschland“ bezeichnetes Gebiet beschränkt, das im Osten in etwa durch die Oder, im Westen durch die Weser, im Süden durch eine Linie Kassel – Würzburg – Ulm begrenzt war.26 Um diese „fabrikatorische Vorbereitung“ sicherzustellen, bildeten unter Federführung des Heereswaffenamtes national eingestellte Industrielle Ende Dezember 1925/Anfang Januar 1926 ein Kontaktgremium, die „Statistische Gesellschaft“,27 eine „Vereinigung gemeinnütziger Natur mit der Aufgabe, statistische und technische Feststellungen für Interessenten durchzuführen“.28 Diese als „Stega“ getarnte Organisation hatte die Funktion, die Produktionsmöglichkeiten „Innerdeutschlands“ zu erfassen und Kontakte zu den vom Waffenamt bis dahin noch nicht einbezogenen Unternehmen zu knüpfen.29 Schnell zeigte sich, dass die vor allem nebenamtlich tätigen Regionalkommissare mit der Aufgabe überfordert waren. Um den zeitraubenden Umweg über die „Stega“ zu verkürzen, stellten die Wehrkreiskommandos 1926 sogenannte „Wirtschaftsoffiziere“ (WO) als Regionalbeauftragte des Nachschubstabes ein, die ohne formelle Genehmigung der Reichsregierung und hinter deren Rücken die Erkundungstätigkeiten übernahmen.30
Diese zwischen offiziell und offiziös angesiedelten Planungs- und Erkundungsmaßnahmen geschahen in einem Umfeld allgemeiner Verstöße der Reichswehr gegen die Versailler Verträge. So war es Teilen der Reichswehr ungeachtet der Kontrolle der IMKK gelungen, große Mengen an Kriegsmaterial von Bildgeräten bis zu Maschinengewehren zu horten und damit dem Zugriff der Alliierten zu entziehen.31 Eines dieser ‚schwarzen‘ Waffenlager befand sich in Hannover, wie sich aus einem als Verschlusssache eingestuften Untersuchungsbericht vom 11. Mai 1923 ergibt.32 Bereits Ende Oktober 1920 war es den alliierten Beobachtern gelungen, einen Fall der illegalen Entziehung von Kriegsgerät aufzudecken. Doch dies war nur die Spitze eines Eisberges; immer wieder musste das Reichswehrministerium, das Sanktionen befürchtete, vor derartigen Verstößen warnen. So hatte der Chef der Heeresleitung in einem Rundschreiben vom 28. Oktober 1928 Anlass, seine untergeordneten Stellen zu ‚Vertragstreue‘ zu ermahnen: „Ein im Flugwesen früher tätig gewordener Kommandeur hat eine Anzahl optischer Instrumente bei einer Privatfirma untergebracht und dadurch dem Zugriff der Entente entziehen wollen. Schon wenige Tage später sind die Instrumente von einer Ententekommission aufgefunden und beschlagnahmt worden“. Weiter heißt es: „Die Reichsregierung gerät durch derartige Eigenmächtigkeiten einzelner Offiziere in die schwierige Lage, da ihr von Seiten der Entente immer größeres Misstrauen entgegengebracht wird“.33
Zur Reparatur und möglicherweise auch zur Auffüllung des vorhandenen Bestandes hatte sich die Reichswehr ein engmaschiges Netz an illegalen Zulieferern geschaffen. Ein erst jetzt aufgefundener Bestand im Militärarchiv Freiburg verdeutlicht den tatsächlichen – bislang weit unterschätzten – Umfang. Er weist über 120 Unternehmen aus, die Mitte der 1920er Jahre allein für Luftwaffenzwecke arbeiteten. Darunter die Adler GmbH aus Hannover, die Schußzähler herstellte. Die Hannoversche Waggonfabrik lieferte Zubehörteile für Maschinengewehre, die von der Firma Hermann Weihrauch in Zella montiert wurden. Die Schweriner Fokker-Werke stellten Panzerungen und die Berliner Stahlwerk Becker AG Übungsgeschosse her. Durchladehebel kamen vom Hessenwerk in Kassel.34 August Blödner aus Gotha stellte Drehkräne her. Patronengurte bezog die Reichswehr bei der Berliner Firma Gotthold & Hoppe. Dies stellt nur einen kleinen Ausschnitt der Unternehmen dar, die trotz Anwesenheit der IMKK im Lande und des Risikos der Aufdeckung Rüstungsaufträge ausführten.35 Seit 1925 belegte die Reichswehr zur Tarnung vor den Alliierten die Betriebe, die die Rüstungsproduktion wieder aufgenommen hatten, mit Produktionskennzeichen, Buchstaben- oder Zahlenkombinationen, die bis 1936 ihre Gültigkeit behielten.36 Obwohl die illegalen Rüstungsmaßnahmen unter strengster Geheimhaltung stattfanden, häuften sich im Sommer 1926 die Meldungen über die Existenz einer „schwarzen Reichswehr“. Am 6. Dezember 1926 legte die SPD der Reichsregierung umfangreiche Materialien zur illegalen Rüstungstätigkeit der Reichswehr vor, die die Kooperation mit der Roten Armee offenbarten und in Ansätzen den Rückkauf von Spezialmaschinen, die entsprechend der Anordnungen der IMKK in alle Winde zerstreut waren, belegten.37
Nach dem Sturz Seeckts Ende Oktober 1926 vollzog sich in der Generalität, nicht zuletzt auch wegen des politischen Drucks, ein Sinneswandel. Die Reichswehr erkannte, dass sich ihre bereits seit Anfang der 1920er Jahre in Grundzügen festgelegte Revisionspolitik ohne die Hilfe – d. h. die finanzielle Unterstützung durch die Reichsregierung – nicht weiter vorantreiben ließ. Im November 1926 beklagte der damalige Oberst Joachim von Stülpnagel in einen Brief an Oberst von Falkenhausen, „dass wir in den Fragen der Landesverteidigung seit Jahren nicht vorwärts kommen, nur weil S.[eeckt] nicht dazu zu bewegen war, einmal mit der Regierung offen alle diese Dinge zu besprechen“.38 Im Februar 1927 informierte Generalleutnant Wilhelm Heye, der neue Chef der Heeresleitung, das Kabinett Marx in großen Zügen über den Stand der geheimen Vorarbeiten zur Mobilmachung, doch Einzelheiten über die materiellen Rüstungsmaßnahmen kamen dabei nicht zur Sprache.39 Heye erklärte weiter, er halte die Vorbereitung einer „gewissen“ Verteidigung für notwendig und im Osten auch für durchführbar. Von den Planungen eines Angriffskrieges, an dem die Reichswehr weiterhin festhielt, war freilich keine Rede.40
Am 19. Mai 1927 verlangte das Truppenamt von den Ämtern des Reichswehrministeriums eine Bestandsaufnahme aller ‚Mobilmachungsvorarbeiten‘. Zur Begründung heißt es: „Voraussetzung für eine planmäßige Gesamtrüstung, innerhalb derer alle einzelnen Rüstungsvorhaben sachlich und zeitlich in Übereinstimmung stehen, ist die Aufstellung eines Rüstungsprogramms und einer Dringlichkeitsliste mit dem Endziel: Bereitstellung bzw. Sicherstellung des Bedarfs der […] vorläufig festgelegten Land- und Luftmacht (21 Divisionen-Programm + entsprechende Luftmacht). […] Die Aufstellung eines in allen Einzelheiten zahlenmäßig vollständigen Rüstungsprogramms ist zur Zeit auf einer Reihe von Gebieten nicht möglich“. Zunächst müsse der äußere Rahmen festgelegt werden. Daher benötige das Technische Amt „eine Zusammenstellung sämtlicher zur Zeit laufenden oder beabsichtigten Vorhaben auf allen Gebieten der personellen und materiellen Rüstung“.41 Das Waffenamt arbeitete in den kommenden Monaten ein Programm für die Beschaffung, Verwaltung und Instandsetzung des Anfangs- und Nachschubbedarfs des „A-Heeres“ (= Aufstellungsheer) aus. Als Ziel der wirtschaftlichen Vorarbeiten sah es die Sicherstellung des dringlichsten monatlichen Nachschubbedarfs in den ersten fünf Kriegsmonaten für Heer, Marine und Luftstreitkräfte vor. Noch bevor diese Planungen zum Rüstungsprogramm abgeschlossen waren, ging das Waffenamt daran, in verstärktem Maß Aufträge an die Industrie zu vergeben, die allein 1927 einen Wert von 70 Millionen RM erreichten.
Schnell zeichnete sich ab, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht für die Ausstattung des geplanten 21-Divisionen-Notheeres ausreichten. Im Februar 1928 verminderte das Truppenamt das „A-Heer“ in seinen Planungen auf 16 Divisionen. Zur Berechnung sollte sogar nur noch von 15 Divisionen ausgegangen werden. Dieses Konzept hatte bis Mitte 1930 Bestand.42 Am 29. September 1928 genehmigte der Chef der Heeresleitung das Heeresrüstungsprogramm 1928/32, dem dieses reduzierte Notstandsheer zugrunde lag. Am 26. Oktober billigte die Regierung dieses 1. Rüstungsprogramm mit einem Finanzierungsaufwand von rund 350 Millionen RM. Davon entfielen ca. 280 Millionen RM auf die Erstausstattung des Notheeres. Der Löwenanteil wurde für den Ankauf von Artilleriemunition und -gerät sowie Maschinengewehren verwendet. Die Bestellungen bei den ‚schwarzen Firmen‘ erfolgten aus Geheimhaltungsgründen – wie schon in den Jahren zuvor – weiterhin über die 1926 von der Reichswehr ins Leben gerufenen Stahl- und Maschinengesellschaft mbh (Stamag). Die Lieferungen der zugelassenen Rüstungsschmieden, die das „Nollet-Soll“43 überschritten, wurden einem gesonderten Buchungsverfahren unterzogen.44 Die Einstellung von Haushaltsmitteln in die umfangreiche Ausarbeitung zeigt, dass es nicht um ein Gedankenspiel möglicher Rüstungshersteller ging. Vielmehr belegt sie Waffenkäufe der Reichswehr nicht nur bei den wenigen von den Alliierten zugelassenen Rüstungsschmieden, sondern auch bei einigen ‚schwarzen‘, nicht konzessionierten Betrieben.45 So lieferten mit Wissen und Genehmigung der Alliierten die Magdeburger Polte-Werke Hülsen und Geschosse; ungenehmigt aber stellten vier weitere Firmen diese Munition her; die Metallwarenfabrik Treuenbrietzen, Basse & Selve im sauerländischen Altena, die Lokomotivfabrik und Schiffsbauwerft Schichau in Elbing,46 sowie die Werkzeug- und Maschinenfabrik Donauwörth.47
Polte-Kennmarke mit eingestanzter Personalnummer (Sammlung Baranowski)
Die Kosten für die ‚fabrikatorischen Vorarbeiten‘ machten im Gesamtumfang des 1. Rüstungsprogramms den kleinsten Betrag aus. Dies verwundert, da die Reichswehr noch im Juni 1927 im Rahmen des von ihr selbst aufgelegten „Notprogramms“ knapp 40 Millionen RM für die Sicherstellung des allerdringendsten Heeresbedarfs in „Rumpfdeutschland unter Zugrundelegung der vorhandenen Maschinen [und] Einrichtungen“ gefordert hatte. Außerhalb der zugelassenen Firmen sah die ursprünglich aus dem März stammende überarbeitete Dringlichkeitsliste vom Juni 1927 die finanzielle Unterstützung von etwa 50 Betrieben vor, die wie die Lindener Zündhütchenfabrik in Empelde bei Hannover für mögliche Rüstungsaufträge zumeist „still liegend in Bereitschaft gehalten wurden“. Unter ihnen waren Dreyse & Collenbusch in Sömmerda, die Berlin-Karlsruher-Industriewerke,48 die zum Krupp-Imperium gehörende Panzerschmiede Grusonwerk in Magdeburg, AEG, die Siemens-Schuckert Werke Berlin, die Sächsischen Gussstahlwerke Döhlen (SGW),49 die Maschinenfabrik Wilhelm Wurl in Berlin-Weißensee, die Ardeltwerke in Eberswalde, die Erfurter Maschinenfabrik (Erma), Hanomag in Hannover und die Maschinenfabrik August Wallmeyer in Eisenach.50 Noch im Dezember 1927 hoffte das Heereswaffenamt, für die Jahre 1927 bis 1930 einen Betrag von mehr als 41 Millionen RM für fabrikatorische Rüstungsvorhaben aufwenden zu können.51 So waren 800.000 RM für die Ergänzung der bei Schwedt und bei Erma lagernden Maschinen für Handwaffen gedacht. Weitere 4,2 Millionen RM sollten u. a. für die Überholung von Werkzeugen bei Polte, Basse & Selve, Dreyse & Collenbusch, Dornheim-Suhl, Utendoerffer, den Berlin-Karlsruher-Industrie-Werke und für Maschinen in diversen Heereslagern fließen. Auch eine Umrüstung der Lindener Zündhütchenfabrik genoss höchste Priorität. Um das Werk in „erhöhte Bereitschaft“ zu versetzen, sollten weitere Mittel für den Ersatz der alten, handelsüblichen Maschinen der Fabrik durch moderne Produktionsmaschinen fließen. Die Verhandlungen mit den Firmenvertretern waren 1928 soweit gediehen, dass abschlussbereite Verträge vorlagen. Vorgesehen war auch die Bereitstellung von 20.000 Geschossnäpfchen durch Basse & Selve.52
Am 5. Dezember 1927 leitete das Heereswaffenamt dem Truppenamt den endgültig korrigierten und erweiterten „Fabrikenplan“ zu, der, aufgeschlüsselt in 17 Punkte, eine Vielzahl weiterer Einzelprojekte aufführte. Allein für die Überholung, Reparatur und Ergänzung des Maschinenparks für Kartusch- und Patronenhülsen sollten weitere 7,1 Million RM investiert werden. Für die Verlegung der Pulverfabriken von Troisdorf nach Dömitz, von Rottweil nach Premitz und die Einrichtung der Dynamitfabrik für Röhrenpulver in Krümmel bei Geesthacht, sowie für den Ausbau der bereits produzierenden Firma Wasag und der Walsroder Fabrik Wolff & Co. waren insgesamt 4,2 Millionen RM projektiert. Weitere 5,14 Millionen RM hatte das Heereswaffenamt für die Anschaffung von Spezialmaschinen und die Ergänzung von Werkzeugen sowie Werkbestandteilen für mechanische Zeitzünder, wie sie die Firma Thiel produzierte, vorgesehen.53 Ein vergleichsweise geringer, militärisch gesehen aber sehr bedeutender Betrag von 195.000 RM war für Erhaltung, Pflege und Umtransporte der ‚schwarz‘ angelegten Maschinen- und Werkzeuglager in Treuenbrietzen, Rothenburg, Königsberg, Milbertshofen sowie Sömmerda eingeplant. Auch die Firmen Göggl (München-Moosbach), Schäffer (Stettin), Polte (Magdeburg), Erma (Erfurt), Haase & Wrede (Berlin), F. Werner (Berlin-Marienfelde) und der Industrieanlagen GmbH (Berlin-Haselhorst) sollten ihre „schwarze“ Lagerhaltung aus diesen Mitteln bestreiten.54
Bei dem Programm handelte es sich um Maximalpositionen, die, wären sie verwirklicht worden, erhebliche Einschnitte zu Lasten der materiellen Rüstung nach sich gezogen hätten. „Nahe55 ist sich darüber klar, dass die für unsere Verhältnisse sehr hohen Summen, die für die Vorbereitung der Umstellung einer auch nur begrenzten Industrie notwendig sind, in kurzer Zeit nicht zur Verfügung stehen werden“. Dennoch bat das Heereswaffenamt zu prüfen, „ob es nicht zweckmäßig ist, die Anhäufung größerer Bestände zu vermeiden und so die ersparten Mittel lieber in die Umstellungsvorbereitungen der wichtigen Fabriken zu stecken“.56 Ende Januar 1928 wurde das Begehren des Truppenamtes abgelehnt. Zwar werde die Notwendigkeit der fabrikatorischen Vorbereitung für die Massenfertigung anerkannt, doch aus Sicht der übergeordneten Stellen lasse sich das Vorhaben des Heereswaffenamtes „mit einem Gesamtkostenaufwand von rd. 50 Millionen RM in das bisherige Rüstungsprogramm“ derzeit nicht aufnehmen. Die geforderten Mittel könnten weder aus dem Erprobungsfonds noch aus den Beträgen der Beschaffungsmitteln „herausgeschnitten werden“, die das Heereswaffenamt für die fabrikatorische Rüstung für erforderlich erachtete. Allenfalls könnten einzelne, vordringliche Forderungen, soweit sie nur geringe Mittel in Anspruch nehmen, befriedigt werden. Für jedes Gebiet müsse von Zeit zu Zeit geprüft werden, „welche Mittel für die fabrikatorische Rüstung abgezweigt werden können“.57
Im Frühjahr 1928 waren die 40 bis 50 Millionen RM, die zunächst angedacht waren, zu einem „fabrikatorischen 10 Millionen Programm“ geschrumpft. Nach Hansen wurde der Betrag für die Geltungsdauer des ersten Rüstungsprogramms von 1928 bis 1932 auf 13,785 Millionen RM festgeschrieben, später geringfügig auf 14,818 Millionen RM erweitert.58 Bis 1932 flossen aus dem „Fabrikenfonds“59 des Kriegslastenhaushalts insgesamt 69,06 Millionen RM in die direkte Unterstützung von Rüstungsbetrieben; der wesentliche Teil wurde jedoch bereits vor Auflage des ersten Rüstungsprogramms gezahlt, so dass die Zahl einen falschen Eindruck erwecken könnte.60 Bis Ende 1927 profitierten allein die wenigen zugelassenen Firmen von finanziellen Zuwendungen aus diesem Fonds. So gingen allein 1926 12 Millionen RM an Simson in Suhl, 1,6 Millionen RM an Rheinmetall Sömmerda, 7,45 Millionen RM an Rheinmetall Düsseldorf, 1,1 Millionen RM an die Fahrzeugfabrik Eisenach, 9,5 Millionen RM an den Bochumer Verein, 3,5 Millionen RM an die Wasag, 1,5 Millionen RM an Krupp Essen und weitere 0,33 Millionen RM an die Berliner Maschinenbau AG, vormals Schwarzkopf.61 Erst ab 1928 wurden Mittel des „Fabrikenfonds“ zur Unterstützung nicht zugelassener Firmen herangezogen. Der Aufstellung des „x-Haushaltes“ für 1929, der sämtliche Ausgaben gleich welcher Bestimmung für illegale Rüstungsvorhaben aufnahm, weist für das Rechnungsjahr 3,432 Millionen RM an Zuwendungen für ‚fabrikatorische Zwecke‘ aus. Unter den Nutznießern war wiederum Polte. Zur Ergänzung seines Maschinenparks für Infanterie-Munition erhielt der Magdeburger Rüstungsproduzent über 800.000 RM; davon stammten 538.800 RM aus dem „Rüstungs-“ und weitere 270.000 RM aus dem „Fabrikenfonds“.
In den Ausbau von Munitionsfabriken in Empelde, München-Moosach, Treuenbrietzen und Salzwedel investierte das Reich 538.500 RM. Die Firma Thiel ließ sich die Beschaffung von 18.000 Werksbestandteilen im Wert von 300.000 RM, zudem den Ausbau der Fabrik mit mehr als 600.000 RM finanzieren. Ebenso profitierten Rheinmetall Borsig und Basse & Selve von den Reichswehr-Töpfen. Und die Konservierung der Maschinen des Gasmaskenherstellers Auer war dem Reich 18.000 RM wert; die Anschaffung chemischer Kampfstoffe und deren Vorprodukt Oxol förderte das Reich mit 159.000 RM.62
Für 1930 belief sich der aus dem „x-Haushalt für fabrikatorische Zwecke“ bewilligte Betrag auf 3,363 Millionen RM; eine weitere Million RM war in Aussicht gestellt. Von der genehmigten Summe gingen 900.000 RM als Abschlussrate an den Zünderproduzenten Thiel in Ruhla. Besonders der Ausbau der Fabrik in Fürstenberg am Schwedtsee wurde gefördert. In den dortigen Hallen der Deutschen Faserstoff GmbH hatte die Reichswehr zunächst ein illegales Maschinenlager unterhalten; doch offenbar schon seit 1928 wurden die Gebäude zu einer modernen Fabrik für Infanteriemunition umgebaut.63 Der Reichswehrhaushalt für 1930 sah noch eine Restrate von 57.000 RM für die Neuanschaffung von Pressen vor. Die Lagermiete selbst belief sich auf 9.500 RM, die Instandhaltungskosten für den dort aufgestellten Maschinenpark erreichten 102.000 RM. Von der in Aussicht gestellten weiteren Million RM war ein Teilbetrag von 300.000 RM ebenfalls für Fürstenberg eingeplant. So gingen am Schwedt-See die Rüstungsfirmen schon in Position, in denen die Frauen des 1938 in unmittelbarer Nachbarschaft errichteten KZs Ravensbrück Zwangsarbeit verrichten sollten. Weitere 700.000 RM sollten der Berlin-Lübecker Maschinenfabrik Bernhard Berghaus für den Ankauf von Maschinen zukommen. Immer wieder waren es Zulieferer der Infanterie, Hersteller von Munition und Maschinengewehren, die auf diese Weise gefördert wurden, einmal mehr Polte mit einem Betrag von 350.000 RM.
Zum Ausbau der Wasag und eines Sprengstoffwerkes in Plauen wurden 1,1 Millionen RM beigesteuert. Für die Anschaffung zwei neuer Pressen für Wurl in Berlin und Hanomag in Hannover kamen 220.000 RM aus dem Topf des Reiches.64 Für 1931 wie auch 1932 waren annähernd acht Millionen RM aus dem „Fabrikenfonds“ zur Verteilung an Rüstungsfabriken bestimmt. Das Gros sollte der Firma Simson in Suhl zukommen, die damit ihre – offenbar schon bestehende – Maschinengewehr-Produktion von Grund auf modernisieren wollte. 1931 konnte Simson für denselben Zweck weitere 1,25 Millionen RM und für 1932 gar 3,75 Millionen RM einsetzen. An die Geschossfabrik der Gelsenkirchener Bergwerks AG sollten ebenfalls 1,85 Millionen RM gehen.65
Festzuhalten ist, dass diese Subventionen aus dem „Fabrikenprogramm“ einen ungebrochenen Willen zur Revision des Versailler Ergebnisses, zu erneuter Hochrüstung und zur Führung eines Angriffskrieges darstellen. Wirtschaftlich hatten sie einen geringen Stellenwert, da sie nur ausgewählte Unternehmen erreichten und lediglich einem Bruchteil der in Bedrängnis geratenen Firmen über die Wirtschaftskrise hinweg halfen.66 Die von der Reichswehr parallel seit den 1920er Jahren, ebenso im Verborgenen in Gang gesetzte Rüstungsforschung setzte weitaus stärkere Akzente. Die Entwicklung neuer Waffengattungen fand in Konstruktionsbüros, Laboratorien, Versuchswerkstätten und privaten Unternehmen, zumeist nur auf dem Reißbrett statt. Sie war bewusst auf die Erzielung von ‚Schubladenergebnissen‘ ausgerichtet, also auf Blaupausen, die im Bedarfs-, d. h. Kriegsfall, für eine Massenproduktion aktiviert werden konnten. Aus Kostengründen verließen allenfalls Prototypen als Versuchsobjekte die Werkstätten und gingen erst nach 1933 in Massenproduktion.67 Wie sehr diese ‚unerlaubten‘ Entwicklungen für wichtig erachtet wurden, zeigt der Fall des Fabrikanten Curt Heber. Im Auftrag der Luftwaffe konstruierte er Bombenabwurfgeräte und anderes Kriegsgerät, stellte es in Kleinstserien her oder ließ es bei anderen Firmen in geringen Stückzahlen produzieren. Heber bediente sich dabei der Waffenschmiede von Heinrich Krieghoff in Suhl und der mechanischen Fabrik von Heinrich Baer in Berlin.68 Die Arado-Flugzeugwerke in Warnemünde konnte Heber in seine Entwicklungsarbeit einspannen.69 Hans Rebentisch war in dem Betrieb 1929 Werkmeister. Unter seiner Leitung wurde in der dritten Etage des Schlossereigebäudes hinter einer Stahltür eine geheime Abteilung eingerichtet. „Wer hinein wollte, musste klingeln. So war sichergestellt, dass kein Fremder hinein kam“. In dieser nach außen hermetisch abgeschotteten Werkstatt bauten Rebentisch und drei weitere Schlosser nach den Plänen Hebers dessen Bombenabwurf-Vorrichtungen. „Dies waren sowohl die Magazine, in denen vertikal übereinander fünf Bomben zu je 10 kg untergebracht waren; wie auch Einzelaufhängungen für 50-kg und 250-kg-Bomben“.70
Auf dem Gelände der Mechanischen Werkstätten Neubrandenburg, 1936? (Sammlung Heber)
Erst 1934 startete Heber in einer neu errichteten, eigenen Fabrik, den Mechanischen Werkstätten Neubrandenburg (MWN), die Serienproduktion.71
Doch nicht nur mittelständische Unternehmen wie Heber, sondern auch Großkonzerne engagierten sich in der durch Staatsgeld geförderten Entwicklung von Kriegsmaterial.72 Die Rheinmetall-Werke in Sömmerda und Düsseldorf, Simson & Co. in Suhl sowie die Fahrzeugfabrik Eisenach unterhielten staatlich finanzierte Werkzeugbüros, die Artillerie- und Infanteriewaffen entwickelten und die entsprechenden Konstruktionszeichnungen erstellten. Bis 1929 wurden die Kosten für Rheinmetall Düsseldorf und Simson Suhl aus dem „Fabrikenfonds“ getragen. Die Niederlassungen dieser beiden Firmen in Eisenach und Sömmerda mussten dagegen ihre Kosten anderweitig decken – sie dürften sie über höhere Lieferpreise anderer Rüstungsgüter bestritten haben. Von 1930 an wurde der Etat auch dieser Konstruktionsbüros jedoch voll aus dem „Fabrikenfonds“ bestritten. Im März 1930 waren bei Rheinmetall Düsseldorf 30, in Sömmerda sechs, in Eisenach drei und bei Simson in Suhl 100 Personen mit der Entwicklung von Kriegsgerät befasst. Die Arbeit wurde von dem Krupp nahe stehenden Berliner Konstruktionsbüro Koch & Kienzle mit 50 Mitarbeitern koordiniert und kontrolliert.73 1930 ließ sich die Reichswehr die Unterhaltung ihrer ‚Denkschmieden‘ über 1,2 Millionen RM kosten, 1931 mit 1,1 Million RM nur geringfügig weniger.74 Zu diesen Entwicklern illegaler Waffen scheint auch die Mauser-Werke AG in Oberndorf gezählt zu haben.75
Eine andere Stelle, die systematisch Verstöße gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrags plante und koordinierte, war die zum Heereswaffenamt gehörende Abteilung 6 der Inspektion für Waffen und Gerät (IWG). Bei ihr und ihren Fachabteilungen liefen die Fäden zur Vorbereitung der Luftwaffenrüstung zusammen. Unter Leitung von Hauptmann Student vergab sie zahlreiche Aufträge an ‚Forschungseinrichtungen‘. Zumeist handelte es sich um Eigengründungen, wie etwa die Firma Schulz & Co., Motoren- und Maschinen GmbH in Berlin. Sie arbeitete für die Fliegerkampfmittelgruppe und befasste sich nach außen mit dem Vertrieb von Kraftfahrzeugen, Motoren und Flugzeugteilen. Unter dem Mantel einer „Berliner Gesellschaft für landwirtschaftliche Artikel“ stand die Entwicklung von Gaskampfstoffen. Eine Abteilung der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt führte als Büro „M“ für die Reichswehr praktische Versuche mit Flugzeugen, Flugmotoren und Bordgeräten durch. In Rechlin (Mecklenburg) unterhielt die Abteilung 6 der Inspektion für Waffen und Gerät einen Flugplatz für praktische Flugversuche, als deren Eigentümer nach außen hin die Albatros-Flugzeugwerke firmierten.76 Mit Unterstützung des Heereswaffenamtes hatte die Deutsche Glasglühlicht Auergesellschaft in Oranienburg 1927 eine „Versuchsanlage und Laboratorien für Gasschutzzwecke“ eingerichtet, die neben der Entwicklung von Gasmasken auch den Zweck hatte, „die besten Fabrikationsstoffe für die einzelnen Kampfstoffe festzustellen“.77 Außerdem hatte Auer in seinem Oranienburger Stammwerk eine Anlage zur Herstellung von Senfgas-Vorstufen errichtet.78
Doch auf dem Feld der Giftgasforschung und -produktion war dies nur einer von vielen schon Anfang der 1920er Jahre bestehenden Berührungspunkte einer symbiotischen Beziehung von Reichswehr, Industrie und Wissenschaft. Die Fäden zog Chemie-Nobelpreisträger Fritz Haber, die graue Eminenz im Hintergrund. 1923 hatte er den Bau einer Chlorgasanlage in der Nähe von Samara an der Wolga in der Sowjetunion eingefädelt,79 wo verschiedene Kampfstoffe der Chlorgaschemie hergestellt wurden. Zur Umsetzung bediente sich Haber seines Schülers Hugo Stoltzenberg80 und dessen Hamburger Firma CFS. Im Januar 1924 hatten die Militärs beschlossen, eine inländische Kampfstoffproduktion an einem vor Luftangriffen sicheren Ort in Mitteldeutschland aufzunehmen. Wiederum durch Vermittlung von Haber erhielt Stolzenbergs CFS diesen Auftrag. Fünf Monate später begann er mit dem Bau einer großen, als Chlorkalianlage getarnten Giftgasfabrik in Gräfenhainichen bei Halle. Geplant war eine Kapazität von 7.000 t Lost pro Jahr, mehr als während des ganzen Weltkriegs in Deutschland hergestellt worden war. Mitte 1926 zerschlugen sich beide Projekte. Explodierende Kosten bei gleichzeitiger Verknappung der Finanzmittel der Reichswehr und eine Änderung der politischen Situation durch die Westöffnung der Stresemannschen Außenpolitik verurteilten die Projekte zum Scheitern. Noch im gleichen Jahr wurde die halbfertige Anlage bei Samara den Russen überlassen, die Fabrik in Gräfenhainichen demontiert und an die I.G. Farben verkauft.81
Im Zuge der 1925 begonnenen Reorganisation der Reichswehr hatte das Militär ein wissenschaftliches Beratergremium für Gasschutz- und Kampfstoff-Fragen ins Leben gerufen. Von Seiten der Reichswehr wirkten in diesem Gremium Vertreter des Heereswaffenamtes, der Sanitätsinspektion, der Marine-Leitung und der für die chemische Kriegsführung zuständigen Inspektion der Artillerie mit. Von Seiten der Wissenschaft war der Beraterkreis interdisziplinär zusammengesetzt, u. a. mit dem Leiter der Forschungsabteilung der Auer-Gesellschaft und Wissenschaftlern staatlicher Forschungsanstalten, Technischer Hochschulen sowie der Universitäten Göttingen, Leipzig und Würzburg.82 Unter ihnen war Gerhart Jander, seit April 1922 Leiter der Anorganischen Abteilung des Chemischen Instituts der Universität Göttingen und Mitbegründer der dortigen NSDAP. Für die Reichswehr arbeitete er an mehreren Forschungsprojekten zur Weiterentwicklung chemischer Kampfstoffe.83
Der Reichswehrauftrag an die Forscher zielte auf die Schaffung der theoretischen und technischen Grundlagen der Giftgastechnologie; dorthin floss das Gros der von der Reichswehr investierten Mittel. Nur geringe Förderbeträge kamen dem direkten Aufbau von Produktionskapazitäten zu Gute. So sah die Reichswehr Ende 1927 einen im Vergleich zu anderen Vorhaben der fabrikatorischen Vorbereitung vergleichbar geringen Mittelbedarf von knapp 1,5 Millionen vor, der in drei Vorhaben investiert werden sollte. 560.000 RM waren für die Ergänzung der Apparaturen für die Herstellung von 80 t Blaukreuz der „als Keimzelle anzunehmenden Azofarbenfabrikation der Agfa in Wolfen“ bestimmt. Die verbleibenden 900.000 RM sollten in Füllanlagen für Gelb- und Grünkreuz investiert werden.84 Im Frühjahr 1931 stellte die Reichswehr das weitere Vorgehen bei der Giftgasproduktion in großer Runde zur Diskussion. Die Referentenbesprechung vom 16. April 1931 kam zu dem Ergebnis, dass vom militärischen Standpunkt aus die Verwendung von Gas, „namentlich im Hinblick [auf die] fliegerische und artilleristische Lage einen nicht zu unterschätzenden Zuwachs an Kampfkraft“ bedeute. Für den Rüstungsabschnitt 33/38 schlugen die Beteiligten vor, zumindest für Gelbkreuz fabrikatorische Vorbereitungen, allerdings keine Bevorratung – bis auf Oxol – zu treffen.85
Dies galt vorbehaltlich der bis dahin ungeklärten Frage, ob überhaupt Kampfstoffe im Kriegsfall eingesetzt werden sollen. Ende Mai 1931 erläuterte das Technische Amt in einer weiteren Stellungnahme, dass „die Freigabe des Einsatzes […] im Frieden nicht im Voraus“ entschieden werden könne. Weiter hieß es: „Voraussichtlich dürfte jeder kriegsführende Staat, der das Genfer Gasabkommen vom 17. 06. 1925 unterzeichnet hat, das Odium des Vertragsbruches vermeiden wollen und versuchen, dem Gegner hiervon die Vorhand zu überlassen“. Daher sei es zweckmäßig, „sich nicht selbst auf die Verwendung von Gaskampfstoffen festzulegen, sondern zunächst abzuwarten, wie sich die Gegenseite verhält“. Außerdem dürfe man nicht von vornherein mit der Anwendung von Gaskampfstoffen rechnen. Die Taktik „muss so ausgebildet sein, dass sie auch ohne diese auskommt“.86
Die in aller Stille entwickelten neuen Waffensysteme, Flugzeuge und chemischen Kampfstoffe ließ die Reichswehr in der UdSSR testen. So hatte sie in Lipezk, 375 km südöstlich von Moskau gelegen, eine geheime Fliegerschule errichtet, die in den Jahren 1925 bis 1931 als Erprobungszentrum für Bomben und Abwurfgeräte, Maschinengewehre und neue Flugzeuge diente.87 Unter Leitung des Diplom-Ingenieurs Ernst Marquard88 vom Heereswaffenamt wurden z. B. die von Curt Heber und Zeiss Jena entwickelten Bombenwurfgeräte zunächst im April 1930 in Berlin-Staaken vorübergehend in einer in einem Hangar stehenden Junkers W 33 am Boden geprüft, dann auf dem Luftweg zur weiteren Erprobung nach Lipezk geschafft. Heber und Marquard erhielten die Erprobungsergebnisse. „Je nach positivem oder negativem Ergebnis ergaben sich daraus neue konstruktive Entwicklungen. Die Zeichnungen der Geräte wurden in Archiven gespeichert und standen dann beim Aufbau der Luftwaffe zur Verfügung“.89 In Tomka bei Saratow hatte das deutsche Militär eine Anlage zur Erprobung von Giftgas errichtet. Ihre Panzerfachleute bildete die Reichswehr ab 1928 – als Traktorfahrer deklariert – in Kazan an der Wolga aus.90
Damit die Forderungen des Militärs bei der Aufstellung des Haushaltes 1933 hinreichend Berücksichtigung fänden, hatte Wilhelm Heye91 als Chef der Heeresleitung bereits bei Verabschiedung des 1. Rüstungsprogramms angeordnet, für die anschließende Rüstungsperiode die Vorbereitungen bis spätestens Herbst 1931 abzuschließen. Die Beschaffungsstellen des Waffenamtes gingen schon Mitte 1929 an die neuen Planungen. Vorgabe der Reichswehrführung für dieses 2. Rüstungsprogramm war nunmehr wieder ein 21-Divisionen-Feldheer mit 300.000 Mann.92 Zur Finanzierung dieses auf fünf Jahre ausgelegten 2. Rüstungsprogramms forderte die militärische Führung nicht weniger als eine Milliarde RM. Damit sollte die Ausstattung der Streitkräfte und ihr erster Nachschubbedarf für vier bis sechs Monate garantiert und die fabrikatorischen Vorarbeiten, d. h. die Einrichtung der Fabriken, soweit vorangetrieben werden, dass die Industrie vom vierten Monat an die Weiterversorgung sicherstellt.93 Doch das Milliardenprogramm stieß auf den Widerstand der politischen Führung. Sie begrenzte das Rüstungsprogramm 1933 bis 1938 letztlich auf 484 Millionen RM.94 Schon im August 1929 war vom Technischen Amt die Aufforderung an das Waffenamt ergangen, „als bleibende Unterlage für Operationsentwürfe, Kriegsspiele usw. […] eine Aufstellung der derzeitigen Fertigungsmöglichkeiten für den Nachschub“, gegliedert nach Inner- und Gesamtdeutschland, zu erstellen.95
Die Zahl der in Vorbereitung des 2. Rüstungsprogramms vom Waffenamt erkundeten und für eine Fabrikation ausgewählten Betriebe hatte sich bis in die frühen 1930er Jahre erheblich erhöht. Im November 1931 legte das Waffenamt mit seinem „Fertigungsprogramm 1000/31“ erstmals für sämtliche Waffengattungen der Reichswehr konkrete Fabrikationsvorschläge vor. Es verzeichnete etwa 1.000 Unternehmen in ‚Innerdeutschland‘, gegliedert in 14 Regionalbezirke. Neben dem Namen des Werkes und seinem Standort enthielt das Programm genaue Angaben über die im Kriegsfall von den einzelnen Werken herzustellenden Rüstungsgüter.96 Die Reichswehr hatte sich so ein engmaschiges Netz möglicher Zulieferer im Wartestand geschaffen und damit das Fundament für den späteren Ausbau und Aufschwung der Rüstungsindustrie, vor allem aber für ihre eigene Hochrüstung unter anderen politischen Voraussetzungen gelegt. Bereits dieses Konzept von 1931 legte einen deutlichen Schwerpunkt auf Unternehmen in der Region Braunschweig.
Allein neun Maschinenproduzenten und metallverarbeitende Betriebe werden als Rüstungslieferanten vorgesehen, so die Amme-Luther-Werk AG für die Produktion von monatlich 100 Minenwerfern, 7.500 Feldhaubitzgranaten und bis zu 12.500 8,8-cm-Geschossen. Die Herstellung von Geschossen unterschiedlichster Kaliber wurde bei der Braunschweigischen Maschinenbau-Anstalt, den Brunsviga Maschinenwerken Grimme (2-cm und 3,7-cm), der Dampfkessel- und Gasometerfabrik, vormals A. Wilke & Co. (15-cm), der Vereinigten Eisenbahn-Signalwerke GmbH (15-cm) sowie den Maschinenfabriken Karges-Hammer (7,5-cm) und Selwig & Lange (8,8-cm) angesiedelt.97 Diese Unternehmen hatten in den 1920er Jahren starke Produktionseinbußen hinnehmen müssen; nunmehr erlaubte ihnen ihre Infrastruktur, ohne größere Investitionen Rüstungsaufträge, die ihnen die Reichswehr anbot, zu übernehmen. Fest eingeplant waren auch der Lastkraftwagenhersteller Büssing NAG sowie die Firma Voigtländer & Sohn für die Herstellung von Zielfernrohren und optischem Gerät.98
Sehr viel mehr noch waren Hannoveraner Betriebe in diese frühen Planungen der Reichswehr einbezogen. Allein im heutigen Stadtgebiet von Hannover hatte die Reichswehr mehr als 20 Firmen zu Herstellern von Kriegsgerät und Zubehör bestimmt,99 allen voran die beiden bereits seit 1927 mit illegalen Aufträgen bedachten und auf weitere „harte Rüstungsgüter“ ausgerichteten Firmen Hannoversche Maschinenbau AG (Hanomag) und Lindener Zündhütchenfabrik Empelde.100 Sie hatten Ende der 1920er Jahre mit großzügiger finanzieller Unterstützung der Reichswehr Pressen angeschafft und ihre Werksanlagen für weitere Rüstungskapazitäten ausgebaut. Eine solche direkte Finanzierung war das Privileg nur weniger Firmen und unterstreicht, wie sehr die Reichswehr auf die beiden Firmen als Hauptlieferanten setzte.101 In den Planungen des Jahres 1931 stand Hanomag als Hersteller von Flugmotoren, Zugmaschinen, Sperrgerät und Granaten verschiedenster Kaliber. Als Hilfsfirma sollte Hanomag zudem Geschütze für die Deutsche Industriewerke AG in Berlin-Spandau sowie 8,8-cm-Flakgeschütze für Borsig herstellen. Die Lindener Zündhütchen- und Patronenfabrik AG sollte im Bedarfsfall einen Ausstoß von monatlich 9,5 Millionen Infanterie-Patronen und 15 Millionen Zündhütchen erreichen.102 Für die Produktion von Granaten und Kartuschen waren das Eisenwerk Wülfel, die Maschinenfabrik Jünke & Lapp, die Firma Knoevennagel und die Metallwarenfabrik Theodor Stiegelmeyer vorgesehen. Die Blech- und Eisenkonstruktionsfirma Sorst & Co.103 war nicht nur als Hersteller von Kartusch- und Patronenhülsen, sondern auch von Torpedogerät, Packgefäßen, Sperrgerät (Bojen und Behälter) sowie Nebelwerfern eingeplant.
Teile für Minenwerfer, aber auch Kochanlagen für Kriegsschiffe sollten die Vosswerke liefern. Den Bode-Panzer-Geldschrankfabriken und der Hannoversche Waggonfabrik (HAWA) hatte die Reichswehr die Herstellung von MG-Dreifußgestellen und -Aufsätzen zugeordnet. Die Armaturenfabrik Dreyer, Rosenkranz & Droop104 sollte als Hilfsfirma der Magdeburger Mundlos AG, eigentlich eine Nähmaschinenfabrik, Torpedogerät und verschiedene Einzelteile zuliefern. Die Motorenfabrik Gebrüder Körting in Hannover-Linden hatte die Reichswehr als Hersteller von Flug- und Dieselmotoren sowie Ölfeuerungsdüsen eingebunden. Die Firma Wagenbau Jacobi sollte in Reserve Feldwagen bauen. Die Hackethal Draht- und Kabelwerke, reichsweit einer der bedeutendsten Kabelhersteller, sollte monatlich bis zu 130 km Zünd- und Sprengkabel, vier Kilometer Feldkabel sowie 60 km Bronze- und Kupferdraht bereitstellen. Die Gewecke GmbH, eine Holzgroßhandlung, war als Holzlieferant für Brückenbeläge und Schnellbrücken vorgesehen. Die Holzwerke Hainholz AG sollte monatlich bis zu 2.600 Transportkästen für Patronentrommeln abliefern. Packtaschen und Zaumzeug sollten die Lederwarenfabrik Ryffel & Borns, die Sattlerwarengroßhandlung Schütze und das Sattlergeschäft Passier & Sohn stellen.105 Die Continental-Gummi Werke AG, Lieferant von Kriegsmaterial schon im Ersten Weltkrieg,106 wurde als Hersteller von Schläuchen, Gummi- und Verpackungsmaterial sowie Gummidichtungen geführt.107 Ihr Generaldirektor seit 1926, Willy Tischbein, war Präsident der Industrie- und Handelskammer Hannover und zugleich Regionalkommissar der Stega.108
Damit nahm er eine Schlüsselstellung zwischen der Bedarfsentwicklung der Reichswehr und der Erkundung sowie Auswahl geeigneter Produktionsbetriebe ein. Konsequent nutzte er diese Doppelfunktion zugunsten der Hannoveraner Industrie, brachte sie in rüstungsrelevanten Bereichen ins Gespräch und positionierte sie derart erfolgreich, dass Hannover später zu einem Rüstungszentren des Reiches wurde. Doch die in Aussicht gestellten Rüstungsaufträge blieben anfänglich aus, so dass Tischbeins Engagement für Rüstungsfertigungen Hannovers Betrieben nicht über die Weltwirtschaftskrise hinweg halfen, sondern sich erst nach 1933 wirtschaftlich auswirkten.109
Ganz anders sah die Situation im Harz und dem Harzvorland aus. Die metallverarbeitende Industrie war dort allenfalls mit mittelständischen Unternehmen vertreten, von denen nur wenige den Anforderungen einer Massenproduktion genügten. In der Konzeption der Reichswehr vom November 1931 fanden nur zwei Betriebe aus Bad Lauterberg Berücksichtigung; die Franz Kuhlmann GmbH für die Herstellung von Feuerleitanlagen, Zündern für 2-cm-Munition und Nebelwerfern sowie die Monopol-Kolbenring-Fabrik Atmer & Kaufhold für 7,5-cm-Geschosse. An den Betrieben in der Universitätsstadt Göttingen hatte die Reichswehr keinerlei Interesse, obwohl gerade die optische und feinmechanische Industrie während des Ersten Weltkrieges ihre Kriegstauglichkeit unter Beweis gestellt hatte. Die wenigen nordthüringischen Unternehmen, die berücksichtigt wurden, waren – bis auf die Firmen im ‚Ballungszentrum‘ Sömmerda – meist nur als Unterlieferanten vorgesehen. Die Mühlhäuser Franke AG und die Thüringische Maschinen- und Fahrradfabrik Walter & Co. stufte die Reichswehr im November 1931 als mögliche Zulieferer für Rüstungsgüter ein, Walter & Co. etwa für die Karabiner-Produktion der Firma Sauer & Sohn in Suhl.110
In Nordhausen war das metallverarbeitende Gewerbe stärker ausgeprägt als in Mühlhausen. Es blieb trotz der Stagnation, die in den Jahren zuvor durch das Wegbrechen von Absatzmärkten eingetreten war, nach der Genussmittel- und der Textilindustrie die drittgrößte Branche der Stadt. Besonders negativ hatte sich der Niedergang der Südharzer Kaliwerke ausgewirkt. Sie waren Hauptabnehmer der in Nordhausen hergestellten Bergbaumaschinen.111 So hatte besonders der Maschinen- und Apparatebau mit beträchtlichen Umsatzrückgängen zu kämpfen, allen voran die drei Firmen Schmidt, Kranz & Co., Angers Söhne sowie MABAG (Maschinen- und Apparatebau). Anfang 1931 erschien ihr Fortbestehen höchst fraglich.112 So weckte die Betriebserkundung, die die Reichswehr im gleichen Jahr in Nordhausen unternahm, bei den Unternehmen Hoffnung auf neue Absatzmärkte durch Einbeziehung in die Wiederaufrüstung.113 Zunächst wurden jedoch nur die Maschinenfabrik Julius Fischer sowie die Firmen Montania und MABAG eingeplant.114
Als einen weiteren tragenden Pfeiler ihres Aufrüstungsprogramms hatte die Reichswehr Rheinmetall in Sömmerda auserkoren. Bereits im Oktober 1922 hatte das Werk den Auftrag erhalten, sämtliche Zünder in der von den Alliierten genehmigten Menge herzustellen; tatsächlich fabrizierte das Werk unter der Hand weitaus mehr. Schon zu Beginn der 1920er Jahre hatte Rheinmetall Sömmerda wieder die Weiterentwicklung von Maschinengewehren aufgenommen. Aufdeckung durch deutsche Behörden musste der Konzern allerdings nicht fürchten.115 Im Gegenteil, seit 1922 erhielt das Unternehmen zur Erweiterung seiner Rüstungskapazitäten erhebliche Finanzhilfen vom Heereswaffenamt; im Jahr 1926 allein 1,6 Millionen RM.116 Daher ist nicht verwunderlich, dass Rheinmetall in den Planungen der Reichswehr vom November 1931 eine zentrale Stellung einnahm. Monatlich sollten mehr als 400.000 Zünder das Werk verlassen. Daneben war Rheinmetall als Hersteller von Zieleinrichtungen erfasst.117 In Sömmerda hatte die Reichswehr ebenfalls die wirtschaftlich eng mit dem I.G.-Farben-Konzern verknüpfte Selve-Kronbiegel-Dornheim AG (Selkado) als Hersteller von monatlich bis zu 80 Millionen Zündhütchen und 81.000 Reibezündhütchen für Stielhandgranaten vorgesehen.118
Unter Rückgriff auf die Erkundungen der vorangegangenen Jahre ging die Reichswehr nach der NS-Machtergreifung unverzüglich daran, die bis dahin erfassten Betriebe zielgerichtet anzusprechen und die Sondierung zu intensivieren. Bis Mitte 1934 wurden etwa 2.800 von ihnen mit ersten Rüstungsaufträgen bedacht.119 Bereits im August 1934 hatte die Reichswehr – gemessen an der Arbeiterzahl – 59 % der Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbauindustrie erkundet und für den Kriegsfall mit Produktionen belegt. In der Eisen- und Stahlindustrie waren es 56 %, in der Chemieindustrie allerdings nur 25 %.120 Im Untersuchungsgebiet der vorliegenden Studie fanden nahezu alle vom Heereswaffenamt erfassten Firmen Berücksichtigung. Die in den 1920er Jahren angelegten Strukturen blieben erhalten, ebenso die Bevorzugung bestimmter Regionen. Dieses zeigen nicht nur die Industriebetriebe des Großraums Hannover – Braunschweig, sondern ebenfalls die schon in den Entwürfen von 1931 überproportional gewichteten Rüstungsstandorte Sömmerda,121 Suhl/Zella-Mehlis, Gotha, Eisenach und Erfurt.122 Von dieser Entwicklung konnten in beschränktem Umfang auch die Unternehmen in Nordthüringen und dem heutigen Südniedersachsen (Kreise Göttingen, Goslar, Osterode sowie Northeim)123 zehren, die in den frühen Planungen der Militärs zunächst noch keine Berücksichtigung gefunden hatten. Im Zuständigkeitsbereich der Wehrwirtschaftsinspektion Hannover standen im April 1938 nahezu 200 Betriebe als Zulieferer für die Luftwaffenrüstung unter Vertrag. Lediglich die Wehrinspektionen III (Berlin) und VI konnten zu diesem Zeitpunkt mit 351 und 310 mehr Betriebe melden, ein weiteres Zeugnis für die Bedeutung der Rüstungsindustrie im südniedersächsischen Raum, die etwa ein Jahr vor dem Überfall auf Polen in der Luftwaffenrüstung reichsweit den dritten Rang einnahm.124 Nennenswerte rüstungsbedingte Zuwächse verzeichnete insbesondere die Metallindustrie, in Göttingen und Braunschweig vor allem die optischen und feinmechanischen Betriebe.125
Für eine wirtschaftliche Belebung sorgten weiterhin zumeist mit Staatsmitteln gebaute Rüstungsbetriebe, wie das Bosch-Zweigwerk in Hildesheim sowie die schwerpunktmäßig im Oberharz innerhalb weniger Jahre hochgezogenen Sprengstoffwerke und Chemiefabriken. Trotz dieser Anstrengungen konnten selbst die großen niedersächsischen Industriestandorte isoliert betrachtet nicht mit den ‚auf der grünen Wiese‘ errichteten Rüstungszentren Schkopau (Buna) und Salzgitter (Hermann-Göring-Werke) konkurrieren. Jedoch als Einheit gesehen stellten die Betriebe von Hannover über Braunschweig und Salzgitter bis in den Harz einen der bedeutendsten Rüstungskomplexe des Reiches dar.
Die von der Reichswehr in aller Stille getroffenen Vorbereitungsmaßnahmen – nach Abzug der IMKK im April 1927126 mit Billigung der Regierung noch intensiviert – legten die Grundlage der NS-Aufrüstungspolitik. Ohne diesen Vorlauf wäre die rasche und erstaunlich reibungslose Wiederaufrüstung seit 1933 undenkbar gewesen.127 So aber lagen konkrete Belegungspläne der langfristig erfassten Rüstungsbetriebe vor, die genau wie die Blaupausen neuer Waffen nur noch ‚aus der Schublade gezogen‘ werden mussten. In Einzelfällen hatte die Reichswehr schon in den 1920er Jahren durch die Finanzierung und die Aufrüstung einiger ausgewählter Betriebe auf dem Gebiet der Munitions- und Pulverherstellung wichtige ‚Keimzellen‘ geschaffen. Diese Vorarbeiten konnten 1933 ohne innenpolitische Beschränkung nahtlos aufgegriffen werden.