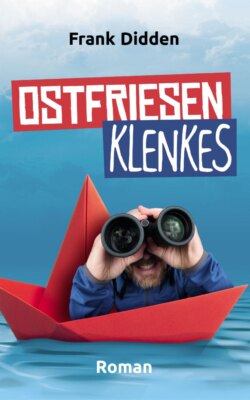Читать книгу Ostfriesenklenkes - Frank Didden - Страница 3
Оглавление1 - Prolog – Der Öcher Klenkes
Sicherlich besteht zu Anfang dieser kleinen Geschichte kein Zweifel darüber, dass die Meisten keinerlei Ahnung haben, was mit dem Begriff des ›Klenkes‹ gemeint ist. Oder gar, was ein ›Öcher‹ ist. Ganz zu Schweigen von der Kombination aus beidem, dem ›Öcher Klenkes‹.
Nun, abgesehen von dem Umstand, dass heutzutage fast jeder Mensch dazu imstande ist, diese Begrifflichkeiten fachgerecht zu ›googeln‹ oder zu ›bingen‹ oder zu ›yahooen‹, soll auch an dieser Stelle beides knapp erörtert werden.
Also:
Der ›Öcher‹ ist nichts anderes als der ›Aachener‹. Für jene unter Ihnen, denen auch der Begriff ›Aachener‹ nichts sagt, das sind die Einwohner der deutschen Grenzstadt Aachen an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden, also demzufolge am Dreiländereck. Die ›Öcher‹, also die Dialektform des gemeinen Aacheners, sind Menschen, ja, lustige und gesellige Lebewesen mit seltsamer Sprache und noch seltsameren Gepflogenheiten.
So macht zum Beispiel mancher ›Öcher‹ Printen an seinen Braten. ›Öcher-Printen‹ selbstverständlich. Oder wenn es keinen Braten gibt, wird gelegentlich ein ›Schwellmann‹ verspeist, zu Hochdeutsch eine Pellkartoffel, eine der ungeschälten Artgenossen der ›Erdäppele‹. Gelegentlich gibt es ›Puttes‹ oder ›Prumm‹ oder ›Plüschprumm‹. Und wenn beides Letztere aus ›Nobbers‹ Garten kommt, schmeckts dem ›Öcher‹ noch besser. Erst recht, wenn der Nachbar später spitz bekommt, wohin seine süßen Früchte verschwunden sind. Dann kann sich der ›Öcher‹ so richtig ausgelassen beschimpfen, eine lokale Leidenschaft, die gerne gepflegt wird. Aus dem ›Frönnd‹ von nebenan, wird dann mal für ein oder zwei Tage, ein ›Tuppes‹ oder gar ein ›Bettseeker. An diesen Tagen werden die seltenen Gespräche der Streithähne grundsätzlich mit ›Mach dor Kopp zu‹ und ›Adieda, Tuppes‹ beendet. Es sind halt nicht immer gesellige Lebewesen, die ›Öcher‹.
Eine weitere Gepflogenheit erwähnenswerten Ausmaßes ist das alljährliche Ereignis des Karnevals. Den feiert der ›Öcher‹ natürlich auch. So ziehen Tausende und Abertausende zu Karnevalszeiten durch die ›Öcher City‹. Dabei sind die ›Öcher Jecken‹ nicht zwangsläufig lustig kostümiert, aber mit hoher Sicherheit lustig zwangsalkoholisiert. Da treiben es die Jecken kunterbunt, oder sagen wir ›pratschjeck‹, auf dem ›Trottewaar‹ ihrer ›Öcher City‹. ›Trottewaar‹, das ist ein Bürgersteig, wie im französischen Trottoir, nur in der vermeintlich richtigen, deutschen Schreibweise. Während dieses karnevalistischen Treibens bewerfen sie sich mit ›hömmele Klömpchen‹, das sind viele Bonbons, und rufen »Oche Alaaf«, nicht zu verwechseln mit »Helau«, das sind die Anderen. In vielen Fällen haben die Aachener aber leider wenig Glück mit ihrem Karnevalswetter. Dann regnet es und sie brauchen einen ›Paraplü‹, also einen Regenschirm, und kalt hat der ›Öcher‹ dann übrigens auch noch. Häufig trifft jedoch zu Karneval das noch schlechtere Wetter den Faschingsumzug der Kinder. Der ist gewöhnlich sonntags, wenn am darauffolgenden Tag der Rosenmontagsumzug ist und das ist nach Karnevalssonntag meistens der Fall. Dann sagt der ›Öcher‹ nur »Och härm«, weil es doch die armen Kinderchen trifft. Aber er sagt »Dubbele Merssi«, wenn am Rosenmontag dann doch für ihn oder sie die Sonne scheint.
Wir könnten hier sicherlich noch weiter über den Aachener Dialekt sprechen, aber man soll bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist.
Sie haben es bestimmt mittlerweile herausgefunden, dass ›Oche‹ Aachen bedeutet. Aber welche Bedeutung hat denn nun der ›Klenkes‹. Nun, kurz übersetzt, ist dies der kleine Finger. Allerdings hat der Klenkes noch eine weitere Bedeutung.
Der ›Klenkes‹ und speziell der ›Öcher Klenkes‹ ist das traditionelle Erkennungsmerkmal, ja, Wahrzeichen von Aachen. Die ›Öcher‹ erkennen sich also auch in fernen Landen am hochgestreckten kleinen Finger der rechten Hand. Nicht zu Verwechseln mit dem Mittelfinger oder anderen Gesten mit den Händen, die weniger romantisch-traditionelle Bedeutungen haben. Der hochgehaltene rechte, kleine Finger zeigt dem schüchternsten ›Öcher‹ selbst in der fernsten Fremde ›Datt is a frönnd‹, oder ›ne Tuppes‹, je nach aktueller Gemütslage.
Und dabei ist die ursprüngliche Herkunft des Aachener Erkennungszeichens weit weniger romantisch, und sagen wir nett, als man eingangs vermuten mag. Die Herkunft des ›Öcher Klenkes‹ geht nämlich auf nichts weiter als Kinderarbeit zurück. Ja, richtig, auf Kinderarbeit. Ach ja, und auf Wuchsfehler von kleinen Fingern von Kindern aufgrund dieser Kinderarbeit. Also vermeidbaren Wuchsfehlern des Fingers.
Im 16. bis 18. Jahrhundert, nur um den Zeitraum grob abzustecken, entstand in und um Aachen in großem Maßstab die Nadelindustrie. Diese Nadelindustrie, die in direktem Zusammenhang zur stark wachsenden Tuchindustrie stand, fand im Aachener Raum bald einige der größten Nadelfabrikanten der Welt. In diesen Nadelfabriken, wo bis zu neunzig Prozent der Belegschaft aus Kindern bestanden, wurden Nadeln aus dünnem Draht hergestellt, die auf der Grundlage der damaligen Technik noch oftmals fehlerbehaftet waren. Es mussten also die schlechten Nadeln von den guten Nadeln getrennt werden. Hört sich fast an wie im Märchen, nur ohne die Linsen und den Prinzen. Und was könnte nun besser die Spreu vom Weizen trennen, als kleine zierliche Kinderfingerchen. Vorzugsweise von diesen zehn kleinen Fingerchen dann auch der Kleinste. So mussten Kinder täglich mit ihren kleinen Fingern, und das war in der Regel der kleine Finger der rechten Hand, zehnstündige schwere Sortierarbeit leisten. Meistens waren das Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren. Die dicken Knubbelfinger der damals berüchtigt fettleibigen Dreizehnjährigen waren hierzu nicht mehr geeignet.
So kann man sich vielleicht vorstellen, dass diese schwere Art der Arbeit auch körperliche Beeinträchtigungen für die damalige Jugend mit sich brachte. So wie heute bei den Jugendlichen eine ausgeprägte Genicksteife durch hohen Smartphonekonsum beobachtet werden kann, so entwickelte sich damals im Laufe der Zeit eine Fehlbildung des kleinen Fingers, anhand derer man den ›Öcher‹ vortrefflich erkennen konnte. Zwar war man zur damaligen Zeit auch nicht stolz auf dieses Merkmal, aber was tut man nicht alles für den Chef.
Diese Sortierarbeit hieß übrigens ›Ausklinken‹, was im Dialekt so viel wie ›Uusklenke‹ heißt. Und so entstand der ›Klenkes‹. Man muss allerdings einräumen, dass das Erkennungszeichen der Aachener erst später als solches auch genutzt wurde. Ab dem 20. Jahrhundert etwa kam es zu einer breiteren Wahrnehmung des ›Öcher Klenkes‹ als eine Art Wahrzeichen.
Nach vielen Jahren, ja, Jahrhunderten, verebbte übrigens der damalige Tuch- und Nadelhype. Beide Industrieformen verschwanden bis heute fast vollständig aus der Aachener Region. Kinderarbeit wurde den Industriellen hierzulande irgendwie zu teuer. Deshalb gingen die meisten von ihnen Richtung Asien, wie zum Beispiel China, Indien oder Bangladesch. Glück für die dortigen Kinder, das handelsübliche ›Uusklenke‹ gibt es nicht mehr. Diese Art der menschenunwürdigen Arbeitsform wurde mittlerweile durch Maschinen oder andere, bessere Fertigungsprozesse ersetzt. Dafür dürfen die ortansässigen Kinderchen jetzt vergnügtem Badespaß im Säurefluss nachgehen. Aber das ist ein anderes Thema.
Der ›Öcher Klenkes‹ ist also das Erkennungszeichen des Aacheners. Auch, wenn dieses Traditionsbewusstsein im Großraum Aachen bei der nachwachsenden Generation, mehr und mehr verschwindet, der ›Öcher Klenkes‹ ist Sinnbild für den Stolz des Aacheners ein Aachener zu sein.
Der ›Öcher Klenkes‹ kann für den Außenstehenden aber noch ein anderes Sinnbild sein. Vielleicht ist das alles auch einfach nur ›jecke Verzäll‹. Der ganze Kram mit dem Sortieren und dem ›Uusklenke‹.
Apropos ›Uusklenke‹, erinnern Sie sich noch an Tobias Renneisen?