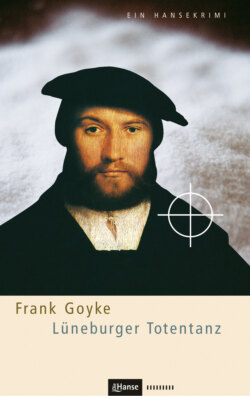Читать книгу Lüneburger Totentanz - Frank Goyke - Страница 10
Vor der Hochzeit
ОглавлениеDie Dampfwolke über der Saline und den hohen Kirchturm von St. Johannis sahen die Reisenden zuerst. Sie kamen aus Rostock und aus Lübeck, und die Rostocker waren vor einem Monat in großer Kälte aufgebrochen, um nun, am 15. März 1433, endlich Lüneburg zu sehen. Sie sahen es, erreicht hatten sie es noch nicht. Die Dampfwolke und der Kirchturm sprachen allerdings vom bevorstehenden Ende der Fahrt, und auch das Kloster Lüne, das sich linker Hand erstreckte, zeigte ihnen, dass sie sich auf dem rechten Weg befanden.
»Heute Abend schlafen wir in einem reichen Haus«, rief der Rostocker Kaufmann und Ratsherr Martin Grüneberg und wandte sich zu seiner Tochter um, die hinter ihm auf dem Planwagen hockte und übernächtigt aussah. Für Margarete war es die erste Reise ihres Lebens. Sie war sechzehn Jahre alt, und in ein paar Tagen würde sie Margarete Stolzfuß sein.
»Ich nicht«, konterte Bruder Anselm, der Franziskaner. Er saß auf dem zweiten Wagen, der keine Plane zum Schutz vor dem Wetter besaß, und hatte gerade sein Gebet zur Non beendet. Martin Grüneberg hatte lange auf seinen Freund und Beichtiger einreden müssen, bevor dieser sich bereit erklärt hatte, als Margaretes Trauzeuge zu fungieren und mit dem Tross nach Lüneburg zu ziehen. Bruder Anselm war zwar welterfahren, schließlich hatte er in Bologna und Paris studiert, aber er war nicht mehr der Jüngste und verließ Rostock nur noch ungern. Für Martin und Margarete Grüneberg hatte er es getan. Das war ihm hoch, sehr hoch anzurechnen.
»Ihr nicht, Ehrwürdiger Vater?« Martin Grüneberg lachte. »In einem Kloster werdet Ihr nächtigen …«
»Darum bitte ich ausdrücklich«, fiel Anselm ihm ins Wort. »Wie Ihr an meiner grauen Kutte und auch an der Tonsur erkennen könnt, bin ich ein Mönch, und Mönche pflegen in Klöstern zu leben. Zumindest zu nächtigen!«
»Und sind die Klöster nicht reich?«
»Die Klöster vielleicht. Ich nicht.« Frater Anselm griff neben sich und förderte einen Apfel zutage. »Im Übrigen möchte ich nicht wieder darüber diskutieren, dass in manchen Klöstern die Ordensregeln gebrochen werden. Das müssen die Brüder mit Gott selber ausmachen. Ich richte nicht, Er wird es tun.«
»Ihr seid immer so nachsichtig, Ehrwürdiger Vater«, meinte Elisabeth Grüneberg, die neben ihrer Tochter auf dem Planwagen saß.
»Bin ich das?« Anselm klopfte dem Wagenlenker auf die Schulter und erbat sich mit einer Geste ein Messer. »Nun, mag sein. Man wird gelassener im Alter und … Wer bin ich denn, dass ich Seine Gerichtsbarkeit vorwegnehme? Dass ich verurteile, wo nur Er urteilen darf? Gott hat nie verlangt, dass wir keine Fehler machen. Er will bloß, dass wir sie erkennen und bereuen. Der reuige Sünder ist ihm der liebste. Vollkommen untadelige Menschen, wenn es sie denn gibt …« Der Franziskaner erhielt vom Wagenlenker ein kleines Messer. »Vollkommen untadelige Menschen«, wiederholte er, »sind monströs.«
»Das sagt Ihr so«, mischte sich Sebastian Vrocklage ins Gespräch, der auch auf dem ungeschützten Leiterwagen einen nicht gerade bequemen Platz gefunden hatte. Sebastian war Grünebergs Geschäftspartner in einer Mascopei, einer Handelsgesellschaft, und ebenfalls zum Trauzeugen erkoren worden.
»Das sage ich.« Der Mönch begann, den Apfel zu schälen.
»Lehnt Ihr also die irdische Gerichtsbarkeit ab?« Sebastian Vrocklage hatte, bevor er das Unternehmen seines ermordeten Vaters übernommen hatte, die Rechte studiert. Er war ein guter Kaufmann geworden, aber manchmal kam doch der Jurist zum Vorschein.
»Mitnichten. Ich frage mich nur, wie gerecht der Mensch sein kann. Ist er fähig, interesselos Recht zu sprechen … so wie Gott?« »Was haben wir nur für gelehrte Männer um uns«, sagte Elisabeth Grüneberg nicht ohne Ironie zu ihrer Tochter. Margarete nickte.
»Bruder Anselm spricht sieben Sprachen«, sagte sie.
»Fünf«, wehrte der Mönch bescheiden ab.
»Pour honte ôter et mal couvrir, on doit un peu par bel mentir«, zitierte Margarete.
»Was heißt das?«, wollte ihre Mutter wissen.
»Um Schande zu tilgen und Böses zu decken, darf man ein wenig die Wahrheit verstecken.«
»Das hast du aber nicht bei mir gelernt«, schnauzte der Franziskaner.
»Nein, Ehrwürden«, räumte Margarete ein, »nicht diesen Spruch, aber die Sprache.«
»In dieser Sprache wurden große Lieder und Romane abgefasst«, meinte Anselm. »Denk an Chrétien de Troyes, mein Kind, an seinen Roman über den Tod von König Artus.«
»Aber auch das Italienische ist eine bedeutsame Sprache«, sagte Margarete und lächelte.
»Die Sprache der Buchführung«, sagte Sebastian Vrocklage trocken.
»Nun ja.« Der Mönch schaute weg.
»Unser hochverehrter Vater Anselm liest nämlich den Boccaccio in der Originalsprache«, behauptete Margarete. Ratsherr Grüneberg warf einen Blick in den anderen Wagen. Der Franziskaner hatte den Kopf eingezogen und war tatsächlich rot geworden.
Ihren künftigen Schwiegervater lernte Margarete am Lüner Tor kennen. Reyner Stolzfuß hatte sich nicht nehmen lassen, seine Gäste und die Braut persönlich zu empfangen, was ihnen den Einzug nach Lüneburg ungemein erleichterte; die Torwache wagte nicht, ihnen auch nur eine Frage zu stellen. Die Anwesenheit eines Proconsuls bedeutete mehr als eine schriftliche Bürgschaft, Gäste eines Bürgermeisters waren über jeden Zweifel erhaben.
Stolzfuß hatte auch seinen Sohn mitgebracht, Tidemann, den Bräutigam. Sie waren hoch zu Ross, aber als die beiden Wagen das Lüner Tor erreichten, saßen sie ab. Mit ausgestreckten Armen eilte Reyner auf Martin Grüneberg zu, der vom Kutschbock gesprungen war. Die beiden Männer gaben sich den Bruderkuss, dann halfen sie den Damen aus dem Wagen. Tidemann kam vorsichtig näher. Die Eheverhandlungen hatten sein Vater und Grüneberg geführt, nun sah er seine Braut zum ersten Mal. Als er Margarete höflich begrüßte, errötete er. Das Mädchen auch.
»Sei auch du mir willkommen, Lüdeke!« Reyner Stolzfuß, der ein etwas vierschrötiger, aber leutseliger und herzlicher Mensch war, breitete abermals die Arme aus. Mit dem Sohn des Lübecker Salzherrn Lüdeke Peters, mit Piet Peters, war seine Tochter Geseke verheiratet, und das bedeutete, was da aus Lübeck und Rostock angereist war, war Familie oder würde bald Familie sein.
»Ihr seid sicher hungrig und durstig?«, wollte Reyner Stolzfuß wissen. »Halten wir uns hier nicht auf. In meinem Haus ist der Tisch gedeckt, ich bitte euch alle, mir die Ehre zu erweisen. Auch Euch gilt mein Gruß, Ehrwürdiger Vater!« Stolzfuß verbeugte sich vor dem Mönch, der mühsam vom Wagen herabgeklettert war und sich den Rücken massierte.
»Danke, mein Sohn.« Frater Anselm streckte seine Hand nach dem mächtigen Mann aus, der sie küsste. »Ich werde natürlich nicht in Eurem Hause wohnen, sondern bei meinen Brüdern im Kloster Sankt Marien.«
»Ihr habt einen guten Ruf, Ehrwürden«, meinte Stolzfuß. »Ihr geltet als ein äußerst gelehrter und belesener Mann. Der Guardian von Sankt Marien ist schon ganz gespannt auf Euch.«
»Er wird auch die Bücher kennen«, murmelte Anselm.
»Die Teilnahme an einem bescheidenen Mahl in meinem Hause schlagt Ihr mir doch aber nicht ab?«
»Wie werde ich!« Anselm klopfte dem Bürgermeister sacht auf die Schulter. »Drei Dingen, mein Lieber, gilt meine Hochachtung. Ich liebe und verehre Gott, ich liebe und verehre den heiligen Franz von Assisi und … ich liebe und verehre eine gute Küche.«
»Und einen guten Tropfen?«
»Ihr schaut auf den Grund meiner Seele, Freund«, erwiderte der Mönch.
Ein Haus wie das der Stolzfuß’ hatte Margarete noch nie gesehen. Ihr Vater war einer der reichsten Männer Rostocks, aber verglichen mit dem, was ihr künftiger Ehemann ihr zeigte, hatte Margarete bisher in bescheidenen Verhältnissen gelebt. Tidemann durfte natürlich nicht allein mit Margarete sein. Hildegard Stolzfuß, die Frau des Hauses, war bei dem Gelage unabkömmlich, also hatte sich Maria Peters erboten, die jungen Leute anstandshalber zu begleiten. Maria war seit zwanzig Jahren mit dem Lübecker Salzherrn Lüdeke Peters verheiratet, und seit drei Jahren war sie die Schwiegermutter von Tidemanns Schwester Geseke.
»Dies ist unsere Familienkapelle«, erklärte Tidemann und zeigte in einen kleinen Raum. »Der Altar stammt von einem berühmten flämischen Meister. Er ist sehr kostbar.«
Margarete hatte nichts anderes erwartet. Die Führung durch das Haus, in dem alles kostbar war, ermüdete sie. Zum ersten Mal war sie dem Mann nahe, mit dem sie ihr ganzes Leben verbringen würde, und sie sprachen nicht über Pläne, sondern über nichts sagende Dinge. Vermutlich war alles schon festgelegt. Von flämischen Meistern mochte Margarete nichts hören; der Junge, an dem ihr Herz einst hing, war in Flandern umgekommen.
»Ich denke, wir sollten zu den anderen zurückkehren«, schlug sie daher vor.
»Ihr wünscht zu speisen, meine Teure?«, erkundigte sich Tidemann formvollendet. Margarete hatte immer einen Abenteurer zum Mann haben wollen, notfalls sogar einen Kaperfahrer. Nun würde sie einen heiraten, der so interessant war wie unbeschriebenes Papier.
»Das wünsche ich«, sagte sie. Maria Peters war von der höflichen Konversation der Brautleute ganz gerührt.
In dem Saal, der das erste Stockwerk über der Diele einnahm, ging es hoch her. Nach der ersten Tracht, nach Schinken und Rinderbraten, war soeben der zweite Gang aufgetragen worden, gesottener Hirsch. Wein und Bier gab es sowieso. Die Mägde und Knechte hatten alle Hände voll zu tun, die Herrschaften fielen über die Speisen her wie ein Heuschreckenschwarm. Sogar Frater Anselm, der Mäßigung predigte, war ins Schwitzen geraten. Margarete gönnte ihm das Vergnügen. In ihrer Achtung stand der Mönch auf einer Stufe mit dem Vater, denn sie beide waren ehrlich. Das konnte man nur von ganz wenigen Menschen sagen. Margarete war wach genug, um zu erkennen, dass die Lüge längst begonnen hatte, den Baum des Lebens an der Wurzel anzunagen. Sogar heilige Instanzen wie der Kaiser Sigismund und der Papst logen; bereits vor Jahren hatten sie den Sieg über die Hussiten erklärt, doch in Wahrheit führten sie noch immer Krieg. Die Hussiten schienen unbesiegbar zu sein, aber das durfte man nicht einmal denken, geschweige denn aussprechen.
»Ihr seid nachdenklich, meine Liebe?«, fragte Tidemann. Margarete mochte seinen süßlichen Ton nicht. Er weckte in ihr die Lust zu provozieren.
»Nun, mein künftiger Gebieter«, fragte sie laut, »was haltet Ihr von den Forderungen der Taboriten?«
Tidemann Stolzfuß wurde blass, die Tischgesellschaft erstarrte. Es war üblich, über dieses Thema nur hinter vorgehaltener Hand zu sprechen, denn die Taboriten waren Ketzer. Zumindest hatte Papst Martin V., der Initiator des noch immer tagenden Basler Konzils, die Anhänger des Jan Hus zu Ketzern erklärt, und sein Nachfolger Eugen IV. hatte das Verdikt nicht aufgehoben. Eugen war nicht beliebt, sein Vorgänger schon, aber auch erst seit seinem Tod: Nachdem Martin V. im Jahr des Herrn 1431 die Segel gestrichen hatte, war allen Gebildeten bewusst geworden, was sie an dem klugen und diplomatisch geschickten Stellvertreter Gottes gehabt hatten. Martin hatte die Kirchenspaltung beendet. Das sollte ihm erst einmal jemand nachmachen.
»Es schickt sich nicht für Frauen, darüber zu sprechen«, wies Martin Grüneberg seine Tochter zurecht.
»Warum nicht, Vater?«
»Das wird dir deine Mutter heute Abend beim Bade erklären«, sagte Grüneberg. Die Bediensteten trugen den nächsten Gang auf, geschnittenes Schaffleisch. Margarete nahm bei ihrer Mutter Platz, Tidemann setzte sich zu seinem Vater. »Sie ist noch jung und unerfahren«, erklärte Grüneberg seinem Tischnachbarn, dem Lübecker Salzherrn Peters.
»Gott, so dumm war ihre Frage ja gar nicht«, erwiderte Lüdeke. »Da sie nun einmal im Raum steht … Wir haben doch einen Kundigen in Euch, Ehrwürdiger Vater?«
Bruder Anselm, der gerade von dem Schaffleisch genommen hatte, verschluckte sich und bekam einen Hustenanfall. Seine Meinung über die Hussiten war nicht kirchenkonform, daher verschwieg er sie lieber. Um von dem unangenehmen Thema abzulenken, befahl der Hausherr einer Gruppe von drei Musikern, den Gästen aufzuspielen. Anselm atmete auf.
Der Mönch überstand auch die letzte Tracht, die aus Gebäck, Butter, Käse, Äpfeln und Nüssen bestand, ohne sich zu dem heiklen Gegenstand äußern zu müssen. Der Hausherr bestritt nun das Gespräch, das sich ums Salz drehte. Bruder Anselm wusste natürlich, wie wertvoll das weiße Lüneburger Siedesalz war, das sich in der Qualität sichtbar und fühlbar von den grauen, feuchten Salzklumpen aus der Baie unterschied. Die Männer, die an Stolzfuß’ Tisch saßen und speisten, hatten alle mit dem Salz zu tun. Reyner Stolzfuß war Sülfmeister, der Pächter von vier Siedepfannen, die dem Michaeliskloster gehörten, Lüdeke Peters handelte mit dem Salz, das aus Lüneburg nach Lübeck geschafft und von dort aus als Travensalz verkauft wurde. Und auch sein Freund Martin Grüneberg, der Rostocker Kaufmann, war – unter anderem – im Salzhandel aktiv.
»Bei der letzten Salprobe mussten wir feststellen, dass sich zu viel Gottestod mit der Sole vermischt hat«, sagte Reyner Stolzfuß.
»Gottestod? Was ist Gottestod?«, wandte sich Margarete an Bruder Anselm. Der zuckte die Schultern.
»Gott, mein Kind, ist natürlich unsterblich«, dozierte Stolzfuß. »Das Salz ist eine Gottesgabe. Es erhält Leben, es schützt vor Fäulnis und Verwesung und gilt als Sinnbild der Ewigkeit. Jesus hat seine Jünger mit dem Salz verglichen …«
»Wohl war«, bestätigte Anselm nuschelnd, denn er hatte eine Nuss im Mund.
»Das Süßwasser, Margarete, nennen die Sodkumpane Gottestod«, fuhr der Sülfmeister fort. »Wenn es sich mit der Sole vermischt, verdirbt es das Salz.«
»Genauer gesagt«, ergänzte sein Sohn, »wird das Salz natürlich nicht schlecht. Viel süßes Wasser in der Sole verringert nur den Ertrag.«
»Und dann verdient ihr weniger Geld?«, fragte Margarete.
»Ja, dann verdienen wir weniger Geld«, sagte Reyner Stolzfuß und lachte.
»Wo werdet ihr«, ereiferte sich Lüdeke Peters. »Ihr setzt den Preis herauf und kommt auf diese Weise trotzdem ins Reine.«
»Diesmal nicht«, sagte Stolzfuß leise und senkte den Blick.
»Nein?«, fragte Peters. Aus dem Anverwandten war der Geschäftsmann geworden, der gute Quoten witterte.
»Weil Ihr ein Gevatter seid, Lüdeke, sage ich’s Euch. Die Sole der letzten Wochen war nicht gut. Wir können den Preis nicht heraufsetzen, ohne uns ins eigene Fleisch zu schneiden. Ich bin kompromissbereit, Lüdeke. Sagt mir, was Ihr für eine Tonne gebt.«
»Wir sind verwandt, Reyner. Ich zahle den Preis vom letzten Jahr.«
»Das ist hart«, meinte Tidemann.
»Ich habe auch meine Aventure«, sagte Peters, womit er das wirtschaftliche Risiko meinte.
»Du hast doch immer Abnehmer«, sagte Geseke, die geborene Stolzfuß, die nun eine Peters war. »Deine Partner in Reval lecken sich alle Finger nach dem Travensalz.«
»Weiber!« Lüdeke Peters schüttelte den Kopf. »Warum näht man ihnen den Mund nicht zu?«
»Du sprichst von meiner Tochter«, protestierte Reyner.
»Es ist eine Verschwörung«, sagte Lüdeke, »aber ich bin überzeugt. Einen halben Pfennig mehr pro Tonne.«
»Danke«, sagten Reyner und Tidemann wie aus einem Munde.
»Und jetzt will ich Wein«, rief Lüdeke. Wein wollten alle anderen auch.
»Deine Tochter, Martin, ist sehr selbstbewusst«, sagte Reyner Stolzfuß. Wie es üblich war, hatte Tidemann als künftiger Ehegatte alle Freunde und alle Verwandten ins Badehaus geladen, um sich dort seinen Status als Lediger abzuwaschen. Im Grunde ging es natürlich darum, sich ordentlich zu betrinken. Deshalb war Bruder Anselm der Einladung nicht gefolgt; er hatte bei dem Gelage am Nachmittag dem Wein genug zugesprochen und musste sich auf seine religiösen Pflichten besinnen.
»Ich habe sie Schreiben und Lesen lernen lassen«, sagte Grüneberg. Eine junge Frau, die auch für andere Beschäftigungen zur Verfügung stand, massierte ihm den Rücken.
»Bei diesem Mönch?«, wollte Lüdeke Peters wissen.
»Bruder Anselm ist wirklich sehr gebildet«, sagte Grüneberg.
»Eure Tochter beherrscht auch fremde Sprachen?«, fragte Tidemann.
»Französisch und Italienisch«, sagte Grüneberg. »Sie hat beides beim Ehrwürdigen Vater gelernt. Latein natürlich sowieso.«
»Ich kann nur Deutsch«, gab Tidemann zu.
»Dann wirst du morgen eine Frau heiraten, die dir überlegen ist«, sagte Reyner Stolzfuß und knuffte seinen Sohn in die Seite.
»Kann man eine solche Frau überhaupt bändigen?«
»Dir als Ehemann steht das Züchtigungsrecht zu«, erklärte Sebastian Vrocklage, aus dem wieder mal der Jurist lugte.
»Seine Frau zu schlagen ist ein Zeichen von Schwäche«, meinte Piet Peters. Alle schauten erstaunt zu ihm, denn bisher hatte er geschwiegen.
»Das sagst du nur, weil du mit einer Stolzfuß verheiratet bist«, sagte Reyner jovial. »Die Stolzfüßinnnen haben Haare auf den Zähnen.«
»Gibt’s denn noch andere außer deiner Frau und Geseke?« Piet Peters, das stille Wasser, legte einen Hinterhalt.
»Das ist doch egal«, sagte sein Vater sofort.
»Abgeschobene Hexen zum Beispiel?«, fragte Piet.
»Wenn du nicht aufhörst zu sticheln«, schimpfte Lüdeke, »werde ich mein väterliches Züchtigungsrecht in Anspruch nehmen.«
»Ich kann auch Französisch und Italienisch«, wehrte sich Piet.
»Was nützt es dir? Du wirst Margarete ja nicht ehelichen.«
Elisabeth Grüneberg, Hildegard Stolzfuß, Maria Peters und ihre Schwiegertochter Geseke saßen noch in dem großen Holzbottich und tranken Wein, Margarete hatte das Bad verlassen und lag auf einer Pritsche, um sich von der Bademutter schröpfen zu lassen. Die Blutegel sollten das Schlechte aus ihren Säften abziehen, damit sie bei der Hochzeit noch besser aussah; die Mutter hatte zwar versichert, dass sie das schönste Mädchen der Welt sei, aber natürlich glaubte sie als Sechzehnjährige es nicht.
»Du weißt, Kind, was Paolo da Certaldo über die Frauen gesagt hat?« Elisabeth Grüneberg gedachte nun, ihre Erziehungspflichten zu erfüllen.
»Aber Mutter, das hast du mir schon hundertmal vorgelesen«, stöhnte Margarete.
»Hundertmal sicher nicht«, entgegnete Elisabeth.
»Wer, in Gottes Namen, ist Paolo da Certaldo?«, erkundigte sich Geseke Peters.
»Ein Moralschriftsteller aus Italien.«
»Aus Italien, soso!« Die Frauen nickten. Von italienischen Männern hörte man, dass sie allesamt Frauenkenner waren und es mit der Moral eigentlich nicht so genau nahmen.
»Mutter, ich bitte dich!« Margarete schüttelte sacht den Kopf. Die Bademutter setzte ihr noch ein paar Egel auf den Rücken. Elisabeth Grüneberg ließ sich nicht bremsen.
»Das Weib soll der Jungfrau Maria nacheifern, die auch nicht aus dem Haus ging, um sich überall zu unterhalten, nach hübschen Burschen zu schauen oder eitlem Geschwätz ihr Ohr zu leihen«, zitierte sie. »Nein, sie blieb daheim, hinter verschlossener Türe, in der Privatheit ihrer Wohnung, wie es sich ziemt.«
»Einen solchen Rat soll man einer künftigen Ehefrau durchaus geben«, meinte Maria Peters.
»Ich lasse mich aber nicht einsperren«, protestierte Margarete. »Von niemandem, auch nicht von meinem Mann.«
»Das wirst du noch lernen, Kind«, sagte Elisabeth. »Der Platz der Gattin ist das Haus.«
»Nimm dir ein Beispiel an dem, was Elisabeth sagt«, verlangte Hildegard Stolzfuß von ihrer Tochter Geseke.
»Mein Mann hat keinen Grund, sich über mich zu beklagen.«
»Aber gehst du nicht manchmal hinaus, um mit den Nachbarinnen zu schwätzen?«
»Das tut doch jede Frau«, sagte Geseke.
»Nicht die tugendsame«, behauptete Maria.
»Die macht’s heimlich«, sagte Hildegard Stolzfuß. Die Frauen lachten.
Der Mann, der sich Albrecht Gregorius nannte, war im Gasthof Bei der Ratsmühle abgestiegen. Er würde einige Tage in Lüneburg verbringen, und als dem Vertreter des Revaler Kaufherrn Ahlemann begegneten ihm Wirt und Wirtin mit Hochachtung. Sie hatten ihm eines ihrer besseren Zimmer zur Verfügung gestellt, wofür sie allerdings auch ein beachtliches Entgelt verlangten, sie speisten ihn mit Ochsenzunge in Senfsoße und gaben ihm einen Wein zu trinken, der auch einem Mann von Adel gemundet hätte. Albrecht Gregorius war zufrieden. Es gab keinen Grund zu zweifeln, dass alles nach Plan verlaufen würde.
Am Nachmittag hatte Gregorius seinen Spießgesellen letzte Instruktionen erteilt und jedem eine rigische Mark zugesteckt als Vorschuss für die Erledigung des Auftrags. Die Brüder Ants und Mihkel Päätelpoeg wohnten natürlich nicht so vornehm wie er, sondern waren in einer billigen Herberge am Stadtrand untergekommen. In ihrem offiziellen Leben waren sie Fuhrknechte, die Waren vom Revaler Hafen in die Stadt beförderten, aber ihr Geld verdienten sie vor allem mit Gaunerei, Gewalttat und Mord. Albrecht Gregorius, der für seinen Dienstherrn das Grobe erledigte, hatte mehrere Wochen gebraucht, bevor er im Vorort Vischermaye auf die beiden Berufsverbrecher gestoßen war. Nur einmal noch würde er sie treffen, um ihnen ihr Salär auszuzahlen, dann würden sich ihre Wege für immer trennen. So war es geplant. Gregorius verachtete sie, denn sie waren ungebildet und brutal. Doch für seine Mission waren sie brauchbar. Nur darauf kam es an.
Albrecht Gregorius winkte dem Wirt und bestellte noch einen Krug Wein. Ihm gefiel die Rolle, die er spielte: Der Wolf im Schafspelz zu sein war ihm beinahe schon Natur. Niemand ahnte, was er vorbereitet hatte. In dem Gasthaus galt er als Ehrenmann. Der Krüger verneigte sich sogar, als er den Wein kredenzte.
»Wart Ihr mit der Zunge zufrieden?«, erkundigte er sich.
»Sehr«, sagte Gregorius.
»Nicht wahr? Wir legen sie in Milch ein, damit sie schön zart wird. Darf ich Euch auch unser Nusskonfekt empfehlen?«
»Ich bin gesättigt, Wirt. Aber tut mir den Gefallen, setzt Euch zu mir und nehmt von dem Wein.«
»Herzlichen Dank!« Der Wirt ließ sich von seiner Frau einen Becher bringen und bediente sich aus dem Krug.
»Morgen, so hört man, wird es eine wichtige Hochzeit geben?«, sagte Gregorius.
»Oh ja«, bestätigte der Wirt. »Ganz Lüneburg wird auf den Beinen sein. Immerhin heiratet der Sohn eines unserer Bürgermeister.«
»Stolzfuß, wenn ich nicht irre.«
»Ihr irrt nicht. Reyner Stolzfuß ist einer der angesehensten Männer unserer Stadt. Er hat eine Pacht auf der Saline und ist sehr reich.«
»Und dessen Sohn heiratet?«
»Tidemann«, sagte der Krüger. »Tidemann Stolzfuß heiratet eine Rostocker Kaufmannstochter.«
»Ich habe Geschäfte mit Herrn Stolzfuß«, sagte Gregorius.
»Ihr seid ein bedeutender Mann«, schmeichelte der Wirt. »Und gewiss werdet Ihr an der Hochzeit teilnehmen.«
»Allerdings«, sagte Gregorius. »Ich gehöre zwar nicht zu den geladenen Gästen, aber ein solches Ereignis lässt man sich nicht entgehen.«