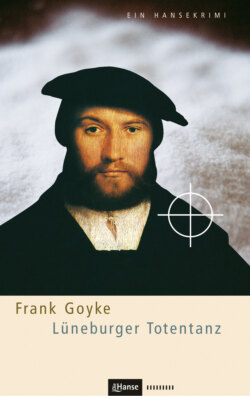Читать книгу Lüneburger Totentanz - Frank Goyke - Страница 14
Kopfweh
ОглавлениеIm Kloster Sankt Katharinen riefen die Glocken zum Morgenlob, aber Bruder Anselm war nicht in der Lage, sich zu erheben. All seine Glieder schmerzten, aber am schlimmsten litt sein Kopf. Ihm war, als hätte man seine Hirnschale mit kochendem Öl gefüllt, das nun hin und her schwappte, wenn er sich nur ein wenig rührte. Mit einem solchen Kopf war man kein Mensch.
Mit äußerster Anstrengung gelang es dem Mönch, die Augen zu öffnen. Das Dormitorium war leer. Alle Brüder waren jetzt in der Kirche, doch ihn hatte man in Ruhe gelassen; vermutlich konnte man riechen, wie es um Anselm bestellt war. Er hatte sich zu übermäßigem Alkoholgenuss verführen lassen. Das war eine große Sünde, und auch sein Ruf war vermutlich dahin.
Bruder Anselm hob den Kopf. Die Decke des Dormitoriums begann zu kreiseln.
»Wie entsetzlich«, stöhnte der Mönch. Aber er war ein disziplinierter Mann, und nach mehreren Anläufen gelang es ihm, die Pritsche zu verlassen. Er schlüpfte in die Sandalen, und mit kurzen, behutsamen Schritten trippelte er aus dem Schlafsaal. Nur einer konnte ihm jetzt helfen: der Bruder Arzt.
Während er den Kreuzgang entlangging, hörte Anselm den Gesang der Mönche. Sie priesen Gott in den höchsten Tönen, doch er selbst haderte mit dem Herrn, schließlich musste auch der Wein Gottes Werk sein. Anselm hätte sehr viel darum gegeben, wenn der Herr den Menschen das Keltern der Traube nicht gezeigt hätte. Allerdings tat die frische Luft ihm wohl. Der Kopf schmerzte noch, aber die Glieder ließen sich schon wieder etwas besser bewegen.
Im Domus Medicorum, dem Spital des Klosters, musste Anselm noch eine Zeit lang warten, denn auch der Bruder Spittler musste am Gottesdienst teilnehmen. Als er den Rostocker sah, wusste er sofort Bescheid.
»Ich werde dich mit ein paar heilkräftigen Kräutern aus meinem Garten traktieren, und du wirst sehen, rasch ist dir wieder wohl«, sagte er.
»Tausend Dank, Bruder.« Frater Anselm massierte sich die Stirn.
»Wir alle haben Verständnis«, sagte der Spittler. »Du hast wohl gestern einen Freund verloren?«
»So gut kannte ich Peters nicht«, meinte Anselm.
»Erzähl mir, was geschehen ist«, bat der Spittler. Er öffnete ein paar Schubladen, entnahm ihnen getrocknete Blüten, Pflanzenstängel und Wurzeln und zerstieß sie in einem Mörser. Anselm erstattete Bericht.
»Das kommt mir irgendwie bekannt vor«, sagte der Bruder Arzt, als er die Kräuter in Wasser rührte.
»Was kommt dir bekannt vor?«, wollte Anselm wissen.
»Schon als die ersten Gerüchte zu uns drangen, hatte ich so ein Gefühl. Aber jetzt, nachdem du mir noch einmal den Hergang erzählt hast … Kennst du Josephus Flavius?«
»Natürlich«, sagte Anselm. Der Spittler füllte den Kräutersud in einen Becher und reichte ihn dem Rostocker. »Ihr denkt an die Geschichte des Judäischen Krieges? Aber was hat das mit dem Mord an Lüdeke Peters zu tun?«
»Die Sikarier«, sagte der Spittler. Anselm kam das reichlich verschwommen vor.
»Die Sikarier?«
»Warte. Ich rufe einen Novizen und lasse mir das Buch aus der Bibliothek beschaffen.«
Der Spittler verließ die Krankenstation, Bruder Anselm trank langsam den Sud. Er schmeckte gallebitter, und als der Bruder Arzt nach fünf Minuten zurückkehrte, waren die Kopfschmerzen noch immer nicht kuriert. Allerdings regte sich Anselms Magen; plötzlich bekam der Mönch einen Bärenhunger.
»Wie geht’s?«, erkundigte sich der Spittler.
»Aufwärts«, log Anselm. Dann brachte der Novize das Buch.
Der Spittler brauchte fast eine halbe Stunde, um die Textstelle zu finden, auf die er es abgesehen hatte. Bruder Anselm starb währenddessen tausend Tode. Sein Hunger war unmäßig geworden, und in seinem Hirn spielten noch immer Dutzende Posaunisten. Vermutlich hätte er statt des Kräutersuds lieber einen Becher Wein leeren sollen.
»Hier!« Der Bruder Spittler reichte Anselm das aufgeschlagene Buch. Der Rostocker Mönch las laut, was Josephus Flavius über die Sikarier geschrieben hatte.
»Sie begingen am hellen Tage und mitten in der Stadt Morde, mischten sich besonders an Festtagen unter das Volk und erstachen ihre Gegner mit kleinen Dolchen, die sie unter der Kleidung versteckt trugen. Stürzten ihre Opfer zu Boden, so beteiligten sich die Mörder an den Kundgebungen des Unwillens und waren durch dieses unbefangene Benehmen gar nicht zu fassen.«
»Und?«, fragte der Spittler.
»Der Dolch war eher lang«, erwiderte Anselm.
»Du verstehst nicht, was ich meine?« Der Spittler war enttäuscht.
»Doch, Bruder, sehr gut sogar«, sagte Anselm und sprang auf.
»Ihr seht schlecht aus, Ehrwürdiger Vater«, stellte Martin Grüneberg fest. Der Mönch hatte ihn wie erwartet im Haus des Reyner Stolzfuß angetroffen. Dort war man gerade vom Speisetisch aufgestanden, was dem Mönch wieder seinen Heißhunger in Erinnerung brachte: Das Schlimme war, dass er ihn nicht stillen konnte, denn sein Magen bohrte zwar, Anselm brachte aber keinen Bissen hinunter. Die Wirkung des Kräutersuds ließ immer noch auf sich warten.
»Der Ritter hat mich geschafft«, bekannte Bruder Anselm.
»Uns alle«, sagte Grüneberg. »Mit dem kann keiner mithalten.«
Die Stimmung im Haus war immer noch gedrückt. Vor allem die Frauen und hier wiederum die am Tag zuvor unerwartet zur Witwe gewordene Maria Peters machten einen leidenden, verhuschten Eindruck. Offenbar war viel geweint worden in der letzten Nacht.
Reyner Stolzfuß unterbreitete den Vorschlag, seinen Gästen aus der Fremde die Saline zu zeigen. Er hatte dort ohnehin zu tun und meinte, ein wenig Ablenkung könnten wohl alle gebrauchen. Wenig später rüstete man zum Aufbruch und befahl den Dienstboten, die Pferde zu satteln. Bruder Anselm schloss sich an. Er war ein schlechter Reiter, aber den Weg zur Saline auf dem Pferderücken zurückzulegen, traute er sich zu.
Der Sülfmeister Stolzfuß lenkte die kleine Gesellschaft so, dass er den großen Platz Am Sande umging. Dort wurde ein Teil des Salzes zum Verkauf angeboten, dort belud man die Fuhrwerke der Kaufleute, die nach Osten reisten und die Stadt durch das Altenbrücker Tor verließen. Die Johanniskirche schloss den Platz im Osten ab. Reyner Stolzfuß wollte der Witwe den Anblick des Ortes ersparen, an dem ihr Mann Meuchelmördern zum Opfer gefallen war.
Alle folgten ihm durch die Glocken- und die Untere Schrangenstraße, bis er nach Süden in die Kuhstraße bog. Die Glockengießerstraße wurde gekreuzt, dann die Heiliggeiststraße in Angriff genommen; sie führte direkt auf den Platz, auf dem sich die Lambertikirche erhob, und hinter der Kirche befand sich das Tor zur Sülte.
Zu spät fiel Reyner Stolzfuß ein, dass der Ritter von Ritzerow im Gasthof Zu den vier trunkenen Sonnen neben dem Heilig-Geist-Spital Quartier bezogen hatte. Nach der Zecherei vom Vorabend mochte ihm niemand begegnen, und unwillkürlich dämpften die Männer ihre Stimmen, als sie an der Herberge vorbeiritten. Jeder nahm offenbar an, der Ritzerow schlafe noch und könne durch zu lautes Sprechen auf der Straße geweckt werden.
Sie hatten sich geirrt. Der Ritter, der in der Gaststube beim ersten Schoppen Wein gesessen und aus dem Fenster geschaut hatte, war rascher bei seinen neuen Freunden, als diesen lieb war. Natürlich war es nicht möglich, ihn abzuwimmeln, ohne die Höflichkeit zu verletzen. Da auch der Ritter gern die Saline sehen wollte, wurde er von Reyner Stolzfuß kurzerhand aufgefordert, sich anzuschließen.
»Der Mann ist ja wie der Teufel«, flüsterte Anselm, der sich mit Martin Grüneberg ein paar Pferdelängen hatte zurückfallen lassen. Gerade hatte er dazu angesetzt, dem Rostocker Weddeherrn den Verdacht des Spittlers auseinander zu setzen. »Man muss nur an ihn denken, dann erscheint er schon.«
»Unser Ritter ist einfach unverwüstlich«, stellte Grüneberg fest. »Aber Ihr wolltet etwas anderes sagen, Ehrwürdiger Vater.«
»Ja.« Anselm berichtete von dem Einfall des Bruders Arzt, der im Bellum Iudaicum des Josephus Flavius einen Hinweis auf die Täter gefunden haben wollte.
»Dann muss ein kluger, belesener Kopf hinter dem Anschlag stecken«, meinte Martin Grüneberg nachdenklich. »Schließlich ist die Geschichte des Judäischen Krieges kein Erbauungsbuch, das jeder kennen sollte. Und die beiden Ausführenden, die wir unter uns ja getrost die Sikarier nennen können, sie schienen mir eher grobschlächtig und bäurisch zu sein.«
»Das mag sein. Aber Ihr sagt es selbst: Es waren nur die Ausführenden. Der Plan muss von einem anderen stammen.«
Am Ende der Heiliggeiststraße wurde wieder die Rauchwolke sichtbar, die sich über der Saline erhob. Da der Wind aus Norden wehte, trieb der Qualm nach Süden aus der Stadt.
»Das sieht ja wie die Hölle aus«, sagte Bruder Anselm.
»Wir haben schließlich auch einen Teufel im Gefolge«, sagte Martin Grüneberg und lächelte unwillkürlich, obgleich ihm nicht danach zumute war.
Vor dem Tor zur Sülte brach Maria Peters zusammen. Hinter Tor und Mauern, die das Salzbergwerk auch zur Stadt hin abschlossen, wurde der Stoff gewonnen, mit dem ihr Mann gehandelt hatte und reich geworden war. Maria Peters fürchtete nicht um den Verlust des Wohlstands, schließlich würde Sohn Piet das väterliche Geschäft fortführen. Doch alles, was mit dem Salz zu tun hatte, erinnerte an Lüdeke. Nachdem alle von den Pferden abgesessen waren, konnte Maria Peters keinen Schritt vorwärts setzen. Sie schien einer Ohnmacht nahe zu sein, also blieben ihr Sohn und die Schwiegertochter Geseke zurück, um sich um sie zu kümmern und sie notfalls zurück in das Haus Am Berge zu begleiten.
Die übrige Gesellschaft machte sich auf den Weg durch das Tor. Eigentlich war es Fremden nicht gestattet, die Saline zu betreten, aber der Begleitung eines Bürgermeisters verweigerte die Wache den Zutritt nicht. Jeder fühlte sich nach dem Zusammenbruch der gebeutelten Frau beklommen, und man hatte wohl auch ein schlechtes Gewissen, weil man seiner Neugierde nachgab; allerdings wusste man Maria Peters in guten Händen.
Nach dem Betreten der Sülte fielen sofort die riesigen Stapel von Holz ins Auge, das zum Betrieb der Siedepfannen benötigt wurde. Mittlerweile hatten die Salinenpächter alles Holz in der Umgebung Lüneburgs aufgekauft und verbraucht, so dass eine Heidelandschaft entstanden war. Der Brennstoff kam nun aus Mecklenburg, wo noch riesige Wälder zur Verfügung standen, aber auch an den Ufern des Stecknitzkanals wurde Holz geschlagen. Die Holzschiffer brachten es bis Lauenburg, wo es dann über Elbe und Ilmenau nach Lüneburg geflößt wurde. Hier verbrannte man es.
Ärmlich gekleidete Frauen füllten Holzeimer mit dem Brennstoff und trugen sie auf dem Kopf zu den Siedehütten. Vierundfünfzig dieser Hütten umgaben den Solebrunnen. Sie waren in Senken errichtet oder in die Erde eingegraben worden, so dass man nur ihre strohgedeckten Dächer sehen konnte. Aus dem Sod schöpften mehrere Sodeskumpane die Sole und gossen sie in Rinnen, die mit den Siedehütten verbunden waren. Aus deren Essen rauchte es heftig.
»Kennt Ihr die Sage von der Salzsau?«, wollte Reyner Stolzfuß wissen. Frau Hildegard, Tidemann und Margarete nickten, die anderen schüttelten den Kopf.
»Du kennst sie?«, wandte sich Elisabeth Grüneberg an ihre Tochter.
»Tidemann hat sie mir erzählt, Mutter«, entgegnete Margarete. »Uns war in der Hochzeitsnacht nur danach, miteinander zu sprechen.«
»Das sollte aber nicht sein«, meinte Elisabeth.
»Aber Mutter, nach diesem Todesfall … Wer kann denn überhaupt noch an etwas anderes denken?«
»Als es die Stadt noch gar nicht gab und die Gegend mit Wald bedeckt war«, erzählte Stolzfuß, »da sollen mehrere Jäger Wildschweine gejagt haben. Sie folgten der Spur eines Tieres und drangen dabei tief in eine hügelige Gegend an der Ilmenau vor. Und was sahen sie dort? Eine große Wildsau schlief in der Sonne, und ihre Borsten waren weiß. Das Tier wurde erlegt, die Männer untersuchten es und stellten fest, dass Salz an den Borsten klebte. Als sie nun die Spuren der Sau rückwärts verfolgten, stießen sie schließlich auf einen Tümpel, in dem sie sich gesuhlt hatte. Das Wasser dieses Tümpels schmeckte salzig. Die Saline war entdeckt.«
»Verehrt man nicht einen Schinkenknochen der Salzsau?«, fragte Margarete.
»Ja, er wird im Rathaus aufbewahrt. Immerhin verdanken wir der Sau unseren Reichtum. Der Sau und vor allem natürlich dem Salz.«
Vor einer der Siedehütten angekommen, wies Reyner Stolzfuß auf eine Figur auf dem Dach über dem Eingang. Es handelte sich um einen Fuß, und man konnte sagen, dass er sich tatsächlich stolz in die Höhe reckte. Damit war die Hütte als Pachtgut des Sülfmeisters bezeichnet. Das sülzbegüterte Michaeliskloster kassierte die Pacht, Stadt und Landesherr kassierten Steuern und Zölle, aber für einen Sülfmeister blieb genug übrig, so dass er hervorragend von der Saline zu leben vermochte. Und auch die Sodkumpane und Fahrtknechte, die Sieder und die Hilfsarbeiter hatten ihr Auskommen, wenn auch nur ein bescheidenes. Fast ganz Lüneburg, so schien es zumindest den Gästen, hing vom Salz ab.
Hatte die Sülte schon aus der Entfernung wie die Hölle ausgesehen, so waren alle überzeugt, dass in der Siedehütte tatsächlich eine Höllenhitze herrschte. Unter jeder der vier Siedepfannen aus Blei brannte ein starkes Feuer, das von einem kleinen Knaben beschickt wurde, während eine Frau sich anschickte, die Hütte zu verlassen. Auch sie trug einen Holzeimer auf dem Kopf, dieser jedoch enthielt heiße Asche. Der Sülzer war damit beschäftigt, Sole in eine der Pfannen zu füllen, während in einer zweiten Pfanne das Wasser bereits so weit verdampft war, dass man die Salzkristalle sehen konnte. Wegen der barbarischen Temperaturen hatte der Sieder seinen Kittel abgelegt und war nur mit einem Lendenschurz bekleidet. Schweiß glänzte auf seinem Rücken, Schweiß lief ihm über das Gesicht. Auch die Frau und der Knabe schwitzten.
Als der Sieder seinen hohen Besuch bemerkte, verbeugte er sich knapp, ließ sich aber in seiner Arbeit nicht stören. Er wusste, dass der Sülfmeister genau das von ihm erwartete. Auf der Saline war die Zeit kostbar. Die Arbeit lief immer, rund um die Uhr und, mit einer Ausnahmegenehmigung der Kirche, auch am Sonntag.
Gegenüber von den Siedepfannen befand sich ein hoher Berg aus Salz. Reyner Stolzfuß bat seine Freunde und Anverwandten, das weiße Gold zu probieren. Da man dazu näher an die Siedepfannen treten musste, wurde die Hitze noch unerträglicher. Niemand musste den Finger befeuchten, mit dem er das Salz berührte; die Hände waren feucht vom Schweiß, eine kleine Salzprobe blieb an ihnen ohne weiteres kleben.
»Ich verstehe nicht, wie Ihr behaupten könnt, dass Salz sei süß«, meinte Sebastian Vrocklage, nachdem er sich den Finger abgeleckt hatte. »Ich finde, es schmeckt, wie Salz schmecken muss.«
»Man braucht Erfahrung, um es richtig beurteilen zu können«, erklärte der Sülfmeister. »Es schmeckt natürlich salzig … Nicht das Salz, verehrter Freund, die Sole war süß. Im Übrigen, die Salprobe ist nur ein Ritual, das von den Bürgermeistern erwartet wird. Auch wenn wir alle Schnupfen haben, findet sie statt. Unser Geschmackssinn wird nicht unbedingt gebraucht, denn man kann mit einer Solewaage den Salzgehalt genau bestimmen. Schon bevor wir uns zur Probe begeben, teilt uns der Sodmeister die Ergebnisse mit.«
»Dann ist das ja ein kleiner Betrug«, sagte Sebastian.
»Ein Gaukelspiel, gewiss. Aber Ihr kennt das Publikum: Es liebt solche Aufführungen. Ziehen die Bürgermeister zur Salprobe, ist die halbe Stadt auf den Beinen. Warum nicht ein bisschen schummeln, wenn dabei alle auf ihre Kosten kommen. Oder auch nicht: Wenn die Sole schlecht ist …«
Es war voraussehbar, dass Heinrich von Ritzerow nach dem Verlassen der Sülte zu einem Umtrunk in den Gasthof lud. Durstig waren alle geworden, doch so recht mochte niemand auf die Offerte eingehen. Gegen einen Umtrunk war nichts zu sagen, gegen eine Zecherei, die einen leidvollen Morgen zur Folge hatte, sprach etliches.
Bruder Anselm verabschiedete sich als Erster. Als Mönch war ihm vergönnt, immer einen Vorwand zu haben, um unangenehmen Begegnungen aus dem Weg zu gehen, schließlich musste ein Klosterbruder tägliche Stundengebete verrichten. Nicht der Ritter war ihm unangenehm, sondern nur dessen Trinklust. Gerade waren die Kopfschmerzen gewichen, und Anselm wollte nicht riskieren, dass er sich neue zuzog.
Auch Reyner Stolzfuß hatte ein Geschäft. Der Gesandte eines Revaler Kaufmanns wünschte ihn zu sprechen und ihm im Auftrag seines Herrn ein Angebot zu unterbreiten, von dem ein Schreiben aus Reval sinngemäß behauptete, nur ein Narr könne es abschlagen. Guten Angeboten war Stolzfuß immer aufgeschlossen, und so hatte er die Einladung des Gesandten zum Essen angenommen. Der Mann, der Albrecht Gregorius hieß, logierte in der feinen Herberge Bei der Ratsmühle, er musste also wirklich Geld im Rücken haben.
Da Maria, Piet und Geseke Peters sich nicht mehr vor der Saline aufgehalten hatten, waren die Frauen in Sorge und wünschten, so schnell wie möglich nach Hause zurückzukehren. Tidemann Stolzfuß erbot sich, sie zu begleiten, schließlich schickte es sich für eine bürgerliche Frau nicht, unbegleitet durch die Stadt zu gehen, nur manchmal auf den Markt, aber da war dann immerhin eine Magd dabei. So blieben denn am Ende nur Martin Grüneberg und Sebastian Vrocklage als mögliche Zechkumpane des Ritters übrig. Da sie Heinrich so betrübt sahen, willigten sie aus Mitleid ein, ihm für ein paar Stunden Gesellschaft zu leisten; außerdem waren sie froh, dass ihnen das Trauerhaus noch einige Zeit erspart bleiben würde.
Wein nahm nur der Ritter, Martin und Sebastian hielten sich ans Dünnbier. Alle drei hingen Erinnerungen an Ereignisse nach, die sie vor zwei Jahren schon einmal zusammengeführt hatten: Balthazar Vrocklage, Sebastians Vater, war ermordet worden, der Ritter und der Weddeherr hatten einen großen Anteil an der Aufklärung des Verbrechens gehabt, wobei Grüneberg von seinem Verstand, der Ritzerow mehr von seiner Intuition geleitet worden war. Sie schien nicht einmal bei größter Trunkenheit zu versagen.
Für die Untersuchung eines Mordes innerhalb der Mauern der Stadt war der Lüneburger Rat zuständig und hier vor allem die Richteherren und der Gerichtsvogt. Jedermann durfte davon ausgehen, dass sie ihr Handwerk verstanden, und wenn sie einmal gar nicht vorankamen, konnten sie immer noch den Scharfrichter rufen. Um jemanden zu foltern, brauchte man allerdings nicht nur einen Verdächtigen, man musste seiner auch habhaft sein. Längst hatte Martin Grüneberg beschlossen, sich in die Untersuchung auf seine Weise einzumischen. Über Umwege war Lüdeke Peters immerhin seit Magaretes so blutig beendeter Hochzeit mit ihm verwandt.
Grüneberg zog den Ritter und Vrocklage ins Vertrauen. Er berichtete ihnen von der Entdeckung des Spittlers im Josephus Flavius, den Heinrich von Ritzerow zu seinem Erstaunen sogar kannte.
»Bücher über Kriege gehören zu den Leidenschaften aller Ritzerows«, meinte der Ritter und nahm einen tiefen Schluck aus seinem Becher. Dem Weddeherrn, der schon gegen das Dünnbier nicht ankam, drehte sich der Magen um. »Meinen Vorfahren ist es nie gelungen, an den Kreuzzügen teilzunehmen, denn sie sind spätestens in den französischen Schenken oder am Hals französischer Weiber versumpft. Das hatte natürlich auch eine positive Seite: Während andere Edelleute reihenweise verblutet sind, haben meine Vorfahren überlebt. Sie sind auf dem Gut der Ritzerows steinalt geworden und haben sich von den Verwaltern abends Kriegsbücher vorlesen lassen. Ich kann mich natürlich nur noch an meinen Großvater Heinrich den vierten und meinen Vater Heinrich den fünften Ritzerow erinnern. Den Judäischen Krieg haben sie gehasst. Es fehlte ihnen die Ritterlichkeit. Zu viel Verrat, zu viele andauernd wechselnde Bündnisse. Ein Ritter hat ein treuer Vasall zu sein, wie man an meinen Vorfahren sieht. Sie haben ihren Lehnsherren Treue geschworen, sind dann aber doch abgesprungen. Wären sie nicht feige gewesen, ich lebte vielleicht nicht.«
»Mir scheint der Einfall des Spittlers weit hergeholt«, unterbrach Sebastian die Familienbeichte des Ritters. »Die jungen Männer, die sich scheinbar um unseren … um Lüdeke gekümmert haben, trugen Kittel. Ich hielt sie für Bauern. Auch Bauern, die des Lesens kundig sind, interessieren sich nicht für alte Kriege. Im Gegensatz zu Rittern«, fügte er rasch hinzu.
»Es wird ein Auftraggeber hinter ihnen stecken«, mutmaßte Ritzerow.
»Das denke ich auch«, stimmte Grüneberg zu.
»Wir müssen also den Knaben suchen und diese beiden Männer«, sagte Heinrich.
»Das ist vermutlich einfacher gesagt als getan«, fürchtete Sebastian Vrocklage.
»Der Junge hatte Bierfässer geladen?« wollte der Ritter wissen.
»Ja.«
»Dann muss er sie einem Brauer gestohlen haben und das Gespann womöglich noch dazu.«
»Oder er ist Lehrbursche bei einem Brauer«, gab Grüneberg zu bedenken. »Der vielleicht seine Finger in der Verschwörung hat.«
»Warum sollte ein Brauer einen Salzherrn töten lassen?«, fragte Sebastian skeptisch.
»Das weiß ich nicht. Außerdem müssen wir mit dem Brauer noch nicht den Auftraggeber haben.«
»Ich finde sie!«, rief der Ritter und sprang plötzlich auf. Die zwei an einem Nebentisch sitzenden Männer, die dem Gespräch gelauscht hatten, wandten ihm nun ihre volle Aufmerksamkeit zu. Was Ritter, Weddeherr und Kaufmann nicht wussten: Sie gehörten zum Gefolge des Herrn von Baerck. Dieser hatte vom Herzog den Befehl erhalten, die Ermittlungen in der Stadt zu beobachten und sich unauffällig an ihnen zu beteiligen. Grund für das herzogliche Engagement war ein Schreiben aus Lübeck; der dortige Rat hatte angefragt, ob sich Lübecker Bürger in Lüneburg noch sicher fühlen könnten. Mit der Reichsstadt verdarb es sich nicht einmal ein Herzog gern, zumal ihm sein Nachbar, Erich V. von Sachsen-Lauenburg, vorführte, wie einträglich es war, mit Lübeck Geschäfte zu machen.
»Was habt Ihr vor?«, fragte Grüneberg, der Schlimmes ahnte.
»Ich werde allen Lüneburger Brauern auf den Zahn fühlen.«
»Dabei werden einigen sicher alle Zähne ausgehen«, meinte Martin.
»Wenn es notwendig ist.« Der Ritter ließ sich nicht mehr bremsen. Bevor Grüneberg und Vrocklage irgendetwas unternehmen konnten, hatte Heinrich den Gastraum verlassen und war aus der Herberge gestürmt. Zurück ließ er eine Zeche von drei Pfennigen, die Grüneberg entrichtete. Auch die Männer vom Nebentisch bezahlten.