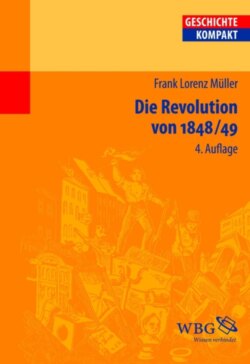Читать книгу Die Revolution von 1848/49 - Frank Lorenz Müller - Страница 10
b) Liberalismus und Radikalismus im deutschen Vormärz
ОглавлениеDie Gedankenwelt des Nationalismus war nicht das einzige intellektuelle Arsenal, das Kritikern der politischen Verhältnisse im Deutschen Bund zur Verfügung stand. Die obrigkeitsstaatlichen Realitäten, die in Deutschland nach 1815 und besonders nach 1819 geschaffen wurden, standen im Gegensatz zu einer „der stärksten gemeineuropäischen Bewegungsmächte“ (H.-U. Wehler), nämlich dem Liberalismus und umso mehr zu seinem linken Flügel, dem Radikalismus. Eine scharfe Trennung zwischen dem nationalen und liberalen Ideologem ist in diesem Zusammenhang einigermaßen künstlich. Im Deutschland des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts waren Liberalismus und Nationalismus vielfach miteinander verknüpft: von denselben Erfahrungen motiviert, mit gemeinsamen Gegnern und Trägergruppen. Zwar stellte sich bald heraus, dass ein gleichzeitiges Streben nach nationaler Einheit und politischer Freiheit keineswegs so unproblematisch war, wie es Hoffmann von Fallerslebens „Deutschlandlied“ (1841) suggerierte, aber es ist dennoch keine Verzerrung, von einer „liberal-nationalen“ Bewegung zu sprechen. Die gesonderte Behandlung der liberalen Dimension soll lediglich aufzeigen, auf wie vielen Ebenen sich im Vorfeld der Revolution von 1848 Opposition zum Status quo formierte.
Eine so vielschichtige und facettenreiche, von westeuropäischen wie deutschen Einflüssen geformte Bewegung wie der Liberalismus lässt sich schwerlich auf ein einziges Interessensfeld reduzieren. Aber obwohl sich Liberale auch zu Fragen des Handels, der Bildung und der Religion äußerten, erwies sich ein Thema bald als zentral: Der Liberalismus war vor allem eine politische Verfassungsbewegung. Als solche zielte er auf eine Umgestaltung des Staats in ein schriftlich fixiertes System von Rechtsnormen, das zwischen Monarchen und Volksvertretern zu vereinbaren war. Die Verfassung sollte Grundrechte garantieren – vor allem Meinungs- und Pressefreiheit, Vereinigungsfreiheit, das Recht auf privates Eigentum und Gleichheit vor dem Gesetz – und das Prinzip der Gewaltenteilung festschreiben. Als Anwalt der Nation und Hüter der Verfassung oblag dem Parlament die zentrale Aufgabe, die fürstliche Exekutive misstrauisch zu kontrollieren. Zudem eröffnete das Parlament dem Volk die Möglichkeit, durch gewählte Repräsentanten gesetzgebend am staatlichen Handeln teilzunehmen, wobei eine Einschränkung des Wahlrechts dafür sorgen sollte, dass nur befähigte Volksvertreter gewählt würden. Konstitutionelle Liberale waren keine Demokraten.
Die Wurzeln des deutschen Frühliberalismus liegen in der Aufklärung des späten 18. Jahrhunderts und in den intellektuellen wie politischen Erschütterungen, die von der Französischen Revolution ausgingen. Von der zentralen Forderung nach Gewährung von Freiheitsrechten für das Individuum ausgehend politisierte sich der Liberalismus in den 1790er-Jahren, indem er die staatliche Gewalt mit dem Recht des Einzelnen auf weitestgehende Selbstbestimmung konfrontierte. Der Historiker August Ludwig Schlözer (1735–1809) forderte rechtsstaatliche Prinzipien, um die „ursprünglichen Menschen- und Gemeinde-Rechte“ der Untertanen zu sichern. Wilhelm von Humboldts (1767–1835) „Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen “ (1793) entsprangen ebenfalls der liberalen Kernforderung nach einer Beschränkung der Staatsmacht. Dabei war das Verhältnis der frühen deutschen Liberalen zum Staat durchaus ambivalent. Der Liberalismus rekrutierte sich nämlich ganz überwiegend aus derselben bildungsbürgerlichen Gruppierung, die auch die frühe Nationalbewegung trug, und war als „Beamtenliberalismus“ ähnlich eng mit den Verwaltungs- und Bildungsapparaten der deutschen Staaten verwachsen. Zudem war der Staat selbst ein Instrument der Liberalisierung: der aufgeklärte Absolutismus zeigte Ansätze zur Reform des feudalen Systems und zur Etablierung von Rechtsstaatlichkeit. Die unter französischem Druck vorgenommenen preußischen und rheinbündischen Reformen führten diesen Prozess der Modernisierung fort. Von einer aufgeklärten Reformbürokratie getragen war der Staat des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts den Wünschen des liberalen Bürgertums entgegengekommen. Begünstigt durch das Fehlen eines revolutionären Umschwungs und die relative Schwäche der deutschen Bourgeoisie entwickelte sich so ein reformorientierter, staatsloyaler bürokratischer Liberalismus, dessen große Zeit zwischen 1800 und 1820 fiel. Weit davon entfernt, ein bloßes Übergangsphänomen zwischen aufgeklärtem Absolutismus und dem konstitutionellen Liberalismus des Vormärz zu sein, zielte er auf die „Herbeiführung einer modernen Staatsbürgergesellschaft … im weitläufigen Gehäuse eines sorgfältig ausgebauten Rechtsstaats“, der „Sicherheit, Vorausberechenbarkeit, Freiheit von persönlicher Willkür und Schutz durch allgemeine Gesetznormen“ garantieren sollte (H.-U. Wehler). Seine Führungsrolle im breiten Spektrum des bürgerlichen Liberalismus verlor der bürokratische Liberalismus erst, als die deutschen Regierungen, durch den Radikalismus aufgeschreckt, nach 1819 auf einen autoritär-obrigkeitsstaatlichen Kurs einschwenkten und damit den Liberalismus auf die Oppositionsbänke verbannten.
Der Sieg über Napoleon hatte kein abruptes Ende für die Reformära bedeutet, die seit 1806 in Preußen und im Rheinbund so wichtige liberale Neuerungen wie die Bauernbefreiung, städtische Selbstverwaltung, Bildungsreform, Gewerbefreiheit, Judenemanzipation und die Abschaffung ständischer Privilegien gebracht hatte. Der Geist der Reformzeit wirkte auch nach dem Wiener Kongress 1814/15 noch weiter. Sein berühmtestes Echo fand er in Artikel 13 der Bundesakte (1815), der lakonisch festlegte: „In allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung stattfinden.“ Innerhalb eines Jahrzehnts hatten 29 deutsche Staaten dieser Auflage entsprochen. Allerdings verwiesen Preußens und Österreichs Verweigerung der Verfassungsgebung sowie die Bandbreite der verabschiedeten Staatsgrundgesetze – sie reichten von Badens konstitutioneller Monarchie bis zum ständischen „Landesgrundsätzlichen Erbvergleich“ in Mecklenburg – auf die Grenzen des Konstitutionalisierungsprozesses. So wurden die süddeutschen Verfassungsstaaten Bayern (1818), Baden (1818), Württemberg (1819) und Hessen-Darmstadt (1820) zum Kerngebiet des deutschen Liberalismus. Bereits vor der politischen Wende von 1819/20 kam es hier über Fragen wie Schwurgerichtsbarkeit, Pressefreiheit, Militärverfassung und Vorrechte der adligen Standesherren zu Konflikten zwischen Regierungen und liberalen Kammerabgeordneten.
Zur gleichen Zeit formierte sich außerhalb des süddeutschen „Kammerliberalismus“ eine radikale Oppositionsbewegung. Unter der Führung national gesinnter Professoren wie Heinrich Luden und Lorenz Oken (1779–1851) in Jena, Karl Theodor Welcker (1790–1869) in Gießen und Friedrich Schleiermacher in Berlin hatte sich die deutsche Burschenschaft seit ihrer Planung durch Friedrich Ludwig Jahn (1811) zu einer Organisation von landesweit 1000–2000 Studenten entwickelt. Mit dem von 500 Teilnehmern besuchten Wartburgfest (18. 10. 1817) trat die Burschenschaft zum ersten Mal an die politische Öffentlichkeit. Festredner attackierten die Fürsten wegen der verschleppten Verfassungsgebung: „undeutsche“ Schriften konservativer Autoren und Symbole der partikularstaatlichen Obrigkeit (Korporalstock, Zopf) wurden öffentlich verbrannt. Unter dem unmittelbar darauf einsetzenden Druck regierungsamtlicher Sanktionen radikalisierte sich die Burschenschaft weiter. Studentische Geheimbünde wie die Jenaer „Altdeutschen“ oder die Gießener „Unbedingten“ entstanden, die einem unitarisch-demokratischen Nationalismus verpflichtet waren. Am 23. 3. 1819 ermordete der in der deutschtümelnd-quasireligiösen Ideenwelt dieser Kreise dunkel vor sich hingrübelnde Student Karl Sand (1795–1819) den als reaktionär geltenden Schriftsteller August von Kotzebue. Der österreichische Staatskanzler Metternich reagierte blitzschnell, und schon am 20. 9. 1819 traten die auf einer Konferenz in Karlsbad vereinbarten Beschlüsse in Kraft. Die damit eingeleitete „Demagogenverfolgung“ wurde in den einzelnen Staaten unterschiedlich scharf durchgeführt. Preußen, Österreich, Baden und Nassau zensierten, entließen, inhaftierten und gesinnungsschnüffelten mit besonderem Eifer. Zwar gelang es den Regierungen nicht, alle radikalen Regungen und „subversiven“ Publikationen zu unterdrücken, aber die Opposition wurde aus der legalen Öffentlichkeit verdrängt. Das politische System der so genannten Restauration wurde zu einem intoleranten, bevormundenden Überwachungsregime.
Klemens Fürst von Metternich-Winneburg (1773–1859), aus einem reichsunmittelbaren rheinischen Adelsgeschlecht, folgte seinem Vater in österreichische Dienste. Nach einer Erfolg versprechenden Einheirat in die mächtige Kaunitz-Familie begann er 1801 seine diplomatische Karriere als Gesandter in Dresden (1803: Berlin; 1806: Paris). Als Außenminister (seit 1809) dominierte der geschmeidige und taktisch hoch begabte Metternich den Wiener Kongress und wurde danach zur Zentralfigur der österreichischen Politik (seit 1821 als Staatskanzler) und im Deutschen Bund. Metternichs im aufgeklärten Absolutismus verwurzelte Prinzipienpolitik zielte auf die kompromisslose Verteidigung des außen- und innenpolitischen Status quo. In Bewegungskräften konnte er ausschließlich eine Bedrohung aller Ordnung sehen. Nach 23 Kriegsjahren hatte dieser Konservatismus durchaus einem allgemeinen Bedürfnis nach Ruhe und Stabilität entsprochen, aber im Laufe des Vormärz erwies sich Metternichs doktrinäre Beharrungspolitik als zunehmend kontraproduktiv. Als Hassfigur der liberalen Opposition floh er während der Märzrevolution ins englische Exil und spielte danach keine offizielle Rolle mehr.
Neben dem Kampf gegen den burschenschaftlichen Radikalismus bemühten sich Metternich und sein Berater Friedrich von Gentz (1764–1832), der liberalen Überzeugung entgegenzuarbeiten, dass unter den in Art. 13 der Bundesakte erwähnten „Landständen“ moderne Volksvertretungen zu verstehen waren. In dieser Frage wurde auf den Wiener Konferenzen (November 1819–Mai 1820) eine Kompromissformel gefunden, die zwischen der verfassungstreuen Position Bayerns und Württembergs und den anti-konstitutionellen Staatsstreichplänen einiger nassauischer und badischer Minister vermittelte. Art. 57 der Wiener Schlussakte (15. 5. 1820), des zweiten Bundesgrundgesetzes, schrieb das „monarchische Prinzip“ fest, das eine weite Auslegung der einzelstaatlichen Verfassungen verhinderte. Preußen und Österreich entschlossen sich, das Verfassungsgebot auch weiterhin schlichtweg zu ignorieren. Liberale Hoffnungen auf eine Fortentwicklung der Bundesverfassung zerschlugen sich. So blieben als einzige Plattform für liberale Politik die süddeutschen Kammern. In Baden traten der Staatsrechtler Karl Rotteck (1775–1840) und der Jurist Johann Adam von Itzstein (1775–1855) couragiert für radikal-liberale Positionen ein; in Heinrich von Gagern, Ludwig Uhland (1787–1862) und Ignaz Rudhart (1790–1838) hatten auch Hessen-Darmstadt, Württemberg und Bayern eindrucksvolle liberale Parlamentarier, aber im Ganzen waren die 1820er-Jahre eine Periode einer Stagnation liberaler Politik. Auf dem deutschen Verfassungsleben lag der Mehltau der Perspektivlosigkeit.
Heinrich von Gagern (1799–1880) war unter den Liberalen, die 1848/9 für ein parlamentarisch-konstitutionelles Deutschland kämpften, die herausragende Persönlichkeit. Nachdem er in Waterloo gekämpft und als Burschenschafter in Heidelberg und Göttingen studiert hatte, trat Gagern in den darmstädtischen Staatsdienst ein. 1832 wurde der liberale junge Regierungsrat Mitglied der 2. Kammer und avancierte zum Wortführer der Opposition. Obwohl er sich nach 1836 aus Protest ins Privatleben zurückgezogen hatte, blieb er politisch aktiv. 1847 kehrte er in die Kammer zurück, war an der Gründung der liberalen „Deutschen Zeitung“ beteiligt und nahm am Heppenheimer Treffen teil. Im Frühjahr 1848 war er Mitglied der Heidelberger Versammlung und des Vorparlaments und wurde darmstädtischer Ministerpräsident. Am 19. 5. 1848 wählte die deutsche Nationalversammlung Gagern zu ihrem Präsidenten. In diesem Amt erreichte er den Höhepunkt seines Einflusses. Im Juni begründete die Versammlung auf seinen Antrag eine Exekutive, an deren Spitze der österreichische Erzherzog Johann gewählt wurde. Im Dezember übernahm Gagern die Leitung des Reichsministeriums. Nach langen, fruchtlosen Streitereien um die deutsche Verfassung und die Frage des Verhältnisses zu Österreich wurde das Ministerium Gagern am 10. 5. 1849 entlassen (s. Kap. IV, 2, b u. 3, a). Am 20. 5. 1849 verließ er die Paulskirche. Nachdem er in Gotha und im Erfurter Unionsparlament Preußen unterstützt hatte, zog sich Gagern schließlich ins Privatleben zurück.
In die angestrengte Stille der Restaurationsära platzte im Sommer 1830 die französische Julirevolution. Im Deutschen Bund traten die Nachrichten zuerst aus Paris, später aus Brüssel und Warschau, eine Lawine politischer Konflikte los. Moderate und radikale Oppositionskräfte erneuerten ihre Attacken gegen das Restaurationsregime. Die vorkonstitutionellen Staaten Norddeutschlands erlebten gewaltsame Ausbrüche: In Braunschweig, Hannover, Hessen-Kassel und Sachsen sahen sich die Monarchen durch offene Rebellion gezwungen, schleunigst Verfassungen zu gewähren. In den süddeutschen Verfassungsstaaten fand die Auseinandersetzung mit der fürstlichen Autorität nicht auf den Straßen, sondern in den Parlamenten statt. Im Rahmen der so genannten Kammerkämpfe nutzten liberale Oppositionsgruppen in Bayern, Württemberg und Baden das parlamentarische Budgetrecht geschickt aus, um ihre Position gegenüber den Regierungen zu verbessern und für eine Stärkung der Bürgerrechte einzutreten. Durch Wahlsiege beflügelt gelang es den Liberalen, einige ihrer politischen Ziele zu verwirklichen. Gleichzeitig kam es vor allem in der bayerischen Pfalz – aber auch in Teilen Badens und Hessens – zu einer Wiederbelebung des Radikalismus, der nunmehr neben dem studentischen Milieu auch kleinbürgerliche und bäuerliche Kreise erfasste. Seine Anhänger konnten auf eine weitgefächerte Publizistik zurückgreifen, um ihr zunehmend demokratisches, die Volkssouveränität betonendes Programm zu verbreiten. In der Pfalz formierte sich am 29. 1. 1832 der radikale „Preß- und Vaterlandsverein“, der bald über mehr als 5000 Mitglieder in mehreren Staaten verfügte. Höhepunkt der Tätigkeit des Vereins war das Hambacher Fest (27. 5. 1832), auf dem vor mehr als 20 000 Teilnehmern offen für Volkssouveränität und Demokratie agitiert wurde. Ähnliche Veranstaltungen im kleineren Maßstab wurden in Baden, Hessen und Franken abgehalten. Im April 1833 versuchten einige radikale Desperados sich im „Frankfurter Wachensturm“ per Handstreich der Stadt und des Bundestages zu bemächtigen, um dadurch ein Signal zur allgemeinen Volkserhebung zu geben. Früh verraten, stümperhaft vorbereitet und vom Volk ignoriert scheiterte das Vorhaben.
Wie schon 1819/20 ließ auch diesmal die Reaktion des Obrigkeitsstaates nicht lange auf sich warten. Zwischen Juni 1832 und Juni 1833 verabschiedete der Bundestag unter der Führung Metternichs eine Reihe von „Maßregeln zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen Ruhe und Ordnung“: das Petitions- und Budgetrecht der süddeutschen Parlamente sowie ihre Rede- und Berichtsfreiheit wurden beschränkt, Zensur, Versammlungs- und Vereinsverbot wurden verschärft und eine Zentralbehörde für politische Untersuchungen eingerichtet. Die Köpfe des pfälzischen Radikalismus sahen sich einer Verfolgungswelle ausgesetzt: Der Journalist Philipp Siebenpfeiffer (1798–1845) entkam in die Schweiz; sein Kollege Johann Georg Wirth saß zwei Jahre in Haft und floh später nach Frankreich. Bundesweit begann eine erneute Periode scharfer Repressionspolitik. Im August 1836 ergingen in Preußen gegen 204 Burschenschafter wegen Hochverrats 39 Todesurteile (die vom König in Festungshaft umgewandelt wurden) und 165 langjährige Freiheitsstrafen. Unter den Eingekerkerten befand sich auch der mecklenburgische Dichter Fritz Reuter (1810–74), dessen Werk „Ut mine Festungstid“ eindringlich über diese Erfahrung berichtet. In Bayern saß der liberale Würzburger Staatsrechtler Wilhelm Behr (1775–1851) mehrere Jahre in Festungshaft und wurde bis 1848 in seiner Freizügigkeit behindert. Sylvester Jordan (1792–1861), einem führenden Liberalen, der sich gegen den reaktionären Kurs in Hessen-Kassel eingesetzt hatte, widerfuhr ein ähnliches Schicksal. In Württemberg verhärteten sich die Fronten zwischen Regierung und liberaler Kammermehrheit, ohne dass Letztere nennenswerte Erfolge verbuchen konnte. Vom reaktionären Kurs des Ministers Karl du Thil (1777–1859) frustriert schied Heinrich von Gagern 1836 aus dem darmstädtischen Landtag aus und zog sich auf sein Familiengut zurück. Im Jahr darauf wurden sieben liberale Göttinger Professoren ihres Amts enthoben, weil sie gegen den Verfassungsbruch des neuen hannoverschen Königs protestiert hatten. Jacob Grimm, Friedrich Christoph Dahlmann (1785–1860) und Georg Gottfried Gervinus (1805–71) wurden sogar des Landes verwiesen. Von einigen hannoverschen Städten angerufen prüfte der Bundestag die Aufhebung der Verfassung von 1833 und stimmte 1839 gegen eine Bundesintervention, womit der königliche Willkürakt indirekt bestätigt wurde.
Trotz all dieser reaktionären Bemühungen gelang es dem obrigkeitsstaatlichen System nach 1833 nicht mehr, den liberal-radikalen Diskurs zu unterdrücken. So konnte die (in den verschiedenen Staaten unterschiedlich scharf gehandhabte) Zensur die Entstehung einer politischen Publizistik nicht verhindern. Als zentrale Publikation des vormärzlichen Liberalismus kann das seit 1834 erscheinende Rotteck-Welckersche Staatslexikon gelten, dessen Artikel die damalige liberale Ideenwelt definierten. Seine Autorenliste versammelte die herausragenden Vertreter des südwestdeutschen Liberalismus: Sylvester Jordan, Friedrich List (1789–1846), Karl Mathy (1806–68), Karl Rotteck, Robert Mohl (1799–1875), Karl Welcker. Auch die schöngeistige Literatur politisierte sich. Den Schriftstellern Heinrich Heine (1797–1856), Ludwig Börne (1786–1837) und Karl Gutzkow (1811–78), die als „Junges Deutschland“ die Verhältnisse im Deutschen Bund kritisierten, wurde 1835 die Ehre eines Bundesverbots zuteil. In ihrer klaren Hinwendung zur nationalen Demokratie war die politische Lyrik der 1840er-Jahre deutlich radikaler als das „Junge Deutschland“. Die „Tendenzpoeten“ Georg Herwegh (1817–75), Ferdinand Freiligrath (1810–76) und August Hoffmann von Fallersleben erzielten zudem eine weit größere Breitenwirkung. Wie erfolgreich diese öffentliche Vernetzung der liberalen Gruppierungen war, illustrierte nichts deutlicher als die empörte Reaktion auf die Entlassung der „Göttinger Sieben“. Loyalitätsbekundungen, solidarische Sammlungen, Vereinsgründungen, Schiffstaufen auf den Namen „Dahlmann“ und die Herstellung von „Göttinger-Sieben“-Bleifiguren: all das zeugte von der Geschlossenheit und vom Einfallsreichtum der liberal gesinnten Öffentlichkeit.
Die Auseinandersetzung zwischen staatlicher Obrigkeit und der anwachsenden bürgerlich-liberalen Verfassungsbewegung wurde so zum dominanten Thema der deutschen Politik im Vormärz. Die Streitschriften „Vier Fragen, beantwortet von einem Ostpreußen“ (1841) des radikalen Königsberger Arztes Johann Jacoby (1805–77) und „Woher und Wohin“ (1842) des liberalen Oberpräsidenten Theodor von Schön (1773–1856) zeigten, dass auch Preußen die Verfassungsfrage nicht länger ignorieren konnte. Ähnlich kritische Töne schlugen in diesen Jahren auch die Königsberger „Hartungsche Zeitung“ sowie die von Karl Marx herausgegebene „Rheinische Zeitung“ in Köln an. Letztere wurde nach nur einem Jahr wegen der „Böswilligkeit der Tendenz“ verboten.
Karl Marx (1818–83), der einer konvertierten jüdischen Familie aus Trier entstammte, begann nach Beendigung seines Philosophiestudiums seine politische Karriere 1842 als radikaler Chefredakteur der oppositionellen „Rheinischen Zeitung“ in Köln. Nach deren Verbot im darauf folgenden Jahr ging Marx nach Frankreich, wo er eine prominente Rolle in den frühsozialistischen Exilantenkreisen spielte. Nach der Veröffentlichung des „Kommunistischen Manifests“ (1848) begab er sich von Brüssel über Paris nach Köln, wo die „Neue Rheinische Zeitung“ unter seiner Leitung zu einer Plattform für sozialistisches Gedankengut wurde. Gleichzeitig bemühte er sich um die politische Mobilisierung der Arbeiterbewegung, fand jedoch nur wenig Widerhall. 1849 musste Marx über Frankreich ins englische Exil fliehen, wo er sich noch jahrzehntelang in tiefem Elend und unversöhnlicher Opposition rastlos schreibend der Begründung des modernen Kommunismus widmen sollte.
In Bayern steuerte die Regierung unter Karl von Abel (1788–1859) mit Rückendeckung des Königs einen konsequent katholisch-antiliberalen Kurs gegen den Landtag und liberale Kreise in der Bürokratie. Zwischen 1835 und 1843 lieferte sich der badische Minister Friedrich von Blittersdorf (1792–1861) ein Duell mit der Zweiten Kammer über Fragen der Wahlbeeinflussung und Urlaubsverweigerung für beamtete Abgeordnete. Der langwierige Konflikt konnte erst nach Blittersdorfs Ablösung im November 1843 beendet werden. Ähnliche Spannungen gab es ab 1844 in Württemberg, wo der Landtag nach einer Schwächeperiode wieder selbstbewusster agierte. In Hessen-Darmstadt läutete Heinrich von Gagerns Rückkehr ins Parlament (1847) eine Politik der Konfrontation mit dem „System“ des Ministers du Thil ein. Selbst im absolutistischen Habsburgerreich gärte es. In Ungarn hatte es schon seit den 1830er-Jahren eine liberale Opposition gegeben. In den 1840ern verstärkte sie sich und fand Widerhall in Niederösterreich und Böhmen. In seiner Schrift „Österreich und dessen Zukunft“ (1841) forderte Viktor von Andrian-Werburg (1813–58) eine Reform der politischen Verhältnisse. Seine Argumente und die anderer Publizisten (Graf Auersperg, Franz Schuselka) wurden von den Ständeversammlungen der österreichischen Erblande aufgegriffen, die Forderungen des Verfassungsliberalismus mit dem Pochen auf alte ständische Rechte verknüpften. Auch das liberale Wiener Bürgertum – seit 1842 im „Juridisch-Politischen Leseverein“ organisiert – mahnte Reformen des Bildungswesens und der Zensur sowie die Öffentlichkeit der Ständeversammlungen an. Unter Wiens Studenten und Handwerkern gewann radikales Gedankengut zunehmend Anhänger.
Das Spannungsfeld zwischen liberalen Forderungen und konservativer Beharrung, das sich im Deutschen Bund zwischen 1815 und 1848 entwickelt hatte, führte zu einer „Polarisierung von monarchischem Staat und bürgerlicher Gesellschaft“ (W. Hardtwig). Damit ist nicht gesagt, dass der Ausbruch der Revolution und ihre Anfangserfolge vorprogrammiert waren. Die Tiefe der Kluft, die Staat und Gesellschaft trennte, sollte nicht überschätzt werden, und die schwächende Spaltung der „liberal-nationalen“ Bewegung in einen konstitutionell-liberalen und einen demokratisch-radikalen Flügel war bereits angelegt. Nichtsdestoweniger sahen sich die deutschen Regierungen gegen Ende des Vormärz von einer liberalen Oppositionsbewegung, die politisch erfahren, eloquent, zehntausendfach in Vereinen organisiert und in einem selbstbewussten Bürgertum verwurzelt war, in eine zunehmend prekäre Defensive gedrängt.