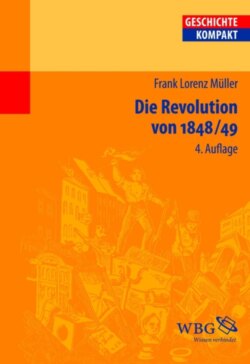Читать книгу Die Revolution von 1848/49 - Frank Lorenz Müller - Страница 11
c) Der monarchische Staat
ОглавлениеIn den Jahren von 1815 bis 1848 hatten die deutschen Regierungen und ihr Bund keine gute Presse. Als rachsüchtiger Gegner der „Bewegungspartei“ schien der monarchische Staat lediglich negative „Beharrung“ anbieten zu können. Von einer wortgewandten Opposition ätzend kritisiert, immer wieder auf eine kleingeistig-grobe Repressionspolitik zurückgreifend und unwillig, angemessen auf neue Realitäten zu reagieren, bot die vormärzliche Regierungspartei Zeitgenossen wie Nachgeborenen ein wenig attraktives Bild. Metternichs zynische Reaktion auf die politisch nützliche Mordtat des „vortrefflichen Sand“; die Arroganz des preußischen Innenministers Gustav von Rochow (1792–1847), der sich das Urteil des „beschränkten Untertanenverstands“ verbat; die Justizschikane, die den radikalen Pfarrer Ludwig Weidig (1791–1837) in den Suizid trieb; die Realitätsverweigerung, mit der Friedrich Wilhelm IV. von Preußen (1840–61, geb. 1795) eine Verfassung noch im April 1847 als „beschriebenes Blatt“ abtat: all das steht emblematisch für die Mängel eines Herrschaftssystems, das scheinbar nur eine rükkwärts gewandte Restaurationsära und einen den Zusammenbruch vorausahnenden Vormärz kannte. Eine so schwarze Sicht des monarchischen Staates vor 1848 ist nicht unzutreffend, aber doch unvollständig und in ihrer Einseitigkeit irreführend. Um ein besseres Verständnis der politischen Spannungen im vorrevolutionären Deutschland zu gewinnen, müssen auch die Antriebskräfte und Stärken der obrigkeitsstaatlichen Partei berücksichtigt werden. 1848/9 sollten sich die Staaten und ihre konservativen militärisch-bürokratische Führungsgruppen als formidable Gegner der Revolution erweisen. Davon ist weniger überrascht, wer das politische System im Vormärz nicht auf Kleinstaaterei, geistlose Beharrung und die „Dummköpfe“ unter den deutschen „Censoren“ reduziert. Im Folgenden soll die Regierungsperspektive für zwei wichtige Politikfelder skizziert werden: die einzelstaatliche Verfassungsentwicklung und die Politik im gesamtdeutschen Rahmen.
Wie für den deutschen Nationalismus und Liberalismus war der Einfluss des revolutionären Frankreichs auch für die bürokratisch-konstitutionellen Reformen in den deutschen Staaten von entscheidender Bedeutung. Unter französischem Druck fand zwischen dem Kongress von Rastatt (1797–9) und dem Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation (1806) die im Reichsdeputationshauptschluss festgelegte komplette Flurbereinigung der deutschen Staatenwelt statt. Überall waren die auf Kosten der aufgelösten kleinen deutschen Reichsstände mächtig gewachsenen Mittelstaaten mit der Aufgabe konfrontiert, neue Untertanen zu regieren. Auf dem Wiener Kongress wurde diese von Napoleon erzwungene Situation mutatis mutandis beibehalten. Die Verlierer des Reichsdeputationshauptschlusses, die auf eine wirkliche Restauration gehofft hatten, wurden enttäuscht. Diese Veränderungen katapultierten die betroffenen Staaten in einen beschleunigten Modernisierungsprozess. Napoleons deutsche Satelliten im Rheinbund sahen sich vor gewaltigen Herausforderungen: Neue, oft widerstrebende Bevölkerungsgruppen mussten integriert, staatliche Machtansprüche gegen alte Privilegien durchgesetzt werden. Hierfür, für die Bedienung der gewaltigen Staatsschulden und für die von Napoleon eingeforderten Leistungen waren Finanzmittel notwendig, die nur eine effiziente Bürokratie eintreiben konnte. Im Zuge dieser „administrativen Integration“ (E. R. Huber) entstanden bis 1820 moderne, rational verwaltete Staaten. Auch die in Süddeutschland schrittweise (1818–20) durchgesetzte Konstitutionalisierung ist vor dem Hintergrund der Integrationsaufgabe zu begreifen. „Erst mit dieser Verfassung“, schrieb 1818 der bayerische Jurist Anselm von Feuerbach (1775–1833), „hat sich unser König Ansbach, Bayreuth, Würzburg, Bamberg usw. erobert.“ So erklärt sich auch der bayerische und württembergische Widerstand gegen die Versuche Metternichs, sich 1819/20 durch eine reaktionäre Auslegung des Art. 13 der Bundesakte ein Mittel zur Widerrufung der süddeutschen Verfassungen zu schaffen. Indem sie ihre Verfassungen schützten, verteidigten Württemberg und Bayern zugleich den inneren Zusammenhalt ihrer noch integrationsbedürftigen Staatsgebiete.
Die weiterreichenden liberalen Forderungen, die sich aus dieser „parlamentarischrepräsentativen Integration“ (E. R. Huber) ergaben, waren aus Regierungssicht bedauerliche Nebenwirkungen eines Projekts, das primär der Herrschaftskonsolidierung diente. Die Obrigkeiten reagierten daher scharf auf die Konflikte, die sogleich von den liberalen Abgeordneten provoziert wurden. In Baden und Bayern wurde 1819/20 sogar erwogen, dem Kammerliberalismus durch staatsstreichartige Verfassungsrevisionen die Flügel zu stutzen. In Baden gelang 1825 eine legale Verfassungsänderung, die die Regierung gegenüber der Kammer stärkte. Diese Spannungen verweisen auf den Kompromisscharakter der süddeutschen Verfassungen, in denen die Gewichte zwischen Monarch, Exekutive, Kammer, altständischen Privilegien und bürgerlichen Ansprüchen sorgfältig austariert waren. Der deutsche Frühkonstitutionalismus konnte nur funktionieren, solange die Akteure bereit waren, sich an diesen Kompromiss zu halten, und solange eine relative politische und gesellschaftliche Stabilität herrschte. „Je mehr beides im Vormärz in Frage gestellt wurde, um so weniger konnte er die ihm zugedachte Aufgabe der politischen Stabilisierung erfüllen“ (K.-G. Faber). Die Konfrontationen, die sich in den süddeutschen Verfassungsstaaten zwischen Regierungen und liberalen Kammermehrheiten im Laufe der 1840er-Jahre entwickelten, sind in diesem Zusammenhang zu sehen. Dass es nichtsdestoweniger der monarchische Staat war, der durch das Instrument einer liberalisierenden Bürokratie erfolgreich einen Prozess administrativer und konstitutioneller Modernisierung durchgesetzt hatte, konsolidierte die Monarchie. Über die Zäsur von 1819/20 hinweg bis in die Revolution von 1848 hinein galt daher die staatliche Obrigkeit dem liberalen Bürgertum als potentieller Partner bei der Fortführung des Reformprogramms.
Den süddeutschen Verfassungsstaaten entgegengesetzt war die Entwicklung in Österreich. Das Reformprogramm Kaiser Josephs II. (1780–90, geb. 1741) war das ehrgeizigste des aufgeklärten Absolutismus gewesen, aber seine Bemühungen blieben vielfach in Ansätzen stecken. Auch während der Zeit der napoleonischen Vorherrschaft kam es im Habsburgerreich zu keiner durchgreifenden Modernisierung. Zum einen fehlte der zwingende Antrieb, den im süddeutschen Fall die Integrationsaufgabe, in Preußen die vernichtende Niederlage geboten hatte. Andererseits mangelte es an einer Reformbürokratie, die ein solches Projekt gegen die Opposition der Stände hätte durchsetzen können. Bis auf einige Neuerungen auf den Gebieten des Rechts, der städtischen Verwaltung und der Militärorganisation ging der österreichische Kaiserstaat strukturell unverändert aus den napoleonischen Kriegen hervor. Das Finanzproblem des chronisch verschuldeten Staatswesens blieb ungelöst; eine Verfassung wurde nicht gewährt. Die Konstitutionalisierung wurde entscheidend durch das Gegeneinander von Gesamtstaat und Nationalitäten behindert. Da der Josephinische Zentralismus gescheitert war, drohte ein parlamentarisch-konstitutionelles System im Vielvölkerreich der Donaumonarchie desintegrierend zu wirken. Für den zutiefst konservativen Metternich war der Kampf gegen Nationalismus und Liberalismus daher nicht nur eine Prinzipien-, sondern auch eine Existenzfrage. Es galt, politische Bewegungen jedweder Art zu verhindern. Dafür wurde auf höchstem Niveau zensiert, bespitzelt und denunziert. Wenn so auch nicht alle Kritik erstickt werden konnte, gelang es doch weitgehend, politische Themen aus dem öffentlichen Leben zu entfernen. Was öffentlich war, war biedermeierlich-gemütlich. Um das Dogma der Legitimität nicht anzutasten, ließ man sogar zu, dass an der Spitze der absoluten Monarchie mit Ferdinand I. (1793–1875) seit 1835 ein geistesschwacher Monarch stand, dessen gnädigen Ehrentitel „Ferdinand der Gütige“ ein bissiger Volksmund bald in „Gütinand der Fertige“ umwandelte. Unter dem fahlen Leitstern der unbedingten Bewahrung des Bestehenden wurde Österreich weniger regiert als verwaltet – emsig, aber ineffektiv. Allmählich jedoch wuchs im Bürgertum und in Teilen des Adels die Unzufriedenheit gegenüber dieser Politik wehrhafter Fossilisierung. Seit Beginn der 1840er-Jahre begannen sich deutliche Risse in Metternichs Damm gegen oppositionelles Gedankengut zu zeigen.
Verfassungsrechtlich nahm Preußen eine Mittelposition zwischen dem Habsburgerreich und den süddeutschen Staaten ein. Das amputierte und finanziell ausgeblutete Land befand sich nach 1806 unter besonderem Druck, Staat und Gesellschaft zu modernisieren. Auf einer spätabsolutistischen Reformtradition aufbauend, aber vor allem als Reaktion auf den militärischen Zusammenbruch unterzog eine bürokratisch-militärische Elite unter der politischen Führung des Freiherrn Karl vom und zum Stein (1757–1831) und Karl von Hardenbergs (1750–1822) den preußischen Staat einer tief greifenden Reform. Bauernbefreiung (1807), städtische Selbstverwaltung (1808), Gründung der („Humboldt’schen“) Berliner Universität (1810), Gewerbefreiheit (1810), allgemeine Wehrpflicht (1814) und Einrichtung des Staatsrats (1817) markierten die Etappen einer Entwicklung, die aus Preußen einen modernen Verwaltungsstaat machte. Als krönenden Abschluss ihrer Bemühungen zielten die Reformer auf eine „zweckmäßig eingerichtete Repräsentation sowohl in den Provinzen als für das Ganze“, wie sie der König 1810 versprach. Obwohl Friedrich Wilhelm III. (1797–1840, geb. 1770) seine Zusage 1815 und 1820 wiederholte und Preußen vor der Aufgabe stand, die Rheinprovinz und Westfalen zu integrieren, wurde keine Konstitution gewährt. Das Scheitern der Hardenberg’schen Verfassungspläne erklärt sich vor allem aus dem Wiedererstarken des preußischen Adels, der auf seine altständischen Privilegien pochte, und aus dem Einfluss konservativer Berater auf den König, dessen Unterstützung für das Verfassungsprojekt ohnehin nur lau war. Außerdem waren die Reformer Opfer ihres eigenen Erfolgs: Der modernisierte Staat erwies sich als so effizient, dass sich der Druck der bürgerlichen Reformforderungen merklich abschwächte. Folglich erhielt Preußen 1823 keine Gesamtverfassung, sondern acht getrennte Provinziallandtage, in denen Adel, Stadtbürger und bäuerliche Grundbesitzer vertreten waren. Obwohl diese Landtage einige moderne Züge aufwiesen (Debatte im Plenum, freies Votum), hatten sie nur eine beratende Funktion. „Damit war die Verfassungsfrage auf lange Zeit abgetan; die altständisch-feudale Reaktion hatte die Oberhand behalten“ (O. Hintze). Das blieb auch in den verbleibenden 17 Jahren der langen Herrschaft Friedrich Wilhelms III. so. Während der so genannten Demagogenverfolgungen der 1820er-Jahre und im Laufe der erneuten Repression nach 1832 tat sich Preußen als treuer Erfüllungsgehilfe Metternichs hervor.
Das Jahr 1840 jedoch brachte die Rheinkrise und einen neuen König und dadurch Bewegung in die innerpreußische Politik. Indem er seine Herrschaft mit einigen versöhnlichen Gesten begann, verstärkte Friedrich Wilhelm IV. diese Tendenz noch. Sogleich wurde die Frage einer gesamtpreußischen Verfassung aufgeworfen. Der ostpreußische Huldigungslandtag erinnerte den König im September 1840 an das Verfassungsversprechen seines Vaters, und die Streitschriften Theodor von Schöns und Johann Jacobys schlugen in dieselbe Kerbe. Jacoby wurde daraufhin von der preußischen Regierung wegen Hochverrats verklagt, aber von einer unabhängigen Justiz in zweiter Instanz freigesprochen.
Friedrich Wilhelm IV. (1840–1861, geb. 1795), der religiöse, eloquente und künstlerisch begabte Hohenzoller, dessen romantische Neigungen und deutscher Nationalstolz weithin bekannt waren, war als Kronprinz der Hoffnungsträger der liberalen Öffentlichkeit gewesen. Seine Thronbesteigung versprach einen politischen Aufbruch in Preußen. Irrtümlicherweise wurden seine liberalen (Lockerung der Zensur) und nationalen (Kölner Dombaufest, 1842) Gesten sowie seine Reformvorhaben (Vereinigter Landtag) als Ausdruck konstitutioneller Grundüberzeugungen gewertet. Die Politik des Königs gründete sich vielmehr auf ein mittelalterlich-romantisches Gedankengebäude, dessen Kern der Glaube an ein königliches Gottesgnadentum war. Seine Vision von einem christlichen, organischen Ständestaat sollte sowohl den Absolutismus wie auch „die Revolution“ überwinden. Von der Märzerfahrung traumatisiert umgab sich der sensible und emotionale König nach seiner Kapitulation mit einer ultrakonservativen „Camarilla“, dem Gegengewicht zum preußischen Märzministerium. Unter dem Einfluss reaktionärer Ratgeber verfolgte Friedrich Wilhelm eine zielbewusste konterrevolutionäre Politik, die im Staatsstreich vom Herbst 1848 und der Ablehnung der deutschen Kaiserkrone im April 1849 gipfelte. Nachdem sein anschließender Versuch der Gründung eines preußisch-geführten kleindeutschen Staatenbundes („Unionsplan“) im Herbst 1850 am Widerstand Österreichs gescheitert war, schwenkte der König auf einen Reaktionskurs ein, den er bis 1858 durchhielt. In diesem Jahr musste der durch eine sklerotische Erkrankung gezeichnete Monarch die Regierungsgeschäfte in die Hände seines Bruders Wilhelm (1797–1888) legen, der ihm nach seinem Tode (1861) als König nachfolgte.
In seinem Kampf gegen die preußische Verfassungsbewegung bemühte Friedrich Wilhelm IV. neben der Peitsche der Strafverfolgung und Zensur auch das Zuckerbrot der kleinen Zugeständnisse. Um die Verfassungsfrage zu entschärfen, lud er 96 Deputierte aus den acht Provinziallandtagen nach Berlin ein, wo sie 1842 als „Vereinigte Ausschüsse“ beraten sollten. Konkret ging es um die Bewilligung von Mitteln für den Eisenbahnbau. Prinzipienfest lehnten es die Deputierten ab, sich Kompetenzen anzumaßen, die gemäß dem Staatsschuldengesetz von 1820 – Hardenbergs letztem großen Erfolg – nur einer gesamtpreußischen Repräsentation zustanden. Nach 1842 nahmen sich die Provinziallandtage liberaler Anliegen an: der Pressefreiheit, Reformen des Wahl- und Strafrechts und der Verfassungsfrage. Dem König war all das zuwider. „Ich will die Brücke zum Liberalismus für mich und meine Nachfolger abwerfen“, schrieb er 1845. Aber der gesetzliche Nexus zwischen Kreditbewilligung und „Reichsständen“ sollte ihn gegen alle Absicht zum Brückenbau zwingen.
Wie leistungsfähig die preußische Politik auch nach der Reformzeit war, zeigt die deutsche Zolleinigung. Auf dem preußischen Zollgesetz von 1818 aufbauend, strebte die Berliner Regierung unter der Führung von Albrecht Eichhorn (1779–1856) und Friedrich von Motz (1775–1830) beharrlich eine innerdeutsche Zollunion an. 1828 wurde ein Zollbündnis mit Hessen-Darmstadt geschlossen, dem Hessen-Kassel 1831 beitrat. Nach Verträgen mit Bayern, Württemberg, Sachsen und den thüringischen Staaten trat am 1. 1. 1834 der „Deutsche Zollverein“ in Kraft, dem sich bis 1841 auch Baden, Hessen-Nassau, Frankfurt und Braunschweig anschlossen. Indem er Binnenzollgrenzen abbaute und den innerdeutschen Handel erleichterte, schuf der Zollverein einen nationalen Markt und gab der wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklung wichtige Impulse. Obwohl die Beitritte vor allem finanzielle Partikularinteressen der Mitgliedsstaaten widerspiegelten, hatte der Zollverein auch national-politische Auswirkungen, derer sich Preußen durchaus bewusst war. Im Laufe der 1840er-Jahre gingen Teile des liberalen Bürgertums angesichts der Stagnation in anderen Politikfeldern dazu über, vom Zollverein ein nationales Reformprogramm zu erhoffen. Zudem gab er Preußens Deutschlandpolitik eine Basis, die ihm Österreich nicht streitig machen konnte, weil seine wirtschaftliche Situation einen Beitritt zur deutschen Freihandelszone ausschloss. In seiner wirtschafts- und nationalpolitischen Dynamik stand der Zollverein in auffälligem Kontrast zum eigentlichen institutionellen Rahmen gesamtdeutscher Politik nach 1815, dem Deutschen Bund.
Die föderale Ordnung, die der Wiener Kongress den deutschen Staaten gab, ist vielfach kritisiert worden. Für Arndt war der Deutsche Bund „ein bleicher und schwächlicher Kümmerling und Kränkling und Krüppel“, der Nationalökonom Michael Lips (1779–1838) sah in ihm „etwas Monströses und Karikaturartiges“. In der Bewertung des Bundes zieht sich eine kritische Tradition von den liberal-nationalen Zeitgenossen über die borussisch-kleindeutschen Historiker bis zu Veit Valentin (1885–1947) und in die Gegenwart. In der Hauptsache wird kritisiert, dass der Bund beinahe ausschließlich der Durchsetzung einer rückwärts gewandten Beharrungs- und Unterdrückungspolitik diente und keine zeitgemäße Weiterentwicklung erfuhr. Für Golo Mann (1909–94) agierte der Bund „als Verhinderer, nicht als Beweger“ und erwies sich daher „als geschichtlich ungeeignet“. Tatsächlich blieb der Deutsche Bund entgegen den Erwartungen einer zunehmend in nationalen Kategorien denkenden Öffentlichkeit in vielen Bereichen untätig. Weder in Fragen der Wirtschaft, des Geldwesens, der Auswanderung, des Rechts noch in der Kirchenpolitik konnte der Frankfurter Bundestag irgendwelche konkreten Ergebnisse erzielen. Wenn er überhaupt tätig wurde, verlor er sich in Protokollangelegenheiten oder endlosen Banalitäten. „In solch armem Quarke war der Deutsche Bundestag groß“, bemerkte Veit Valentin: „Je bedeutender aber eine Frage war, desto kleiner wurde er dabei.“
In einer Frage jedoch, die beileibe nicht klein war, entwickelte der Bund beachtliche Qualitäten. Obwohl allgemein zugegeben wird, dass der Deutsche Bund völlig daran gescheitert ist, Deutschlands nationales Wohl zu mehren, kommentierte der progressive Londoner „Westminster Review“ 1835, „ist seine Nützlichkeit als Werkzeug des Despotismus sehr beachtlich.“ So erschien er auch vor allem der Oppositionsbewegung. Im September 1819 wurden die nur kurz zuvor in Karlsbad beschlossenen Maßnahmen eiligst zum Bundesrecht erhoben. Im folgenden Jahr nutzte Metternich die Ausarbeitung der Wiener Schlussakte, um durch die Festschreibung des „Monarchischen Prinzips“ einer weiteren Verfassungsentwicklung Einhalt zu gebieten. Die reaktionären Bundesmaßnahmen der Jahre 1832/3 läuteten nicht nur eine Phase der Unterdrückung oppositioneller Liberaler ein, sondern beschnitten auch die Souveränität der konstitutionellen Einzelstaaten. Bundesrecht brach Landesrecht. Aus Sicht der Nationalbewegung musste dieser Prozess ironisch erscheinen: „der Staatenbund verteidigte sich gegenüber der nationalstaatlichen Bewegung mit unitarisierenden Mitteln“ (E. R. Huber).
Der Deutsche Bund
Der Deutsche Bund füllte das Vakuum, das 1806 durch das Ende des Heiligen Römischen Reiches entstanden war. Der international anerkannte, unauflösliche Staatenbund, der durch die Bundesakte (8. 6. 1815) begründet wurde, beruhte auf den Grenzen des Alten Reichs (ohne das spätere Belgien und die italienischen Territorien) und den im Reichsdeputationshauptschluss (1803) festgelegten territorialen Veränderungen. Von den ehemals Hunderten reichsunmittelbarer Stände blieben 39 Mitgliedsstaaten des Deutschen Bundes (35 Fürstenstaaten und vier freie Städte). Art. 2 der Bundesakte definierte den Daseinsgrund des Bundes als „die Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit der einzelnen deutschen Staaten“. Darüber hinaus wurde seine Zuständigkeit auf wenige Zwecke begrenzt. Die Institutionen des Bundes waren schwach; die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Einzelstaaten blieb unklar. Es gab weder eine Exekutive noch ein Bundesgericht. Das einzige Zentralorgan war die (gemeinhin „Bundestag“ genannte) Bundesversammlung in Frankfurt, eine ständige Konferenz weisungsgebundener Regierungsgesandter unter österreichischem Vorsitz. Die Bundesversammlung tagte je nach Beratungsgegenstand entweder als „Engerer Rat“ (17 Stimmen) oder „Plenum“ (69 Stimmen). Dass in beiden Gremien Österreich, Preußen, Bayern, Sachsen, Hannover und Württemberg selbst zusammen (d. h. rund 83% der deutschen Bevölkerung) noch immer über keine einfache Abstimmungsmehrheit verfügten, zeigt wie groß die Rücksichtnahme auf die Unabhängigkeit der Einzelstaaten war. Besonders wichtige Fragen konnten nur einstimmig entschieden werden. All dies bewirkte, dass es entgegen den Andeutungen in der Bundesakte zu keiner Weiterentwicklung der Bundesverfassung kam. Ungeachtet dieser Rechtslage war es machtpolitische Realität, dass Österreich und Preußen (solange sie gemeinsam handelten) eine faktische Vormachtstellung in Deutschland innehatten, die sie vor 1848 vor allem zur Unterdrückung der liberal-nationalen Opposition nutzten.
Ein Großteil der Kritik am Deutschen Bund war und bleibt berechtigt. Dennoch sollte berücksichtigt werden, dass sich kaum Alternativen zu dem losen Staatenbund ohne starke Zentrale denken lassen, der 1815 aus der Taufe gehoben wurde. Die anderen theoretisch denkbaren Modelle – die Wiederherstellung des Alten Reichs, ein unitarischer Nationalstaat, ein unverbundenes Fortbestehen der Einzelstaaten oder ein Bundesstaat – kamen aus verschiedenen Überlegungen, die zumeist auf den Sicherheitsinteressen der europäischen Großmächte oder den Eigeninteressen der deutschen Einzelstaaten beruhten, nicht in Frage. Aller Wahrscheinlichkeit nach hing selbst innerhalb der Nationalbewegung 1815 die Mehrheit dem Gedanken eines föderativen Nationalismus an und wollte keinen deutschen Einheitsstaat. Zudem muss bei der Bewertung des Deutschen Bundes mitbedacht werden, dass er durch seine machtpolitische „Neutralisierung Mitteleuropas zugunsten der west- und osteuropäischen Flügelmächte … als zentraler Baustein des europäischen Sicherheitssystems“ (W. D. Gruner) fungierte. Damit der Deutsche Bund seinen innen- und außenpolitischen Kompromisscharakter beibehalten und somit seine europäische Stabilisierungsrolle wahrnehmen konnte, mussten Forderungen nach nationaler Größe und gesamtdeutscher Parlamentarisierung abgeblockt werden. Darin lag die Crux der politischen Krise, in die Deutschland gegen Ende der 1840er-Jahre geriet. Angesichts einer wachsenden Opposition gefährdete eben dieses Abblocken die Stabilität des politischen Systems. Zur Überwindung dieser Krise bedurfte es mehr intellektueller Flexibilität, Augenmaß und Courage als die Regierenden in Wien und Berlin besaßen. Die lähmende Revolutionsfurcht des Metternich-Systems wurde so zur self-fulfilling prophecy.