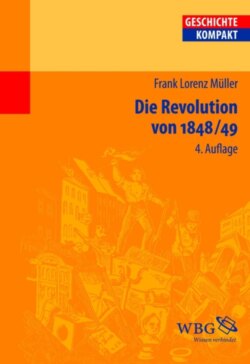Читать книгу Die Revolution von 1848/49 - Frank Lorenz Müller - Страница 9
a) Die deutsche National- und Einheitsbewegung bis 1848
ОглавлениеDie Französische Revolution konfrontierte die Deutschen mit einer Form des Nationalismus, die damals östlich des Rheins keine Entsprechung fand. Die Ideen und Soldaten, die nach 1789 von Frankreich kommend in Deutschland eindrangen, waren von einem Nationsbegriff erfüllt, dessen Intensität, Ausschließlichkeitsanspruch und Grad der Politisierung anzeigten, dass hier ein Nationalismus moderner Qualität entstanden war. Der einigenden und motivierenden Kraft eines solchen Verständnisses der eigenen Nation hatten die Bewohner des Heiligen Römischen Reiches zunächst nichts entgegenzusetzen. Zwar gab es wohl seit dem Spätmittelalter unter Klerikern und Adligen Frühformen eines deutschen National- und Reichsbewusstseins, das während der Türkenkriege auch weitere Bevölkerungsgruppen erfasste. Diese Ansätze zielten jedoch noch nicht auf die Bildung eines Nationalstaats. Auch die Entwicklung des nationalen Denkens im 18. Jahrhundert verwies keineswegs geradlinig auf die Entstehung einer modernen deutschen Volksnation. In der anwachsende Elite der akademisch Gebildeten – bei Beamten, Lehrern, Professoren, Ärzten, Juristen, Geistlichen und Schriftstellern – erwachte ein starkes Interesse an einer eigentümlich deutschen Nationalkultur. Von der Zentralität der Sprache ausgehend und in emphatischer Abgrenzung zur französisch beeinflussten Hof- und Adelskultur trugen Männer wie der Philosoph Johann Gottfried Herder (1744–1803), der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) oder der Historiker Justus Möser (1720–94) zur Konstruktion einer deutschen Kulturnation bei.
Freilich darf dieses intellektuelle Konstrukt einer literarisch-philosophischen Elite nicht mit einer Massenbewegung oder einem Programm zur nationalstaatlichen Einigung verwechselt werden. Der Berliner Buchhändler Friedrich Nicolai (1733–1811) schätzte, dass 1770 nur 20 000 Menschen aktiv an dieser nationalen Diskussion teilnahmen. Zudem blieb unklar, ob und wie die kulturelle Dimension mit politischen Zielen verknüpft war. Für den Philosophen Friedrich Schlegel (1772–1829) blieb die Mission der Deutschen streng kulturell: „Was Hellas schlau ersann, was Indien blühte, / German’scher Männer Lied wird’s neu entfalten“, schrieb er im Jahr 1800. Vier Jahre später sah Friedrich Schiller (1759–1805) die deutsche Nation außerhalb der Sphäre des Politischen. Für ihn war deutsche Größe eine moralisch-kulturelle Kategorie, die vom politischen Schicksal der deutschen Nation unabhängig war. Bei allem theoretischen Eifer, befand die Schriftstellerin Germaine de Staël (1766–1817), hatten die deutschen Gebildeten nur wenig Interesse an der „ganzen Wirklichkeit des Lebens“. Der unpolitische oder zumindest nichtoppositionelle Charakter dieser frühen deutschen Nationalbewegung erklärt sich aus der Verwurzelung seiner Trägerschicht in den Regierungs- und Verwaltungsapparaten der deutschen Einzelstaaten. „Teutsch“ zu fühlen und gleichzeitig ein patriotischer Württemberger zu sein, wurde nicht als Widerspruch empfunden. Die Forderung nach einer deutschen Literatur oder einem deutschen Theater ermöglichte somit, einem nationalen Bedürfnis zu entsprechen, ohne durch das Drängen auf eine nationalpolitische Vereinigung an dem partikularstaatlichen Ast zu sägen, auf dem viele Mitglieder des Bildungsbürgertums saßen. Außerdem geboten zahlreiche deutsche Einzelstaaten ihrerseits über ein beträchtliches Maß patriotischer Loyalität. Thomas Abbts (1738–66) Werk „Vom Sterben für das Vaterland“ aus dem Jahr 1761, beispielsweise, handelt vom Tod für Preußen. 1793, selbst nach der Invasion französischer Truppen, beklagte der Dichter Christoph Wieland (1733–1813), dass es sächsische, bayerische, württembergische und hamburgische Patrioten gebe, nicht aber deutsche Patrioten, die das ganze Reich als ihr Vaterland liebten.
Die Erfahrungen und Ereignisse der Jahre zwischen dem Frieden von Lunéville (1801) und der Niederwerfung Napoleons (1813/15) bewirkten hier einen tief greifenden Wandel. Während dieser Periode prasselte eine Reihe dramatischer politischer Erfahrungen und Veränderungen auf Deutschland nieder: Krieg und Niederlage, Besatzung durch französische Truppen, das Ende des Heiligen Römischen Reiches, die völlige Umgestaltung der deutschen Staatenlandschaft und politische Reformen in Preußen wie in den Rheinbundstaaten. All dies bildete den Rahmen, innerhalb dessen sich eine nationale Diskussion neuer Qualität entwickelte. Der vorherrschende Diskurs legte ein gutes Stück der geistigen Wegstrecke zurück, die laut dem Historiker Friedrich Meinecke (1862–1954) vom Weltbürgertum zum Nationalstaat führen sollte. Auffälligstes Merkmal dieser Veränderung war der schrille Franzosenhass, der jetzt vielen aus der Feder floss. Zudem waren die mitunter abstoßend gewaltberauschten Gedichte Ernst Moritz Arndts, Heinrich von Kleists (1777–1811) und Clemens Brentanos (1778–1842) gegen einen politischen Feind gerichtet. Kleists entsetzlicher Schlachtruf „Dämmt den Rhein mit ihren Leichen“ forderte nicht mehr eine kulturelle Abgrenzung, sondern ist nur im Kontext eines Todeskampfes zweier machtpolitisch agierender Nationen zu begreifen. Auf Herders Hochschätzung spezifischer Volksmerkmale aufbauend und – bei aller hasserfüllten Ablehnung – Impulse des französischen Nationalismus verarbeitend, schufen Männer wie der Publizist Joseph Görres (1776–1848), der Philosoph Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), der Theologe Friedrich Schleiermacher (1768–1834), der Publizist Ernst Moritz Arndt und der Pädagoge Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852) zwischen 1806 und 1813 das Programm eines politisierten romantischen deutschen Nationalismus.
Während der Rheinländer Görres eine Jahrhunderte überdauernde deutsche Volksidentität aus einem romantisierten Bild des Mittelalters herzuleiten suchte, knüpfte Fichte in seinen Berliner „Reden an die deutsche Nation“ (1807/08) an den herderschen Primat des Linguistischen an. Durch den Heldenmut der alten Germanen vor lateinischen Deformierungen bewahrt, war das deutsche „Urvolk“ mit einer kulturellen Weltmission betraut, zu deren Verwirklichung alle physischen und geistigen Kräfte der Nation aufzubieten waren. Für Schleiermacher war die Unterjochung der deutschen Nation ein Verstoß gegen eine gottgegebene Ordnung. Auch bei Arndt und Jahn spielten Gedanken wie die Unverfälschtheit und Überlegenheit der deutschen Nation und ihre quasireligiöse Weihe eine wichtige Rolle. Bei ihnen tritt außerdem die politische Brisanz des neuen deutschen Nationalismus deutlich in den Vordergrund. Schon Fichte und Schleiermacher hatten sich auf dieses Terrain vorgewagt. Fichte bezog den Staat direkt in seine Überlegungen ein, indem er ihm nationale Erziehungsaufgaben zuwies; in seiner „Staatslehre“ (1813) nannte er die deutsche Einheit ein allgemeines Konzept für die Zukunft. Im selben Jahr sehnte sich auch Schleiermacher nach einem deutschen Reich, um das gesamte deutsche Volk nach außen hin machtvoll zu vertreten. Arndt stellte hierzu detaillierte Überlegungen an. In seinem Werk „Über die künftigen ständischen Verfassungen in Teutschland“ (1814) forderte er eine von Preußen geführte deutsche Monarchie, in der Obrigkeit und Demokratie durch die gemeinsame Hingabe an das Volk miteinander versöhnt würden. Jahn betrachtete den Staat als die dauerhafte äußere Bestätigung des Volkstums.
Ernst Moritz Arndt (1769–1860) lehrte ab 1800 Geschichte an der Universität Greifswald. Zwischen 1812 und 1816 arbeitete er als Privatsekretär und Autor für den Freiherrn vom Stein. 1818 erhielt er einen Lehrstuhl in Bonn. Als ein prominentes Opfer der Demagogenverfolgung wurde Arndt 1820 entlassen und erst 20 Jahre später wiedereingestellt. 1848 gewann er ein Mandat für die Frankfurter Nationalversammlung, wo er dem rechten Zentrum angehörte. Auf seine Bonner Professur zurückgekehrt trat er 1854 in den Ruhestand. Nach anfänglicher Begeisterung für die Ideale der Französischen Revolution wandelte sich Arndt unter dem Einfluss der Ideen Herders zu ihrem unversöhnlichen Gegner. Gegen Napoleons Universalismus, den er als Vergewaltigung des Volksgeistes verstand, propagierte er die germanische „Uridee“ der Volksfreiheit. Der nimmermüde Agitator verfasste viele der aufpeitschendsten Kampfschriften und -lieder des frühen deutschen Nationalismus („Was ist des Deutschen Vaterland?“). Nach 1815 geriet Arndt zunehmend in Konflikt mit dem Restaurationssystem und wurde erst nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. 1840 rehabilitiert.
Der nationale Diskurs veränderte sich nicht nur inhaltlich: Er fand auch neue Wege der Verbreitung und erreichte neue Bevölkerungsgruppen. 1810 gründete Jahn in Berlin den „Deutschen Bund“, der auf die „Einheit unseres zersplitterten, geteilten und getrennten Volkes“ zielte und 1812 bereits über wenigstens elf Zweigvereine verfügte. Ähnliche Absichten verfolgten der ostpreußische „Tugendbund“ (1808), Jahns sportlichmilitärische „Turngesellschaft“ (1811) und die studentische „Deutsche Burschenschaft“ (1811/15). Für all diese Individuen und Gruppen galt der Krieg gegen den besiegt aus Russland zurückgekehrten Napoleon als Fanal. Der Aufruf „An mein Volk“ (17. 3. 1813), in dem König Friedrich Wilhelm III. der französischen Besatzungsmacht den Kampf ansagte, traf auf einen Taumel vaterländischer Begeisterung. So echt dieser nationale Enthusiasmus vielfach war, blieb er doch ein begrenztes Phänomen, das zwar weitere Bevölkerungskreise erfasste als je zuvor, sich aber zu keinem Zeitpunkt zu einer wirklichen Volkserhebung ausweitete. Eine statistische Untersuchung der Zusammensetzung der Freiwilligen-Einheiten, die sich neben den regulären Truppen formierten, ergibt ein widersprüchliches Bild: Nur 12% der Kämpfer gehörten zum Bildungsbürgertum, das gemessen an seinem Anteil an der Gesamtbevölkerung damit jedoch sechsfach überrepräsentiert war; ähnlich disproportional stark vertreten waren die Handwerker, die 41% der Freiwilligen stellten; Bauern und Landarbeiter hingegen, ca. 75% der Bevölkerung, machten nur 18% der Kämpfer aus. Die Nationalbewegung war aus dem engen Kreis des Elitären ausgebrochen, aber vorwiegend eine städtische Erscheinung geblieben. Nichtsdestoweniger rankten sich bald wirkungsmächtige und weithin rezipierte Legenden um die Helden des Befreiungskrieges, um die „wilde, verwegene Jagd“ des Freikorpsoffiziers Ludwig Adolf von Lützow (1782–1834) und den dichtenden Märtyrer Theodor Körner (1791–1813). Eine Konkretisierung der politischen Forderungen des deutschen Nationalismus fand im Rausch des Sieges über Napoleon allerdings nicht statt. Das Deutschland-Konzept blieb vage, weiterhin sprachlich-kulturell definiert und mit einem konfusen Freiheitsbegriff verbunden.
In den Jahrzehnten nach 1815 beflügelte das gewaltige Anwachsen der interessierten und zur Teilnahme befähigten Öffentlichkeit den kulturellen Nationsbildungsprozess: mehr und mehr Menschen konnten lesen (1830: ca. 40%), die Buch- und Zeitschriftenproduktion schnellte nach oben, und die Zahl der Studenten in Deutschland stieg von 5500 im Jahr 1800 auf 15.836 dreißig Jahre später. Ein kulturell-historisches Nationalbewusstsein blühte auf: Historiker wie Heinrich Luden (1780–1847), und Friedrich von Raumer (1781–1873) warteten mit vielbändigen Darstellungen zur Geschichte Deutschlands auf. Das Interesse am deutschen Mittelalter spiegelte sich auch in der Edition mittelalterlicher Quellen („Monumenta Germaniae Historica“) und im Siegeszug des Nibelungenliedes wider. Landauf, landab wurden unter großer öffentlicher Anteilnahme Denkmäler zu Ehren der Helden deutscher Kultur errichtet: Dürer, Gutenberg, Beethoven, Luther, selbst Hermann, Sieger über die frech gewordenen Römer. 1842 vollendete König Ludwig I. von Bayern (1825–48, geb. 1786, gest. 1868), sein Pantheon deutscher Genies, die Walhalla bei Regensburg. Unter der Führung Jacob und Wilhelm Grimms (1785–1863, 1786–1859), und Karl Lachmanns (1793–1851) profilierten sich die Erforscher der deutschen Sprach-, Literatur- und Rechtsgeschichte als Germanisten und begannen, nationale Kongresse abzuhalten. Die alljährlichen Treffen des „Vereins deutscher Naturforscher und Ärzte“, Carl Maria von Webers (1786–1826) als „Nationaloper“ gepriesener „Freischütz“ (1821), die Hochkonjunktur der Historienmalerei und das neogotische Projekt der Vollendung des Kölner Doms (1842) zeigen, wie auch Naturwissenschaften, Musik, bildende Künste und Architektur in diesen kulturellen Nationsbildungsprozess einbezogen waren.
Auf der politischen Ebene war die Entwicklung des deutschen Nationalismus konfliktträchtiger. Die Realitäten in Deutschland nach dem Wiener Kongress enttäuschten die Hoffnungen der Freikorpskämpfer. Die lockere Föderation 39 souveräner Staaten, die 1815 die Rechtsnachfolge des Alten Reichs antrat, verwarfen sie als unzeitgemäßes Repressionsinstrument, als Grab der freien und geeinten deutschen Nation. Viele glühende Patrioten der Jahre 1813/14 fühlten sich von den Fürsten verraten und richteten ihren nationalen Eifer nun gegen den partikularstaatlichen Status quo. Die Nationalbewegung ging in die Opposition. Auf dem Wartburgfest, das 1817 zu Ehren des dreihundertsten Jahrestags des lutherschen Thesenanschlags begangen wurde, mischte sich viel Fürstenschelte in die religiös-radikal-nationale Rhetorik der anwesenden Burschenschafter. Die Regierungen nahmen die Ermordung des konservativen Schriftstellers August von Kotzebue (1761–1819) durch einen Studenten daher nur allzu gern zum Anlass, um scharf gegen die nationale Opposition vorzugehen. Der staatlichen „Demagogenverfolgung“, die 1819 mit den Karlsbader Beschlüssen begann, gelang es, die Nationalbewegung zu unterdrücken, bis das europäische Revolutionsjahr 1830 auch im Deutschen Bund zu einer erneuten Aufwallung der Opposition führte. Im Umfeld des Hambacher Festes (27. 5. 1832), zu dem sich mehr als 20 000 Anhänger nationalen, liberalen und demokratischen Gedankenguts in Neustadt an der Weinstraße versammelten, wurde die partikularstaatliche Obrigkeit einmal mehr mit dem Verlangen nach Deutschlands nationaler Einheit konfrontiert. Der Journalist Johann Georg Wirth (1798–1848), einer der Organisatoren des Hambacher Festes, erklärte 1832, dass „die entschiedenen Patrioten Deutschlands nach der politischen Einheit ihres Vaterlandes“ verlangten. Auch der badische Kammerabgeordnete Paul Pfizer (1801–67) und der Darmstädter Journalist Wilhelm Schulz (1797–1860) erhoben in diesen Jahren die Forderung nach einem gesamtdeutschen Nationalparlament in schriftlicher Form. Wie schon 1819 reagierte der Bundestag auch 1832 mit scharfer Repression und bestätigte einmal mehr den oppositionellen Charakter der nationalen Idee.
Die Karlsbader Beschlüsse
Die so genannten Karlsbader Beschlüsse gaben dem politischen System der Vorrevolutionszeit sein reaktionäres Gepräge. Nachdem Metternich die Burschenschaften schon seit längerer Zeit misstrauisch beobachtet hatte, nutzte er die Gelegenheit, die ihm die Ermordung August von Koetzebues bot und lud Vertreter acht deutscher Staaten zu einer Konferenz ins böhmische Karlsbad ein (6.–31. 8. 1819). Die dort gefassten Beschlüsse wurden bereits am 20. 9. 1819 zu Bundesgesetzen erhoben. Ein Universitätsgesetz sah eine Überwachung der Hochschulen, die Entlassung ideologisch verdächtiger Professoren und das Verbot der Burschenschaft vor. Das Pressegesetz führte die Vorzensur für Druckerzeugnisse unter 320 Seiten ein. Zudem wurde mit der Zentraluntersuchungskommission ein politisches „Bundeskriminalamt“ eingerichtet. Die Eingriffskompetenz des Bundes in einzelstaatliche Angelegenheiten wurde generell gestärkt. Die Karlsbader Beschlüsse lieferten die gesetzliche Grundlage für die danach einsetzende so genannte Demagogenverfolgung und galten – mehrfach erneuert und modifiziert – bis 1848.
In der Entwicklung der deutschen Nationalbewegung markierte die Rheinkrise der Jahre 1840–41 eine entscheidende Etappe: Die leidenschaftliche Reaktion auf angebliche französische Expansionsgelüste mobilisierte zum ersten Mal ein deutsches Massenpublikum für die nationale Sache. Nachdem Frankreich einen diplomatischen Rückschlag im Orient erlitten hatte, versuchten Regierung und Presse in Paris die Kränkung dadurch wettzumachen, dass laut über eine Wiedereroberung des Rheinlandes nachgedacht wurde. In der deutschen Öffentlichkeit provozierte dieses bedrohliche Säbelrasseln helle Empörung, trotzigen Franzosenhass und ein allgemeines Gefühl nationaler Solidarität. Seinen bekanntesten und unüberhörbaren Ausdruck fand dieser „Durchbruch des modernen Nationalismus“ (R. Buchner) in der überaus populären Rheinliedbewegung, der wir u. a. Nikolaus Beckers (1809–45) „Sie sollen ihn nicht haben / den freien, deutschen Rhein“, Max Schneckenburgers (1819–49) „Wacht am Rhein“ und Arndts grammatisch wie inhaltlich bedenkliches „Zum Rhein! Übern Rhein! All-Deutschland in Frankreich hinein!“ verdanken. Außenpolitisch blieb die Rheinkrise ereignislos, da Frankreich seinen Worten keine Taten folgen ließ. Für die deutsche Nationalbewegung jedoch bedeutete sie einen Quantensprung. Von den Fürsten kurzfristig unterstützt (wie zuvor schon 1813), aggressiver gegen auswärtige Feindbilder gerichtet und weite Bevölkerungsschichten elektrisierend verwandelte sich der Nationalismus durch die kollektive Erfahrung der Rheinkrise in eine „selbständige politische Kraft, gegen die auf die Dauer alle anderen Legitimationsangebote chancenlos blieben“ (H. Schulze).
Die Stimmung, die bereits durch ein so explosives Gemisch von Emotionen wie dem bangen Gefühl nationaler Verletzbarkeit und dem Verlangen nach geeinter Machtstaatlichkeit geprägt war, verschärfte sich im Verlauf der 1840er-Jahre. Hierfür war vor allem der Schleswig-Holstein-Konflikt verantwortlich. In einem „Offenen Brief“ hatte der dänische König Christian VIII. im Juli 1846 seine Absicht angekündigt, das bisher nur in Personalunion mit Dänemark verbundene Herzogtum Schleswig ganz in den dänischen Staatsverband einzugliedern. Dieses Vorhaben, das die nationalen Leidenschaften in Deutschland hochkochen ließ, widersprach nicht nur den Wünschen der deutschen Bevölkerungsmehrheit in Schleswig, sondern verletzte auch die 1460 garantierte Unteilbarkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein, von denen letzteres Mitglied des Deutschen Bundes war. Die komplizierten erb- und lehensrechtlichen Probleme dieser Angelegenheit wurden jedoch in den jeweiligen nationalen Öffentlichkeiten darauf reduziert, ob Schleswig deutsch oder dänisch sein sollte. Dass selbst das kleine Dänemark es wagen konnte, die machtlose, zersplitterte deutsche Nation herauszufordern, machte dieses Thema besonders schmerzhaft für die deutsche Nationalbewegung. Man fühlte sich einer Geringschätzung ausgesetzt, die keine andere große Nation je erleiden müsste. „Denken sie sich“, forderte Friedrich Daniel Bassermann (1811–55) seine Kollegen in der badischen Kammer im Februar 1845 auf, „es berathschlage eine fremde Macht … darüber, ob sie nicht eine Provinz von Frankreich und England incorporieren könne. … Ja ich sage, man kann es sich gar nicht denken. … aber eine deutsche Provinz sich zu incorporieren, darüber kann … eine dänische Versammlung schon seit Monaten berathschlagen.“
Dass der Schleswig-Holstein-Konflikt wie schon die Rheinkrise teilweise mittels Männergesang ausgefochten wurde – das zuerst 1844 angestimmte „Schleswig-Holstein meerumschlungen“ wurde schnell zum Kampflied – war kein Zufall und verweist auf einen wichtigen Entwicklungsprozess. Im Laufe des Vormärz verfestigte sich die deutsche Nationalbewegung zu einem „organisierten gesellschaftlichen Nationalismus“ (D. Düding). Zentral für diese Veränderung war das wichtigste Vehikel der wachsenden Politisierung der Gesellschaft: der Verein. Bis zu ihrem Verbot im Jahr 1819/20 hatten die Burschenschaften und Jahns Turnbewegung als institutionelles Rückgrat der Nationalbewegung fungiert. Danach füllten die Gesangsvereine das Vakuum, das durch das Verbot der Turner und Burschenschaften entstanden war. Von den Bundesmaßnahmen der Jahre 1819/20 und 1832 verschont und von Dichtern wie Arndt, Becker, Körner, August Hoffman von Fallersleben (1798–1874) und Max von Schenkendorf (1783–1817) reichlich mit kernig-nationalem Liedgut versorgt, wurden die Sänger zur mitgliedstärksten und am weitesten verbreiteten Organisation innerhalb der Nationalbewegung. 1845, 1846 und 1847 nahmen Tausende an „Deutschen Sängerfesten“ in Würzburg, Köln und Lübeck teil. Im Revolutionsjahr sangen über 100 000 deutsche Männer in mehr als 1 100 Gesangsvereinen. Nachdem die Turnverbote in Preußen, Sachsen und den südwestdeutschen Staaten Anfang der 1840er-Jahre aufgehoben worden waren, blühte auch diese nur scheinbar unpolitische Freizeitbeschäftigung wieder auf. Wie die Sänger agierten auch die Turner auf der Bühne der nationalen Öffentlichkeit, indem sie „Turnfeste“ in Mainz (1842), Reutlingen (1845), Heilbronn (1846), Frankfurt (1847) und Heidelberg (1847) organisierten. 1848 ertüchtigten 90 000 Deutsche Leib und Seele in 250 Turnvereinen.
Diese beeindruckenden Zahlen sollten die Grenzen der Nationalisierung nicht verdecken. Trotz Tausenden von Sängern, Turnern und national Gesinnten blieb die deutsche Nation „ein städtisches Geschöpf, sie war ein Werk von Protestanten, und sie war eine Männergeburt“ (D. Langewiesche). Auch 1847 war deutscher Nationalismus noch kein Anliegen, das Millionen bewegte; aber er war längst kein politisch irrelevantes Elitenphänomen mehr. Als Resultat eines jahrzehntelangen Prozesses zahlenmäßiger Expansion und institutioneller Konsolidierung stellte die deutsche National- und Einigungsbewegung am Vorabend des Revolutionsjahres eine effektive politische Kraft dar. Ihre Kernforderung, den Deutschen Bund einer radikalen politischen Reform im nationalen Sinne zu unterziehen, war ein Stachel im Fleisch des monarchischen Staates. Ihre Existenz war eine „Voraussetzung für den Ausbruch der Revolution in Deutschland“ (D. Düding).