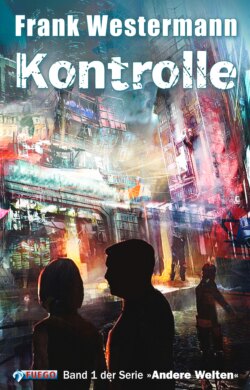Читать книгу Kontrolle - Frank Westermann - Страница 11
3.
ОглавлениеAls ich aufwachte, schien die Sonne. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die meisten Gebäude jetzt so hoch gebaut wurden, dass die Sonne keine Chance hatte, dazwischen durchzuscheinen. Aber hier mussten sie eine Lücke gelassen haben - wohl ein Konstruktionsfehler. Ob der Chef-Architekt deswegen degradiert worden war?
Ich hatte reichlich fest und tief geschlafen.
Nur langsam kamen die Erinnerungen an den letzten Tag hervor. Ich schüttelte ungehalten den Kopf. Ein andermal! Jetzt war ich wirklich nicht in Stimmung, darüber nachzudenken.
Neben mir vernahm ich die regelmäßigen Atemzüge von Lucky. Vorsichtig, um ihn nicht aufzuwecken, stützte ich mich auf meinen linken Arm und sah ihn an. Aber es war gar nicht Lucky. Es war Flie, die neben mir lag. Schon wieder eine Überraschung. Aber diesmal eine schöne, freudige. Ich hatte das Gefühl, als würde ich mit einer Gewaltkur aus meinem Gewohnheitstrott herausgerissen. Trotzdem war ich mir nicht sicher, ob es ausreichen würde.
Es sah aus, als hätte sich Flie im Schlaf in ihr Haar eingewickelt. Ihr Mund hatte sich zu einem kleinen Lachen verzogen. vielleicht träumte sie gerade was Angenehmes. Ich hatte nichts gemerkt, als sie zu mir ins Bett gekrochen war. Ich dachte kurz an die Zeit zurück, als wir näher und öfter zusammen waren. Mir fiel nur ein, dass sie oft verrückte Ideen im Kopf hatte und dass wir uns manchmal gestritten hatten, dass die Fetzen flogen.
Ich sah auf Luckys Uhr auf dem niedrigen Tisch neben dem Bett. Es war noch nicht so spät, wie ich gedacht hatte. Ob Flie noch immer diese blöde Schule besuchte? Dann hatte sie wohl Ferien.
Und wieder musste ich daran denken, was ich aus mir machen sollte. Ich war mir irgendwie sicher, dass ich es nicht aushalten würde, noch längere Zeit hier zu leben. Wenn man bloß irgendwie raus könnte! Mit ein paar Freunden. Außerdem brauchte ich dringend Geld. Ich hatte Schulden. Und dann wollte ich mir zwei oder drei bestimmte verbotene Bücher beschaffen. Ich kannte einen Typen, der welche vertickte, nicht weil er damit eine Überzeugung oder so verbreiten wollte, sondern weil es ihm nen Haufen Bucks einbrachte. Ich erinnerte mich, dass ich Lucky fragen wollte, ob er ein Buch verstecken konnte, das ich bei mir trug. Andere hatte ich draußen gelassen. Draußen … Ob ich jemals wieder so einen
Platz finden würde? Ich hatte Ruhe gehabt und Zeit. Aber es war auch nichts auf die Dauer.
Flie bewegte sich leicht und legte im Halbschlaf den Arm um meinen Nacken.
»Komm her, Speedy. Du siehst so traurig aus.«
Das stimmte wahrscheinlich. Aber nun hatte ich wirklich keine Lust mehr, über irgendwas nachzudenken. Ich begriff nur, dass sich zwischen uns nicht so viel geändert hatte, wie ich angenommen hatte. Ich kuschelte mich an sie und eine Welle von Wärme und Zärtlichkeit breitete sich aus. Zeit und Gegenwart verschwammen und hatten keine Gültigkeit mehr.
Es wurde ein glücklicher, beruhigender Tagesanfang. Ich hatte mich lange Zeit nicht mehr so wohl gefühlt. Welch ein Unterschied zu gestern, dieser Verwirrung und Niedergeschlagenheit! Da kam ich wirklich nicht so recht mit. Und trotzdem konnte ich mir vorstellen, dass meine Stimmung ebenso plötzlich wieder umschlagen konnte.
Irgendwann kam Lucky rein, setzte sich zu uns, nahm uns in die Arme und fragte, ob wir mit frühstücken wollten. Wir standen dann langsam auf, und ich glaubte, dass ich mich in Flie immer wieder verlieben konnte, ein unheimlich gutes, befriedigendes Gefühl. Wir hatten mal darüber gesprochen, und sie meinte, dass es ihr auch so ginge. Und so war die Beziehung wie eine immerwährende Wiederkehr zueinander.
Die Barriere von Misstrauen, Neid, Eifersucht und Konkurrenz hatte ich eigentlich ziemlich schnell überwunden, weil es sie unter diesen Leuten hier nicht gab. Das ganze Hin und Her um Zweierbeziehungen, Besitzansprüche, mit wem man schläft und mit wie vielen, konnte mich auch reichlich ankotzen. Nachdem ich das einmal durchgespielt hatte, reichte es mir für immer. Die Gesellschaft tolerierte alle Arten von Beziehungen offiziell. Aber unter der Hand waren Ehe und Zweierbeziehungen nach wie vor erwünscht. Niemand sagte etwas gegen Vielbeziehungen oder Kommunen. Aber man bekam die Benachteiligung auf andere Art zu spüren. Man erhielt nicht so schnell einen Job, kriegte weniger Geld als andere für die gleiche Drecksarbeit. Und man wurde von den ganzen gesellschaftlichen Etiketten, Traditionen und Zeremonien ausgeschlossen, was uns natürlich wenig kratzte, aber für viele ein Grund war, sich den Standardnormen zu unterwerfen. Denn ein Outsider lebt nicht besonders angenehm.
Die Kirche dagegen hatte kaum noch Einfluss, seitdem die Regs alles in die Hände genommen hatten. Das hatte wenigstens uns geholfen, veraltete Moral- und Lebensvorstellungen über den Haufen zu werfen. Denn wir hatten sowieso nicht vor, uns in irgendeiner Weise zu etablieren.
Wahrscheinlich war die Sexualerziehung nicht mehr so verklemmt wie vor dem Krieg, aber in einer solchen Gesellschaft ist Sexualität natürlich eine beliebte Ware und so blühte das Geschäft mit dem Sex und männliche und weibliche Prostitution standen hoch im Kurs. Von Liebe Zärtlichkeit und Gefühlen blieb dabei natürlich nicht viel übrig.
Unter Leuten in unserem Alter war es weiterhin üblich, Zweierbeziehungen einzugehen, allerdings oft ohne Ehe. Aber was besagte das schon. Die Eingeengtheit, Stumpfsinnigkeit und eingefahrenen Gewohnheiten machten sich genauso breit und lähmten jegliche Neugier und Erfahrungsmöglichkeit - sehr im Sinn der Regs und ihrer Bürokratie.
Wir waren Außenseiter - eine geduldete Minorität -, weil wir diese Tretmühle und die Scheinsicherheit in dieser Form des Zusammenlebens grundsätzlich ablehnten. Es klappte natürlich auch bei uns bei Weitem nicht alles - es war eben wahnsinnig schwierig seine Gefühle unter Kontrolle zu haben und gleichzeitig auszuleben -, aber immerhin besser als das sogenannte normale Gefühlsleben. Was wir im Großen und Ganzen überwunden hatten, waren Konkurrenzkisten und Eifersucht, großartige Szenen, in denen sich jeder beweisen musste, und die Brutalität einer eheähnlichen Lebensweise. Ich hatte den Kram ja mal praktiziert, und mir wurde schlecht vor mir selbst, wenn ich daran dachte.
Da wir mit mehr Leuten engen Kontakt hatten, waren wir sensibler geworden, empfänglicher für andere Gedanken und Handlungen, wir verstanden einander besser und konnten uns mehr aufeinander einstellen. Wir lernten viel mehr Anschauungen, Ideen, Lebensweisen, Fantasien kennen als der Durchschnittsbürger. Während meiner Studiumszeit an der Hohen Universität hatte ich oft mit Leuten diskutiert, die den Normen entsprachen und sie verteidigten. Das ganze Geschwafel, dass man sich eben nur auf eine Person konzentrieren könnte, eine besondere Geborgenheit brauchte, darum auch nur eine(n) lieben könnte und so weiter, durchschaute ich jetzt als mühsame Verteidigung vorgelebter Erfahrungen, alles schon etliche Male und Generationen vorexerziert, ohne jeglichen neuen Erfahrungswert für jemanden, der sich nicht an die überlieferten Schemata zu halten gedachte, teilweise mit einem progressiven Touch (»du kannst auch ruhig mit nem anderen Typen schlafen«), und teilweise ebenso verlogen, wenn man sich die Praxis der Leute ansah, die mit so vielen und nichtssagenden Worten um sich warfen. Ich hatte die Lebensgewohnheiten dieser Klugscheißer kennengelernt, ihre versteckten Streitereien, ihre nur notdürftig verborgene Geilheit auf andere Frauen und Typen, den wöchentlichen Gruppensex und seine wissenschaftliche Begründung, die Konkurrenten, die sich am liebsten duelliert hätten, und es sehr hinterhältig und versteckt auch taten, die Gutgläubigen, die immer eins aufs Dach kriegten, weil sie die Spielregeln nicht beherrschten, die dummen Mitspieler und die Leidenden (oft Frauen), die Macker und Regisseure, immer potenzkräftig, problemlos und modern gekleidet, die Redner und Zuhörer, die Zupacker und die Always Loser -, bis der morsche Bühnenboden unter mir krachend nachgab, und Unwissenheit und Unsicherheit meine sicheren Begleiter wurden.
Dafür waren wir Ausgestoßene. Die Regs wussten, welches Potenzial in uns stecken konnte, in den Fragen, auf die es keine Antwort gab. Sollte es zum Vorschein kommen, würden wir radikal bekämpft werden. Es gab eine ungeschriebene, unausgesprochene Grenze, bis zu der wir uns bewegen durften. Und darüber hinaus war Sense.
Beim Frühstück fragte ich Lucky, ob er das Buch verstecken könnte, was ich bei mir hatte. Er war leicht erstaunt.
»Ja, sicher. Ich kenn genug Plätze. Aber ich wusste gar nicht, dass du noch welche liest.«
»Ich hab nie damit aufgehört.«
»Trotzdem begreife ich immer noch nicht, was du davon hast.«
»In den Index-Büchern steht zum Beispiel oft viel drin, was uns in der Schule oder an der Uni nicht erzählt oder falsch erzählt wird. Hauptsächlich so geschichtliche Sachen. Das ist heute oft ne richtige Fälschung. Hast du mal was von Gewerkschaften gehört?«
»Nee. Was soll das denn sein?«
»So genau weiß ich das auch nicht. Es stand mal in einem Roman über Arbeiter und die waren in einer Gewerkschaft organisiert. Und als ihnen die Löhne zu niedrig waren, hat es diese Gewerkschaft erreicht, dass sie mehr Geld kriegten.«
»Wie denn?«
»Tja, da hab ich auch nicht durchgeblickt«, musste ich zugeben. »Immerhin wird uns hier nie was davon gesagt, dass Arbeiter mal was gemacht haben.«
Lucky blieb skeptisch und Flie warf ein: »Woher willst du wissen, dass diese Geschichte nicht erfunden war, und das, was wir hier lernen richtig ist?«
»Weil ich das oft gelesen habe, dass es politische Bewegungen gab, die gegen die Regs gekämpft haben.«
»Meinst du wie die Gangs hier?«, fragte Flie.
»Seit wann kämpfen die denn?«, bemerkte das Mädchen mit dem merkwürdigen Namen Yuka. »Die tun doch nix.«
Ich sah sie jetzt das erste Mal bewusst an. Sie hatte kurzes braunes Haar und eine auffällige Narbe an der Nase. Sie trug ein kurzes Kleid mit lustigen Motiven aus irgendwelchen Comics.
»Und wie haben die gekämpft?«, bohrte Lucky nach. »Mit zehn Leuten und Steinen gegen Schocklader?«
»Mensch, das weiß ich doch nicht. Ich bin doch keine lebendige Bücherei!« Ich fühlte mich hilflos und wütend.
»Es greift dich doch keiner an«, beruhigte Yuka mich. »Wir können es uns eben nicht vorstellen.«
»Okay«, brummte ich. »Ich les ja auch noch andere Sachen.«
Flie musste krampfhaft lachen und prustete ihren Kaffee über den Tisch. Lucky brachte sich mit einem Satz in Sicherheit während Yuka die Brühe übers Kleid lief.
»Oh, Scheiße!«, rief sie, während ich nun auch noch lachen musste.
Daraufhin sah sie mich so komisch an, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte zu lachen. Ich weiß nicht, was in dem Moment alles aus mir rausgekommen ist.
»Flie, ich brauch ein paar Klamotten von dir.«
Yuka ärgerte sich nicht mehr, hatte aber ihr Gesicht immer noch so komisch verkniffen. Lucky wischte den Tisch ab, Yuka ging sich umziehen und ich wühlte das Buch, das ich mitgenommen hatte, hervor. Flie nahm es mir aus der Hand.
»Zwanzig Sterne über mir«, las sie, während sie kaute. »Komischer Titel.»
»Es handelt von einem Typ, der zwanzig verschiedene Welten besucht und auf keiner leben kann«, versuchte ich zu erklären.
Lucky verzog das Gesicht. »Das ist ja schlimmer als hier. Wir haben wenigstens nur eine Welt, mit der wir fertig werden müssen.«
»Es geht auch mehr um die Lebensformen, die da beschrieben werden«. Ich war schon wieder in so ner Verteidigerrolle.
»Leider gibt's die ja nicht. Was hat es also für einen Sinn, sich damit zu beschäftigen?«
Wollte Flie schon wieder ne Diskussion anfangen? Yuka kam wieder rein. Sie hatte sich ne Hose und nen Pullover von Flie angezogen.
»Es könnte solche Lebensformen aber geben«, nahm ich den Faden wieder auf.
»Siehst du welche?«, fragte Flie ironisch.
»So weit bin ich auch schon, aber ich weiß nicht, was das bedeutet oder ob es was bedeutet.« Ich hatte keine Lust mehr.
Yuka blickte uns fragend an und dann stand Lucky auf.
»So, ich muss jetzt gleich weg. Was hast du denn nun vor, Speedy?«
»Na, ich muss wohl Arbeit suchen. Und wenn nur für einige Wochen. Aber ich brauche Bucks. … Bevor du gehst, kannst du mir mal das Buch zeigen, das der Typ dir in der Bibliothek gegeben hat.«
»Ja, klar. Hätte ich ganz vergessen.«
Lucky verschwand kurz in seinem Zimmer. Flie stellte das Geschirr zusammen - alles eklige Plastiksachen, aber es gab nix anderes oder es war wahnsinnig teuer - und ließ Wasser einlaufen. Die anderen aus der Wohngemeinschaft waren schon lange zur Arbeit.
Lucky brachte das Buch. Der Titel sagte mir überhaupt nichts: Zone Null.
»Ich lese einige Stellen daraus immer wieder. Aber ich begreife die ganze Sache einfach nicht. Ich lese sonst ja kaum was, aber davon komm ich nicht weg.«
Lucky war wieder ziemlich durcheinander, als er von dem Buch sprach. Mich machte sein ganzes Verhalten neugierig. Er sah auf die Uhr und sprang auf.
»Jetzt muss ich aber los, sonst feuern sie mich.«
»Kannst du mir das Buch mal ausleihen?«, rief ich ihm hinterher. »Ja, klar. Aber behalt's nicht zu lange. Ich les auch immer drin.«
Ich packte das Buch weg und fragte Yuka und Flie danach. Aber sie hatten es nicht gelesen und interessierten sich auch nicht sonderlich dafür. Ich fragte Flie ein bisschen über die Schule aus, aber sie hatte - verständlicherweise - keine Lust darüber zu sprechen.
»Immer derselbe Mist«, wehrte sie ab. »Unterricht nach Programm und nichts davon kann man gebrauchen. Das einzige, wo ich was Nützliches lerne, ist der Selbstverteidigungskurs. Ich glaube immer noch, dass da beim Computer ne Schraube locker war, sonst hätten wir das bestimmt nicht.«
»Da habt ihr ganz schön Glück«, warf Yuka ein. »Nachts kann man sich allein kaum noch auf die Straße trauen. Und als Frau schon gar nicht. Ich habe den Eindruck, dass die Gangs schon fast die Stadt beherrschen.«
»Genau«, bekräftigte Flie. »Neulich lief so ne Truppe in der City rum und schlug wahllos Leute zusammen und räumte ihnen die Taschen aus. Keiner half den Leuten. Einige sahen sogar interessiert zu.«
»Und die Cops?«, fragte ich.
»Ach, die ließen sich gar nicht erst blicken. Sie kamen, nachdem alles vorbei war, und gaben den Leuten gute Ratschläge, wie sie sich besser schützen sollten.«
Yuka knirschte mit den Zähnen. »Da haben die Leute sogar noch Glück gehabt. Neulich haben die Cops sich an einer dunklen Ecke ne Frau gegriffen, ihr das Geld abgenommen und sie vergewaltigt. Ich hab nur den Anfang gesehen, dann bin ich weggerannt Zuhause musste ich erst mal kotzen.«
Ich fühlte mich plötzlich sehr schlecht und so überflüssig.
»Als ich wegging, war doch mit den Gangs nicht viel los«, sagte ich leise.
»Einen Tag später haben sie praktisch die Stadt überschwemmt«, klärte Flie mich auf.
»Sie stecken alle unter einer Decke«, entfuhr es mir zornig.
Es war mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass die Gangs von den Regs toleriert und zeitweise auch unterstützt wurden. Sie wurden draußen geduldet, und man unternahm nichts gegen sie, wenn ihre Überfälle in der Stadt ein gewisses Maß nicht überschritten. Ich vermutete, dass es Absprachen gab, zwischen irgendwelchen Behörden und den verschiedenen Banden. Und solange sie sich nur untereinander abstachen, störten sie ja auch niemand. Die Regs konnten es sich jedenfalls nicht leisten, sie zu Feinden zu haben, obwohl sie ab und zu Treibjagden auf sie veranstalteten, eine große Show, die die Bevölkerung beruhigen sollte. Ich dachte an meinen Bruder, der irgendeine wichtige Rolle bei den Gangs spielte. Ich hatte ihn ewig nicht gesehen. Eigentlich kannte ich ihn gar nicht. Trotzdem konnte ich mir nicht vorstellen, dass er solche Überfälle inszenierte. Aber ich konnte es mir wohl nur nicht vorstellen, weil er mein Bruder war. Ich wusste nicht, ob die Gangs die Regs ebenso hassten wie wir. Wenn ja, waren sie eigentlich potenzielle Verbündete …
Wir halfen Flie dann beim Abwasch, auch so ein Anachronismus. Nahezu 90% aller Haushalte besaßen eine Spülautomatik ebenso wie einen Abfallkonverter und einen Anschluss an das Rohrpostsystem, und viele hatten sogar eine Wareneinkaufsautomatik. Nichts davon hier. Die Bewohner mussten ihre Post abholen, einkaufen gehen, ihren Müll nach draußen stellen. Als die Leute hier einzogen, mussten sie alles renovieren - auf eigene Kosten natürlich. Mauern, tapezieren, streichen, abdichten usw. Alles ohne die Hilfe irgendwelcher Automaten, denn dafür war kein Geld da. Außerdem war es gut, die Arbeit mit den eigenen Händen zu tun, zu sehen, wie alles langsam Formen annahm, das Material zu fühlen und schließlich ein Endprodukt zu haben, in dem man selbst drinsteckte. Ich hatte damals ähnlich in meiner Wohnung arbeiten müssen, wenn man so was Wohnung nennen konnte. Da die Leute alle nur sporadisch arbeiteten, dauerte es ne ganze Zeit, bis es in der Wohngemeinschaft so aussah, wie jetzt.
Langsam kam mir zu Bewusstsein, dass ich mich ja nun mal auf den Weg machen musste zum Arbeitscomp. Mir grauste davor, aber mir blieb nichts anderes übrig.
»Vielleicht hab ich was für dich«, unterbrach Yuka das Geschirrklappern.
»Was meinst du damit?«
»Ich arbeite in einen Randbezirk – beim Bau. Dort sollen neue Wohnblocks entstehen - eng und hoch, stickig und monoton. Beton- und Plastikklötze wie alles, du weißt schon. Wir könnten mal fragen, ob sie was für dich haben. Ich hab mir zwar heute freigenommen, aber wir können zusammen hingehen. Es ist besser als am Fließband oder in einer Maschinenhalle.«
Na, wenn das keine Gedankenübertragung war!
»Begeistert bin ich zwar nicht, aber was Besseres wird sich wohl kaum finden. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsplatz auch heute zu sehen …«
Yuka lachte. »Von Lust kann wohl keine Rede sein.«
Ne Stunde später saßen wir im A-Grav-Bus. Es war voll und stinkig. Sitzplätze gab es nur wenig. Und alle waren unheimlich eng zusammengepfercht. Die Platzangst war ein Phänomen, mit dem man fertig werden musste. Aber das war man sozusagen von Kind auf gewohnt. Es sollte allerdings Leute geben, die dadurch krank wurden. Die staatliche Propaganda benutzte dieses Argument, wenn sie mal wieder Leute in ihre Irrenhäuser sperrten. Dort sollte es schlimmer zugehen als im Knast. Doch niemand, den ich kannte, hatte jemals eine solche Anstalt von innen gesehen. Ich wusste nur, dass dorthin die »politischen Fälle« geschafft wurden, während im Knast die »einfachen Verbrecher« saßen.
An Platz wurde gespart, da es dem Staat überflüssig erschien, mehr als gerade eben notwendig bereitzustellen, und es kostete ihn schließlich was, neue Häuser bauen zu lassen. Der ganze Bausektor war zwar in staatlicher Hand, aber die Zulieferungsfirmen mussten bezahlt werden - und die Arbeiter. Ich glaubte, wenn man alles aufschlüsseln würde, blieben im Endeffekt gerade vier oder fünf Konzerne übrig, die alles beherrschten. Der Staat war der größte. Opposition dagegen gab es nicht. Gewerkschaften waren abgeschafft - wozu auch in einem Wohlfahrtsstaat? - Parteien gab es noch - Wahlen auch - aber sie unterscheiden sich nur in der Farbe ihrer Kleidung.
Der A-Grav-Bus flog kreischend etwa fünf Meter über der Straße dahin und ich konnte die Menschen sehen, die sich auf den Bürgersteigen drängten. Jetzt ging es ja noch, aber bei Feierabend wurden manchmal Menschen auf dem Heimweg zerquetscht.
An der nächsten Station geschah etwas, das etwa alle zehn Minuten außerhalb der Wohnung üblich war. Zwei Robot-Kontrolleure stiegen ein. Die Maschinen sagten keinen Ton, doch die Prozedur war allgemein bekannt. Wir mussten unsere Identitätsplaketten überprüfen lassen, wurden nach staatsfeindlichen Waren durchsucht und unsere Fahrtmarken wurden kontrolliert. Die Robots schoben rücksichtslos alte Leute und Kinder beiseite, um sich Platz zu schaffen. Widerstandslos ließen wir alle diese unwürdige Behandlung über uns ergehen. Dann erwischten die Roboter eine ältere Frau, die anscheinend ihre Plakette vergessen hatte. Verzweifelt suchte sie in ihren Taschen und beteuerte immer wieder, dass sie die Plakette nicht etwa verloren hatte, denn darauf stand eine hohe Strafe. Schließlich wurde sie gepackt und zum Ausgang gezerrt, wobei ein Mann, der unbeabsichtigt im Weg stand, von den Automaten niedergeschlagen wurde. Keiner sagte ein Wort. Wir waren alle abgestumpft und wehrlos. Fast jeden Tag war man Augenzeuge solcher Vorfälle. Nur ein Kind fing an zu weinen, wurde aber schleunigst von seiner Mutter wieder beruhigt. Yuka und ich versuchten, den am Boden liegenden Mann wieder auf die Beine zu kriegen. Ein Typ reichte uns schweigend ein Taschentuch, mit dem wir das Blut abwischen konnten. Langsam erholte er sich wieder. Er sah uns nur erstaunt an und stieg an der nächsten Station aus. Hätte er sich was gebrochen, kein Krankenhaus hätte ihn aufgenommen, und er hätte Schwierigkeiten gehabt, einen Arzt zu finden, der ihn behandelte. Jemand, der durch die Kontrollorgane in Schwierigkeiten geriet, hatte keinen Anspruch auf Hilfe.
Wir brauchten bestimmt ne Stunde Fahrtzeit, und als wir ausstiegen, fühlte ich mich elend und dreckig und wäre am liebsten wieder umgekehrt. Ich kannte die Gegend nicht, aber es sah aus wie überall. Graue Hochhäuser mit kleinen Fenstern. Bei vielen konnte man die obersten Stockwerke nicht mehr erkennen. Mir schwindelte leicht, und ich sah mich nach Yuka um, die ein ganzes Stück vorausgegangen war.
»Man merkt dir an, dass du ne Zeit weg warst«, sagte sie neugierig. Doch ich wollte nicht darüber reden. Ich wusste auch nicht, was ich dazu sagen sollte.
»Was machst du denn auf'm Bau?«, fragte ich sie.
»Ich zeichne Pläne, bediene ein paar Maschinen und koch Kaffee für den Chef.«
»Schöner Job«, murmelte ich.
»Ich will auch sehen, dass ich ihn behalte, wenn ich nicht zu viel Zugeständnisse machen muss.»
Ich verstand, was sie meinte.
Nach einem zehnminütigen Fußweg durch diesen Häuserdschungel kamen wir zu der Baustelle. Ein riesiges Gelände, vollgepfropft mit Sand, Beton, Plastikmaterial und ungeheuren Maschinen, die brummende, wütende Arbeitsgeräusche von sich gaben.
viele Arbeiter konnte ich nicht entdecken. Wahrscheinlich lief das meiste vollautomatisch und computergesteuert. Yuka führte mich zu einem Wellblechschuppen gleich vorne an.
»Lass mich allein reingehen. Du weißt ja, als Frau …«
Ich wusste. Auch das alles gab es noch immer. Mit einem netten Lächeln konnte eine Frau immer noch mehr erreichen als eine ganze Horde Männer mit einem Sack voll Argumenten. Das sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Frauen in allen Belangen den Männern untergeordnet waren. Sie bekamen zwar für gleiche Arbeit gleichen Lohn, aber das besagte nichts, da sie nur in den seltensten Fällen die gleiche Arbeit bekamen. Sie hatten in der Regel die stupidesten und monotonsten Arbeiten zu verrichten, die natürlich auch am schlechtesten bezahlt wurden. Der Slogan war nur dazu da, der Regierungspropaganda von der Gleichberechtigung zu helfen.
Ich lehnte mich an die Hütte und versuchte mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ich hier arbeiten sollte. Ich konnte es nicht. Es hatte alles nichts mit mir zu tun. Ich konnte mich mit nichts und niemandem identifizieren. Alle Gefühle in mir reagierten mit Abwehr. Ich konnte mir tausendmal sagen, dass es besser war, als die anderen Jobs, die ich gemacht hatte. Es half nichts. Ich fluchte lautlos herum und danach überkam mich wieder das Gefühl einer wahnsinnigen Einsamkeit und Leere. Ich war hilflos, wir alle waren hilflos. Und Hoffnung hatte ich auch keine - worauf auch? Aber ich wollte irgendwie leben. Es gab Leute, mit denen ich alles irgendwie über die Runden bringen konnte. Wir waren doch irgendwie eine merkwürdige Gemeinschaft, wo sich alle gegenseitig halfen und wieder auf die Füße stellten.
Yuka kam heraus und sagte mir, dass ich morgen anfangen könnte. Ich sollte die Maschinen sauber halten und andere solche Dreckarbeiten verrichten. Der Boss wollte mich nicht mal mehr sehen heute. Ich war nur eine Nummer, ein weiterer Arbeitssklave. Yuka bestätigte mir, dass hier sowieso nicht viele arbeiteten. Es war ja auch alles genormt und vorgegeben, sodass es leicht von den Maschinen allein erledigt werden konnte. Menschliche Fantasie oder Eigeninitiative waren unerwünscht.
Auf dem Rückweg fiel mir etwas ein.
»Arbeit habe ich ja jetzt«, sagte ich langsam zu Yuka. »Aber keine Wohnung. Und bei Flie und Lucky kann ich auch nicht immer wohnen. Ich komme mir da schon etwas blöd vor. Schließlich habe ich schon mal zwei Monate da gewohnt. Und das ist doch ein bisschen reichlich.«
»Und bei deinen Eltern?«
»Das geht auf keinen Fall!« Ich zuckte richtig zusammen.
»Da würde ich es nicht mal zwei Tage aushalten.»
»Ist wohl reichlich schlimm?«
»Mit meiner Mutter gehts ja noch. Aber der Alte … weißt du, er versteht einfach nichts. Er kann seine Vorstellungen und Ansichten um keinen Deut mehr ändern. Und so geraten wir uns nach zehn Minuten immer in die Wolle, wenn wir uns unterhalten. Ich müsste mich da total zurückhalten oder unterordnen und das kann ich nicht. Und meine Mutter gibt ihm am Ende immer Recht oder verteidigt ihn, obwohl sie sonst manchmal versucht, sich in meine Sachen reinzudenken. Aber sie hat eben ihre Normen und aus denen kommt sie nicht raus.«
»Hm. Bei mir ist es so ähnlich, nur andersherum. Mein Vater ist manchmal sogar richtig lieb und weiß ziemlich gut über mich Bescheid.«
Sie lächelte, als fiele ihr dabei was ein.
»Du kannst ja ne Zeit bei mir wohnen, bis du was Eigenes hast«, schlug sie vor.
»Ja, aber …« Ich kam mir wirklich etwas bescheuert vor. Das hatte ich ja nun nicht gewollt. Oder?
»Oh, es macht nichts«, sagte sie fröhlich. »Ich hab ne ziemlich große Wohnung. Zwar nur ein Zimmer, aber wir werden das schon hinkriegen. Hast du was zum Schreiben?«
Ich nickte. Sie war auf einmal furchtbar lebendig. Da kam ich überhaupt nicht mit, denn mir war das Ganze noch immer unangenehm. Wir waren schon wieder beim Bus-Stop angelangt, und sie schrieb mir ihre Adresse auf. Dann kam auch schon der Bus. Da ich erst mal gar nicht wusste wohin, blieb ich stehen. Sie gab mir noch schnell einen Kuss und rief aus der Tür:
»Tschau, Speedy. Ich bin heute Abend zuhause.«
Dann war sie weg - und alles noch etwas vertraute mit ihr. Ich merkte, dass ich sie eigentlich recht gerne mochte. Ich hatte zwar schlechte Erinnerungen an zusammen mit ner Frau wohnen, aber jetzt kam es mir gar nicht mehr so schlecht vor. Und außerdem war der Vorschlag von ihr gekommen und so war ich für sie wohl nicht irgendein blöder Macker.