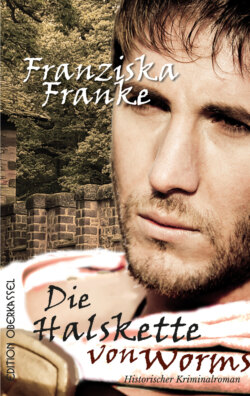Читать книгу Die Halskette von Worms - Franziska Franke - Страница 4
Das Schmuckstück
ОглавлениеJedes Mal, wenn ich Julia Marcellas Villa ansteuerte, bekam ich ein flaues Gefühl im Magen. Bestimmt würde mein Besuch wieder einmal völlig anders als geplant verlaufen. Obwohl am Himmel dunkle Wolken aufzogen und ein kalter Wind durch die Gassen fegte, verlangsamte sich meine Geschwindigkeit, je näher ich dem Ziel kam. Schließlich bummelte ich nur noch und blieb vor den Auslagen jedes Handwerkers oder Gemüsehändlers stehen. Doch trotz aller Verzögerungsversuche rückte die Villa unerbittlich näher. Als ich sie in ihrer ganzen Pracht vor mir liegen sah, bedauerte ich, mir unterwegs keinen Schluck Wein genehmigt zu haben. Ich hatte mich nämlich dazu durchgerungen, Pina, der Schwester der Hausherrin endlich einen Heiratsantrag zu machen. Damit mir dabei niemand in die Quere kam, begleitete mich mein Leibsklave Cicero, der die Dienstboten von uns fernhalten sollte.
Vor der Tür hielt ich inne und fuhr mir nervös durchs Haar, doch es war so kurz geschoren, dass es gar nicht in Unordnung geraten konnte. Dann fasste ich mir ein Herz und klopfte an. Es dauerte noch länger als sonst, bis endlich die Haustür aufgezogen wurde und wie üblich wollte mich der bullige Türsteher nicht einlassen.
»Ich möchte mit Pina sprechen«, verkündete ich und stellte den Fuß in die Tür.
»Sie ist nicht da«, erwiderte Julia Marcellas Wächter unwirsch wie immer und bewegte sich nicht von der Stelle.
Das Gefühl bitterster Enttäuschung stieg in mir auf, denn gewöhnlich war das Mädchen am späten Vormittag zu Hause. Außerdem war es bereits der zweite Anlauf, mich zu erklären. Zwei Tage zuvor hatte man mich mit der Auskunft vertröstet, Pina sei gerade auf Verwandtenbesuch. Dabei hatte keine der beiden Schwestern jemals weitere Familienmitglieder erwähnt.
»Da kann man nichts machen«, murmelte ich und blieb einen Augenblick unschlüssig auf der Schwelle stehen.
Als ich mich gerade zum Gehen wandte, huschte die Kammerdienerin der Hausherrin vorbei. Bei meinem Anblick hielt sie in der Bewegung inne und bedachte mich mit einem einfühlsamen Lächeln.
War es schon so weit gekommen, dass die Dienerschaft mich bemitleidete?
»Sie muss bald vom Markt zurückkommen. Willst du nicht solange im Atrium warten?«, bot mir das unscheinbare Mädchen an, worauf der Türsteher zwar das Gesicht verzog, dann jedoch endlich zur Seite trat.
Als ich eintrat, stieg mir der Geruch von geschmortem Fleisch verführerisch in die Nase. Ich wollte lieber nicht wissen, worum es sich handelte, denn ich hatte gewisse Vorbehalte gegenüber der gallischen Kochkunst. Zwar hatte man mir versichert, dass die Einheimischen keine Hunde mehr verspeisten, aber man konnte nie wissen, wie hartnäckig sich die alten Bräuche hielten. Aus dem Flügel, in dem sich Julia Marcellas Privaträume befanden, drangen Stimmen. Ich konnte nicht einmal unterscheiden, ob es Männer oder Frauen waren, die redeten, sondern vernahm nichts als das Murmeln einer fernen Unterhaltung. Ich konnte nur hoffen, dass kein Verehrer Pinas älterer Schwester seine Aufwartung machte.
Ohne genauere Weisungen abzuwarten, machte sich Cicero auf den Weg zur Küche, wo mein schmächtiger Leibsklave immer verwöhnt wurde. Dabei war es eigentlich seine Pflicht, mir bei öffentlichen Auftritten und Besuchen nicht von der Seite zu weichen. Ich sagte mir, dass ich einfach zu warmherzig sei, hielt ihn aber nicht auf, da er in der Küche mit dem neuesten Hausklatsch versorgt wurde. Die meisten Menschen reden im Beisein ihrer Sklaven als ob diese nicht vorhanden wären, weshalb ich Cicero immer ermahnte, sich alles zu merken, was ihm zu Ohren kam.
Während der Ermittlungen zu meinem letzten Fall hatte ich eine Woche lang in der Villa logiert. Seitdem verlief ich mich nicht mehr in den Zimmerfluchten und fand das Atrium ohne fremde Hilfe.
Es war ein quadratischer Innenhof mit Wasserbecken, der von Blumenkübeln gesäumt war. Irritiert bemerkte ich, dass in der hintersten Ecke ein großer, zotteliger Hund mit braunem Fell kauerte. Seine rosa Zunge hing zwischen seinen spitzen, weißen Zähnen und seine Ohren waren angelegt. Als er mich hörte kniff er die gelben Augen zusammen und fixierte mich misstrauisch. Dann streckte er sich und spannte die Muskeln, bereit loszuspringen. Ich blieb verärgert stehen.
Ich selbst hatte Julia Marcella geraten, sich einen Hund anzuschaffen. Aber das Tier sollte angekettet hinter der Haustür wachen und nicht frei in der Villa herumlaufen. Im gleichen Augenblick trat die Dienerin in den Innenhof, um mir einen Becher verdünnten Weins zu bringen, was meine Stimmung etwas anhob. Natürlich fürchtete ich mich nicht vor Hunden, aber etwas beruhigter war ich so schon.
»Das ist Ariovist, unser neuer Wachhund«, erklärte das Mädchen, beugte sich hinunter und strich dem Tier über den wuscheligen Kopf, bevor sie sich mir zuwandte. Während dieser Worte hatten Ariovist und ich uns gegenseitig beäugt.
»Du kommst leider zu einem ungünstigen Zeitpunkt«, bedauerte sie. »Die Herrin führt gerade zwei Kaufinteressenten in der Villa herum.«
Julia Marcella hatte nämlich vor einiger Zeit ein Anwesen in Italien gekauft und wollte dorthin übersiedeln, sobald sie Pina verheiratet hatte.
Nachdem das Mädchen wieder gegangen war, gähnte der Hund ungeniert und legte sich mit dem Kopf zwischen den Pfoten vor mich hin. Erleichtert wischte ich mir mit dem Handrücken über die Stirn, zog dann einen der drei im Atrium stehenden Stühle zum Wasserbecken und ließ mich darauf nieder. Lustlos nippte ich an meinem Wein und lauschte den Stimmen, die der Wind herwehte. Die Diener saßen anscheinend schwatzend und lachend beisammen, wie ich vermutete, in der Küche.
»Ein Totenkopffalter!«, tönte plötzlich eine gellende weibliche Stimme durch das Haus und schreckte mich aus meinen trübsinnigen Gedanken.
Eine zweite, wesentlich schärfere Frauenstimme, die Julia Marcella gehörte, forderte sie auf, sich nicht so anzustellen. Dann hörte man nur noch ein aufgeregtes Geraune. Es verebbte und mit einem Mal lastete eine beklemmende Stille auf der Villa.
Kurze Zeit später beehrte mich Julia Marcella endlich mit ihrer Anwesenheit. Bleich und mit aufeinandergepressten Lippen balancierte sie einen Weinbecher in das Atrium. Trotz ihres lateinischen Namens war sie eine Gallierin, hatte jedoch an diesem Tag römische Tracht angelegt. Über einem faltenreichen hellroten Gewand trug sie ein fliederfarbenes Manteltuch, das zwar gut zu ihrem blonden Haar passte, aber recht dick für einen warmen Sommertag war. Diese Stola war eigentlich keine Alltagstracht, sondern kam nur bei repräsentativen Anlässen zum Einsatz. Umso erstaunlicher, dass sich die Witwe nur mit einem halben Dutzend Ringe und wenigen Armreifen begnügte, denn gewöhnlich pflegte sie pfundweise Goldschmuck anzulegen.
»Schön, dass du vorbeigekommen bist«, sagte sie und begrüßte mich mit einem flüchtigen Heben der Hand. Ihre Stimme sollte wohl freundlich klingen, hatte aber einen gelangweilten Unterton. Die Witwe schien in Gedanken noch woanders zu sein und ihre Geistesabwesenheit ließ mich wieder in meinem Entschluss schwanken.
»Guten Tag, Julia Marcella, ich hoffe die Verkaufsverhandlungen waren erfolgreich«, bemerkte ich und forderte sie mit einer einladenden Geste auf, ebenfalls Platz zu nehmen, doch sie blieb neben mir stehen. Die Sonne schien ins Atrium und ließ Julia Marcellas – wie immer kunstvoll frisiertes Haar – wie Gold leuchten, betonte aber auch die feinen Kummerfalten um ihren Mund. Sie musste im Alter zwischen Achtundzwanzig und Fünfunddreißig sein und die letzten Jahre waren bitter gewesen: Zuerst der plötzlich Tod ihres treulosen Ehemanns, dann der Verdacht seine Mörderin zu sein, gefolgt von der Enttäuschung, dass der Bewerber, den sie gern zum Schwager gehabt hätte, ein Verbrecher war.
»Leider nicht!«, erwiderte sie und rang sich ein halbherziges Lächeln ab.
»Drinnen ist es recht kalt«, versuchte sie ihre Aufmachung zu begründen. Mir war gar nicht bewusst gewesen, dass ich sie angestarrt hatte.
»Eigentlich wollte ich mit Pina sprechen …«, begann ich.
»Sie ist leider nicht da. Ich weiß auch nicht, wo sich das Mädchen schon wieder herumtreibt«, wurde ich unterbrochen. Inständig hoffte ich, dass Pina tatsächlich bald zurückkommen möge. Ich war wirklich nicht in der Stimmung, mit der kapriziösen und momentan obendrein auch noch wortkargen Witwe Konversation zu betreiben.
Die Hausherrin lehnte sich an einen Pfeiler und seufzte leise, bevor sie ihren halbvollen Becher in einem Zug leerte und ihn der Zofe gab, die ihr auf dem Fuß gefolgt war. Mit finsterer Miene knetete sie ihre beringten Finger und starrte dabei auf den Boden.
»Was für ein Tag! Wegen eines harmlosen Schmetterlings gerät meine abergläubige Dienerschaft in helle Aufruhr«, brach es aus ihr heraus.
»Dann ist auch noch dieses junge Paar verschwunden, das sich für mein Haus interessiert hat. Ich war mir ganz sicher, dass sie es nehmen würden.« Sie senkte die Lider und massierte sich die Schläfen.
»Verschwunden?«, fragte ich, nachdem ich mit einem Räuspern die Aufmerksamkeit der Hausherrin auf mich gezogen hatte.
»Sie können sich ja kaum in Luft aufgelöst haben.«
»Das war nur so eine Redewendung. Sie haben sich in der allgemeinen Verwirrung aus dem Staub gemacht, ohne sich auch nur zu verabschieden.«
Den fluchtartigen Aufbruch der Interessenten hatte wohl die protzige Ausmalung der Räume und der daraus resultierende hohe Kaufpreis verursacht. Der Bauherr war der Geldwechsler Probus Marcellus, Julia Marcellas verstorbener Gemahl, der seine Kunden beeindrucken wollte. Die luxuriöse Villa zeugte daher eher vom Reichtum als vom Geschmack ihres Erbauers.
»Man hätte mich ruhig vor Ariovist warnen können«, beschwerte ich mich mit einem Seitenblick auf das braune Tier, das mit geschlossenen Augen vor sich hindöste.
»Außerdem sollte ein Wachhund aufmerksamer sein.«
»Du hast völlig Recht. Der Hund erfüllt nicht seine Aufgabe. Er beschnuppert jeden Fremden und lässt sich von ihm füttern. Wir könnten ihn genauso gut …« Schlachten und rösten? Trotz des milden Wetters sträubten sich mir die Nackenhaare bei der bloßen Vorstellung.
»… den Nachbarskindern schenken«, beendete Julia Marcella den Satz und ich fühlte, wie sich meine Muskeln wieder entspannten.
»Sie wünschen sich schon lange ein Haustier als Spielkameraden, aber ihre Mutter hat Angst, es könnte Lärm und Schmutz verursachen.«
Gedankenverloren griff sie sich an den Hals, hielt abrupt in der Bewegung inne und tastete sich mit gerunzelter Stirn die Haut ab. Sie wurde blass und verschwand wieder im Haus. Bevor ich mich dazu durchgerungen hatte, ihr zu folgen kehrte sie, bereits sichtlich aufgebracht, ins Atrium zurück.
»Meine Kette ist weg! Man hat mir meine Kette gestohlen«, stammelte sie mit zitternden Lippen.
Das war also der Grund für die für ihre Begriffe relativ dezente Aufmachung. Julia Marcella starrte mich an, als ob sich ihr schlimmster Albtraum als Wahrheit erwiesen hätte. Nicht Enttäuschung, sondern blankes Entsetzen spiegelte sich in ihren Augen.
»Vielleicht hast du schlicht vergessen, sie anzulegen«, versuchte ich sie zu beruhigen, denn das Gespräch drohte eine Wendung zu nehmen, die meinem Vorhaben nicht gerade dienlich war.
»Nein, das habe ich ganz bestimmt nicht! Bevor ich meine Gäste empfangen habe, schaute ich schnell noch einmal in den Spiegel und da trug ich die Kette noch!«, entgegnete Julia Marcella in dem für sie charakteristischen scharfen Tonfall.
Wie viele Frauen, die sich im Geschäftsleben durchsetzen müssen, gab sie vor, härter als die Männer zu sein.
»Vielleicht hast du sie gedankenverloren abgenommen und schlicht vergessen sie wieder anzulegen«, versuchte ich sie umzustimmen. Doch meine Enttäuschung steigerte sich zu einem Gefühl der Niedergeschlagenheit. Es war wohl wieder nicht der richtige Zeitpunkt über Pina und mich zu sprechen.
»Die Kette wird dir schlicht heruntergefallen sein«, schlug ich als weitere Möglichkeit vor, als Julia Marcella nicht reagierte.
»Aber ich habe nichts klirren hören«, widersprach sie.
»In meinem Haus gibt es überall Mosaikböden und Tonplatten. Das schwere Schmuckstück konnte nicht unauffällig herunterfallen.«
»Glaubst du wirklich, dass man dir die Kette vom Hals abgenommen hat, ohne dass du etwas davon mitbekommen hast?«, unternahm ich einen letzten Versuch, ihr den Diebstahl auszureden.
»Einer Bekannten hat man im Isis-Tempel nicht nur einen wertvollen Ring, sondern sogar ihr Diadem gestohlen, während sie ins Gebet versunken war.«
Wahrscheinlich hatte die Dame gerade eine Nebenbuhlerin verwünscht. Ich konnte mich jedenfalls des Eindrucks nicht erwehren, dass die meisten Isis-Verehrerinnen den Tempel aufsuchten, um dort Fluchtafeln zu deponieren.
»An allen öffentlichen Orten, an denen es viele Menschen gibt, treiben sich professionelle Diebe herum«, wandte ich ein. »Ich finde es aber etwas weither geholt, dass jemand eine zum Verkauf stehende Villa besichtigt, nur um ein Schmuckstück zu stehlen.«
»Es ist mir gleichgültig, ob der Diebstahl geplant war. Jedenfalls will ich mein Eigentum zurück!«, rief meine Gastgeberin empört aus. Vielleicht hatte auch einer der Dienstboten die Gunst der Stunde genutzt, um das Schmuckstück zu entwenden. Diesen Verdacht behielt ich lieber für mich, um nicht noch mehr Unfrieden zu stiften. Julia Marcella dachte jedoch offenbar das Gleiche.
»Ich werde die Dienerschaft befragen!«, verkündete sie, bevor sie wutentbrannt ins Haus zurückeilte.
Ich folgte mit einigen Schritten Abstand, während Ariovist träge liegen blieb. Schweigend beobachtete ich, wie die Hausherrin ihr Personal ins Verhör nahm, das aber einhellig beteuerte, von nichts zu wissen. Mit hängenden Schultern standen die Diener vor ihrer Herrin und schauten so arglos drein, dass es mein Misstrauen weckte. Selbst der arme Cicero wurde befragt. Doch wenigstens musste er keine Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Die eigenen Haussklaven hingegen wurden des Diebstahls, der Komplizenschaft und der Pflichtvergessenheit bezichtigt. Als Julia Marcella endlich die Schimpfwörter ausgingen, war sie außer Atem. Aber ihre Augen funkelten noch immer mit ihren Ohrringen um die Wette.
Ich hörte dem Wutanfall nur mit halbem Ohr zu und wartete geduldig ab, bis die Hausherrin wieder logischen Argumenten zugänglich war. Geduld war eigentlich nicht gerade meine Stärke, aber ich hoffte insgeheim, dass Pina in der Zwischenzeit nach Hause zurückkehren würde.
»Du hast ihnen nicht befohlen, deine Gäste wider Willen hier festzuhalten«, versuchte ich die Dienstboten zu entschuldigen. Mit dieser unbedachten Bemerkung lenkte ich aber jetzt den Zorn meiner Gastgeberin auf mich.
»Dein unangemeldeter Besuch hat mich abgelenkt. Sonst wäre ich aufmerksamer gewesen!« Ihre Stimme klang schrill.
Schön, wenn man die Schuld auf andere schieben kann, dachte ich. Aber es gab noch etwas, das mich die ganze Zeit beschäftigte, und zwar der Totenkopffalter. Normalerweise flatterten Nachtfalter nicht am helllichten Tag in Villen herum.
»Wo genau wurde der Schmetterling gesichtet?«, erkundigte ich mich.
»In der Küche, in der meine Dienerschaft gerade mit den Vorbereitungen für das Mittagessen beschäftigt war«, erklärte Julia Marcella und schürzte die Lippen, auch sie wirkte skeptisch. »Meine Besucher haben darauf bestanden, auch die Nutzräume in Augenschein zu nehmen. Daher kam ich nicht umhin, sie in die Küche zu führen. Der Falter muss zufällig durch das Fenster geflogen sein.«
Ich glaubte nicht an derartige Zufälle und wollte mich gerade erkundigen, ob einer der beiden Besucher eine Tasche bei sich getragen hatte, als ich von hinten angesprochen wurde.
»Vielleicht kann Marcus die Diebe fassen«, hörte ich Pina sagen, was ihr einen halb amüsierten, halb tadelnden Blick ihrer Schwester einbrachte. Mit einem Korb voll Gemüse in der Hand stand das Mädchen in der Tür und genoss unsere Überraschung über ihr leises Herantreten. Sie war genauso hochgewachsen wie ihre ältere Schwester, aber rothaarig und viel schlanker. Außerdem kochte sie gern, was Julia Marcella als einer vornehmen Frau unwürdig betrachtete. Was die beiden Frauen verband, war die Vorliebe für traditionelle gallische Gewänder in kräftigen Farben. An diesem Vormittag trug Pina unter einem giftgrünen gebauschten Gewand, das mit zwei Fibeln fixiert war, ein dunkelgrünes Untergewand mit engen Ärmeln, Manschetten und gerüschtem Kragen. Diese nicht gerade unauffällige Aufmachung wurde abgerundet von einer großen runden Schmuckscheibe, die an ihren Gürtel hing.
»Es war eine einfache goldene Kette«, griff die Hausherrin den Vorschlag auf. Ich konnte mir vorstellen, was die prachtliebende Witwe unter einfach verstand. Sie zögerte einen Augenblick, ehe sie weitersprach. »Mit drei gefassten Goldmünzen als Anhängern.«
Ich erinnerte mich, das Schmuckstück wiederholt gesehen zu haben, jedoch niemals außerhalb des Hauses. Eigentlich interessiere ich mich nicht für Geschmeide. Wahrscheinlich war mir dieses spezielle Exemplar nur aufgefallen, da auch Julia Marcellas verstorbener Mann eine Münze an einer Kette um den Hals getragen hatte, wobei es sich aber um eine Silbermünze gehandelt hatte. Langsam fragte ich mich, ob es ein gallischer Brauch war, sich mit Geldstücken zu schmücken. Die Frage erschien mir jedoch zu persönlich.
»Dann ist es ja kein allzu großer Verlust«, versuchte ich mit einem freundlichen Lächeln abzuwiegeln. Um ehrlich zu sein, war mir das Schmuckstück herzlich egal, obwohl mich natürlich die Höflichkeit davon abhielt, es laut auszusprechen.
»Du ahnst gar nicht, wie wichtig es für mich ist«, brach es aus der Hausherrin heraus. Sie starrte mich mit bleichem Gesicht an, schien aber ihre bestürzten Worte sofort zu bereuen.
»Es ist ein Familienerbstück, das mir meine Mutter vermacht hat. Ich wollte es wiederum meiner Schwester zur Hochzeit schenken«, fügte sie hastig hinzu, wobei sie es vermied, Pina anzuschauen, die nach ihrer erstaunten Miene zu schließen nichts von ihrem Glück wusste. Im Gegensatz zur Hausherrin legte Pina keinen Wert auf filigranes Geschmeide und empfindliche Seidenstoffe. Sie streifte gern durch die Natur, kannte sich gut mit Pflanzen aus und bevorzugte daher Kleidung aus robusterem Tuch und weniger fragile Schmuckstücke.
»Du wirst es doch bestimmt wiederbeschaffen?«, fragte sie und schaute mich mit großen, grünen Augen an. Ich teilte ihren Optimismus nicht, was ich aber lieber für mich behielt. Ich konnte nur hoffen, dass Julia Marcella die Kette nur verlegt hatte und sie von selbst wieder auftauchte. Die Hausherrin hatte inzwischen ihre Fassung völlig zurückgewonnen. Die Blässe war aus ihrem Gesicht gewichen und sie war wieder die selbstbewusste, kämpferische Bankierswitwe wie sonst auch.
»Du gehörst schließlich fast zur Familie«, erklärte sie, womit sie wohl andeuten wollte, dass sie mich nicht zu bezahlen gedachte.
Später schalt ich mich einen Trottel, weil ich diese Bemerkung hatte unkommentiert im Raum stehen lassen. Doch ich war zu geschockt vom Verlauf meines Besuchs, um schlagfertig zu sein. So hatte ich mir mein Leben als Gutsbesitzer nicht vorgestellt! Der Kaiser hatte mir mein schönes Anwesen übertragen, weil ich eine Verschwörung aufgedeckt hatte. Im Frühjahr hatte ich einen Mordfall aufgeklärt und nun sollte ich ein Schmuckstück wiederbeschaffen? Und das auch noch unentgeltlich! Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis man mich damit beauftragte, entlaufene Hunde einzufangen und verlorene Haarnadeln aus Messing zu suchen.
»Ich habe nicht ja gesagt«, wandte ich daher vorsichtig ein.
»Wenn du mir meine Kette wiederbesorgst, fahren wir alle zusammen nach Rom«, versprach Julia Marcella in einem honigsüßen Tonfall.
»Es ist höchste Zeit, dass Pina die Ewige Stadt kennenlernt.« Es war unfair, mich bei meiner schwächsten Stelle zu fassen, denn seit Jahren träumte ich davon, endlich einmal Rom zu besuchen.
»Ich kann mich ja mal bei den Juwelieren umschauen«, bot ich widerwillig an. Das verursachte schließlich keine Spesen. »Aber damit warte ich noch bis morgen. Ich glaube kaum, dass der Dieb das Schmuckstück sofort verkauft.« Das war natürlich nur ein Vorwand, um Zeit zu gewinnen, denn ich wollte vorher mit meinem Verwalter den Arbeitsplan für die nächste Woche besprechen und anschließend die Bücher überprüfen. In Wahrheit waren die Diebe gut beraten, sich so schnell wie möglich von ihrer Beute zu trennen, am besten in einer anderen Stadt.
»Wie gut, dass es dich gibt«, sagte Pina und strich sich mit einer graziösen Bewegung eine rote Haarsträhne aus der Stirn. Ich spürte, wie mein Herz vor Freude hüpfte, doch zugleich plagte mich das schlechte Gewissen, weil ich nicht an den Erfolg meiner Bemühungen glaubte.
»Du solltest dich endlich wie ein anständiges Mädchen aus gutem Hause benehmen«, wurde Pina von ihrer Schwester ermahnt.
»Bring endlich das Gemüse in die Küche und zieh dich dann um! Hast du denn nicht bemerkt, dass dein Kleid Flecken hat?« Das war eine starke Übertreibung. Es war nur leicht verschwitzt, was bei der sommerlichen Hitze kaum zu vermeiden war. Pina schaute aufmüpfig drein, öffnete den Mund zum Protest, überlegte es sich aber anders. Ihre Unterlippe zitterte, sie wandte den Blick ab und schritt mit hoch erhobenem Kopf davon.
»Könntest du mir bitte das Paar beschreiben, das dein Haus besichtigt hat. Ich hoffe, du kennst wenigstens ihre Namen«, forderte ich die Hausherrin auf, um das Gespräch in eine sachlichere Bahn zu lenken.
»Sie haben sich als Aulus Calpurnius und Lucretia Calpurnia vorgestellt. Der Mann war um die Dreißig, mittelgroß und recht attraktiv. Er war sauber rasiert, hatte ein dreieckiges, sonnengebräuntes Gesicht mit schmalen Lippen, einer langen Nase und dunklen Augen. Sie waren von feinen Falten umgeben. Wahrscheinlich hielt er sich meistens draußen auf. Seine Tunika war nicht geflickt, aber an manchen Stellen bereits fadenscheinig. Dazu trug er grobe Sandalen.«
»Du hast ihn dir ja genau angesehen«, bemerkte ich belustigt.
»Ich war lange im Bankgewerbe tätig. Da gewöhnt man sich an, die Kreditwürdigkeit seiner Kunden abzuschätzen« erwiderte die Witwe ungerührt. »Die Frau hatte volles dunkles Haar und trug einen ungewöhnlichen bronzenen Armreif am Oberarm, der ihr auch als Geldbörse diente.« Offenbar hatte Julia Marcella die Frau weniger interessant gefunden als ihren Begleiter.
»Sie waren also ein Ehepaar?«, rekapitulierte ich.
»Das haben sie zwar behauptet, aber ich glaube es nicht. Dafür hat der Mann seine angebliche Gattin viel zu höflich behandelt«, entgegnete die Hausherrin spitz. »Die junge Frau hat mich trotzdem die ganze Zeit grimmig beäugt.« Es war wohl gegenseitige Eifersucht im Spiel.
»Du solltest nachsehen, ob sonst noch etwas im Haus fehlt«, sagte ich, um Julia Marcella loszuwerden, denn ich hatte die Hoffnung noch nicht völlig aufgegeben, allein mit ihrer Schwester zu sprechen.
»Das kann ich auf den ersten Blick nicht sagen. Aber ich lasse es dich wissen, wenn ich etwas vermissen sollte.« Das war eine Aufforderung, mich unverzüglich an die Arbeit zu machen. Menschen, die Julia Marcellas manchmal recht brüske Art nicht kannten hätten es wohl als Rauswurf bezeichnet. Mit meinem Schicksal hadernd holte ich Cicero in der Küche ab. Als ich eintrat, verstummte das Gespräch und die Dienstboten blickten mich ängstlich an. Wenn ein Gast des Hauses die Küche betrat, bedeutete das meistens Ärger und davon hatten sie an diesem Tag schon genug gehabt. Ich machte eine beschwichtigende Geste, verließ den Raum und ging mit meinem Leibsklaven zum Ausgang, wo mich die Hausherrin bereits erwartete. Mit knappen Worten sagte ich Lebewohl, drehte mich jedoch auf der Türschwelle nochmals zu Julia Marcella um.
»Deine Besucher haben nicht zufällig erwähnt, wo sie wohnen?«, fragte ich ohne große Hoffnung auf eine brauchbare Antwort.
»Sie kommen aus Agrippina, wollen aber ihren dortigen Hausstand auflösen. Junius Petronius, der Freund meines verstorbenen Mannes hat ihnen gesagt, dass meine Villa zu verkaufen ist. Das haben sie jedenfalls behauptet.« Nicht schon wieder Agrippina! Ich hatte meinen letzten Besuch in der Veteranenkolonie noch in unangenehmer Erinnerung, eine Erfahrung, die ich nicht so schnell wiederholen wollte.
»Das hättest du mir auch gleich sagen können«, beschwerte ich mich. »Bist du sicher, dass du dem Mann nicht früher schon einmal begegnet bist, vielleicht in Begleitung deines Gatten.«
»Nein, ganz bestimmt nicht! An einen derart gutaussehenden Mann würde ich mich erinnern«, antwortete sie, ohne zu zögern. »Außerdem hat Probus mich nirgendwohin mitgenommen.«
Womöglich waren die Besucher ein professionelles Diebespaar. Er hatte mit der Hausherrin geflirtet, um sie abzulenken, während seine Begleiterin ihr den Schmuck gestohlen hatte. Bei einem männlichen Opfer hätten sie die Rollen anders verteilt. Unweigerlich musste ich an Julia Marcellas attraktiven Angestellten Marius Marfilius denken und ich beschloss ihn nach dem sauberen Pärchen zu fragen.
»Die beiden müssen irgendwo in Mogontiacum übernachtet haben«, gab ich zu bedenken, aber Julia Marcella zuckte nur mit den Schultern. Normalerweise hätte ich mir diese unfreundliche Behandlung verbeten. Doch ich wollte es nicht mit meiner zukünftigen Schwägerin verderben.
So schien es mir das Beste zu sein, mich wortlos zurückzuziehen, obwohl ich mittlerweile sehr verärgert war. Kaum hatten wir die Schwelle überschritten, fiel die Haustür bereits mit einem lauten Knall hinter uns ins Schloss.
»Als die Kaufinteressenten vorhin an mir vorbeigeeilt sind, habe ich etwas von einem Schmied mitbekommen, den sie hier kennen«, raunte Cicero mir draußen zu und ich klopfte ihm anerkennend auf die Schulter.
»Und was sagen die Dienstboten?«, erkundigte ich mich dann.
»Dass die verschwundene Kette gar kein Familienerbstück ist, sondern ein Geschenk ihres Mannes.«
Julia Marcella hatte sich also mehr aus Probus gemacht, als sie zugab. Wenigstens wusste ich jetzt, warum sie der Verlust des Schmuckstücks so bekümmerte. Ich lobte Cicero für seine Aufmerksamkeit und steckte ihm ein paar Kupfermünzen zu. Obwohl er es natürlich abstreiten würde, war ich mir sicher, dass er heimlich für seine Freilassung sparte.
Am Ende der Straße wandte ich mich nochmals um und warf einen raschen Blick auf die Villa, die ruhig und friedlich da lag. So hatte es zumindest den Anschein. Doch ich hatte noch immer den Verdacht, dass einer ihrer Bewohner die Hausherrin bestohlen hatte. Ich versuchte meine Enttäuschung über den Verlauf des Besuchs zu verdrängen, musste mir aber insgeheim eingestehen, dass es mir nicht gelang.
Ich hatte nicht nur den richtigen Moment verpasst, sondern fragte mich langsam, ob es den überhaupt gab.