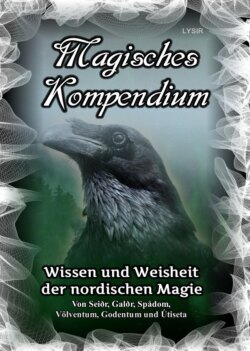Читать книгу Magisches Kompendium – Wissen und Weisheit der nordischen Magie - Frater LYSIR - Страница 10
Seidhr/Seiðr
ОглавлениеWenn man diese Vokabel aus dem Altnordischen nimmt, findet man die Schreibweise Seiðr, was wiederum bedeutet, dass der Buchstabe „ð“ als „dh“ oder auch als „d“ geschrieben werden kann. Hierdurch erhält man Schreibweisen, die man alle in der magischen Fachliteratur finden kann. Ob nun „Seiðr“, „Seid“, „Seidh“, „Seidhr“, „Seidr“, „Seith“ oder „Seithr“, alle sind möglich und auch vorhanden. Doch so, wie es verschiedene Schreibweisen gibt, so gibt es auch sehr verschiedene Blickwinkel, wenn es um Seidhr/Seiðr geht. Diese Blickwinkel beziehen sich auf die jeweiligen Zeiten, in denen beweisbare Funde existieren, welche sich auf Seidhr/Seiðr irgendwie münzen lassen. Das große Problem ist hierbei, dass man sich fragen muss, ob die jeweiligen Archäologen auch eine magische Fachkenntnis besitzen, um eben auch hier klare Verifikation auszuführen, um rituelle Handlungen zu erkennen, die man unter der Thematik „Seidhr/Seiðr“ einsetzen kann. So wird manchmal davon ausgegangen, dass in der skandinavischen Eisenzeit das Seidhr/Seiðr seinen Höhepunkt hatte.
Wenn man dann jedoch etwas genauer forscht, dann muss man hier klar und deutlich sagen, dass man sich primär auf die Zeit bezieht, wo die Römer in Mitteleuropa viele Bastionen und Handelsposten hatten. Meistens wird für die skandinavische Eisenzeit der Beginn auf das Jahr 750 v. Chr. genommen, bis ca. 380 n.Chr. - doch dieser Zeitkorridor sollte nicht zu eng genommen werden. Denn es gibt auch Meinungen, dass diese Zeit bis in die Wikingerzeit rein reicht, sodass man hier wieder von einem Zeitfenster spricht, welches bis zum Jahr 1050 n.Chr. möglich ist. Sinnvoll ist in meinen Augen eine Unterteilung, sodass hier versucht wird, den römischen Einfluss als Maß zu verwenden. Sinnvoll? Die Römer waren überhaupt nicht in Skandinavien! Stimmt! Dennoch kann man davon ausgehen, dass Handelsbeziehungen vorhanden waren. Auch wenn die Entfernungen wirklich sehr groß waren. Im rein wissenschaftlichen Sinne, wird von einer prärömischen Eisenzeit gesprochen, die in etwa von 750 v.Chr. bis dann ca. 50 n.Chr. reicht (die auch keltische Eisenzeit genannt wird), und von einer poströmischen (bzw. nur „römische“) Eisenzeit, welche man dann ab dem Jahr 50 n.Chr. deklarieren kann. Da die römische Kolonie, die sich im Gebiet Köln befand und um das Jahr 50 n.Chr. gegründet wurde, essenziell war, kann man hier einen entsprechenden Schnitt machen. Köln kann man hier sowieso als absolut wichtige Stätte sehen, die in Bezug auf die Expansionen von Händlern in den skandinavischen Raum absolut tragend war. Aus dieser Zeit sind natürlich viele historische Funde existent. Ach, echt? Es existieren historische Funde, die sich auf Seidhr/Seiðr beziehen? Nein! Aber auf die Römer! Na, das sind ja die perfekten Quellen, oder? Zum Glück hatten die ganz andere Götter, religiöse Vorstellungen, kulturelle Hintergründe, Maximen und kultische Handlungen. Oh ja! Stimmt! Vielleicht sollte man doch sehr skeptisch sein! Ja, muss man! In diesem Kontext sollte man einfach akzeptieren, dass Seidhr/Seiðr einfach als eine spezielle Art der Magie verstanden werden kann, die in der nordischen bzw. skandinavischen Gesellschaft praktiziert wurde. In diesem Kontext ist es vollkommen irrelevant, ob man die skandinavische Eisenzeit als Richtungswert nimmt, oder nicht. Vielleicht ist es sogar einfacher, einfach zu sagen, dass Seidhr/Seiðr die ursprüngliche Form der skandinavischen Magie ist, die schon immer in diesen Breiten ausgeführt wurde, ohne eine Beeinflussung von anderen Kulturen erhalten zu haben. Durch die Christianisierung, durch das Niederschreiben von kultischen Handlungen, welche von den Römern aber auch viel, viel später von christlichen Mönchen gemacht wurden, findet man zwar Sichtweisen und Blickwinkel, die jedoch alle „gefärbt“ sind. Es sind alles nur Berichte, die sich entweder auf Mythen, Legenden und Sagen beziehen, sodass hier definitiv keine klaren rituellen Handlungen bewertet werden konnten, oder, es sind Berichte, die auf Hörensagen basieren, mit viel Glück auf geheime Beobachtungen, wobei man sich selbst ausmalen soll, wie viele Römer sich wohl eingeschlichen haben, um Skandinavier bei ihren Ritualen zu beobachten. Das gilt im Übrigen auch für die Mönche!
Da hier also ganz klar archäologische Quellen fehlen, selbst wenn es manchmal in der Literatur anders dargestellt wird, muss man erst einmal sagen, dass Seidhr/Seiðr ein anderes Wort für „Magie“ ist, bzw. für „magische und kultische Handlungen“. Da ist es sogar verständlich, dass hier schnell der Begriff des nordischen Schamanismus keimt, da man eben keine anderen Erklärungsschablonen zur Verfügung hat, und der Begriff „Schamanismus“ so breit gefächert ist – hierbei mittlerweile auch eine literarische Akzeptanz besitzt, die der Vokabel „Magie“ noch fehlt –, dass man eigentlich zu allen magischen Handlungen „schamanische Arbeit“ sagen kann. Gut, wenn man sich jetzt die komplexen Kulturen in Sumer, Mesopotamien Babyloniern und Ägypten anschaut, dann wird der Begriff „schamanische Arbeit“ zum Glück nicht verwendet. Dies liegt aber auch daran, dass die Kulturen in diesen Ländern ganz anders gestaffelt waren, als in Mittel- und Nordeuropa. Sumer, Mesopotamien Babyloniern und Ägypten waren die Wiegen von Hochkulturen, während in Mittel- und Nordeuropa primär Sippen-, Stammes- und Dorfkulte das primäre Bild prägten. Dies darf jedoch nicht bewertend gedeutet werden. Fakt ist einfach, dass die Menschen in Sumer, Mesopotamien Babyloniern und Ägypten andere Bauwerke erschaffen haben, die auch durch die jeweiligen Witterungsverhältnisse länger Bestand hatten, als die Menschen in Mittel- und Nordeuropa. Denn wenn man sich zum Beispiel Stonehenge anschaut, welches in etwa auf 3000 v. Chr. datiert ist, existiert hier sehr deutlich eine Kultur. Dies zeigt aber auch, dass Steine den Witterungsverhältnissen ganz anders standhalten, als Holz.
Dies bedeutet auch, dass dennoch sehr wenige Bauten aus Stein geschaffen wurden, denn solche gigantischen und essenziellen Stätten wie Stonehenge sind nicht wie Tempelbauten in den Landstrichen Sumer, Mesopotamien, Babyloniern und Ägypten zu finden. Im heutigen Ägypten, Irak und Iran, gibt es sehr viele Ausgrabungen, Tempelanlagen und ganze Städte, die auch aus den Zeiträumen 3000 v. Chr. stammen, die aber eine deutlich höhere Verbreitung haben, als es die Bautenfunde in Europa besitzen. Zwar findet man in Europa immer noch viele Massengräber aus der Zeit vor 4000-3000 v.Chr., sodass man auch hier anhand der Skelette nachvollziehen kann, wie die Menschen in Mittel- und Nordeuropa zu dieser Zeit agierten (offensichtlich sehr kriegerisch), doch findet man eben keine klassischen Tempelanlagen, wo die kulturelle Geschichte in den Wänden verewigt wurde. Dadurch wird die Reproduzierbarkeit, die Glaubwürdigkeit, die historische, archäologische und etymologische Beweislage wirklich schwierig. Doch das Schöne an der Magie ist, dass man immer wieder gemeinsame Nenner finden kann, sodass man auch selbst Postulate erschaffen kann, um zu verstehen, welche rituellen Handlungen, Magiearten und Kulthandlungen aufgeführt wurden.
Da es in Skandinavien verdammt wenig Sandwüste gibt, dafür aber viele Fjorde, Küstenabschnitte, gigantische Wälder (Schweden hat heute noch fast 70 % der Landesfläche als Anteil der Waldfläche angegeben), hohe Berge (die Skanden bzw. die Kjølen, wo der höchste Berg 2469 misst, der Galdhøpiggen, im Jotunheimen-Gebirge) und somit auch echt raue Bedingungen hatten, kann man sich vorstellen, dass hier Jagd, fruchtbare Felder, Fischfang, mildes Wetter, wenig Eis und wenig Schnee überlebenswichtig waren. Wie man an der Bezeichnung „Jotunheimen-Gebirge“ sieht, sind die Welten Yggdrasils, als ganz normale Begriffe adaptiert wurden. Auch dies lässt einen kulturellen Blickwinkel zu.
Da die Magie immer von Männern und Frauen praktiziert wurde, da es hier auf Intuition und energetische Fähigkeiten schon immer ankam, ist es ein logischer Schluss, dass die Aufzeichnungen von Männern und Frauen sprechen, die Seidhr/Seiðr praktizierten. Wenn man dann wieder berücksichtigt, dass in der damaligen Zeit die Männer stärker die umliegenden Länder durchstreift haben, andere, körperliche Arbeiten ausgeführt haben, ist es auch wieder logisch, dass die Frauen, andere intellektuelle Fähigkeiten hatten, Philosophien erwähnen konnten, und untereinander einen entsprechenden Austausch pflegten, sodass die Aussagen, dass es mehr weibliche Seidhr/Seiðr-Praktizierende gab, nachzuvollziehen sind. Da durch die magische Praxis auch immer wieder entsprechende Bezeichnungen, Titel und Fachvokabeln auftauchen, werden in den Aufzeichnungen die jeweiligen magischen Menschen als Vǫlur / Völva, Gyðjas (weiblich) bzw. Goði (männlich), Seiðkona/Seiðkonur (weiblich) bzw. Seiðmaðr/Seiðmenn (männlich), Galdrakona (weiblich), Galdramaðr (männlich) und Vísendakona betitelt. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch hier reflektieren, dass die magischen und kultischen Handlungen stets einem Geheimnis untergeordnet wurden, sodass diese Arbeitsweisen definitiv nicht uneingeweihten ohne Weiteres gezeigt wurden. Man kann also davon ausgehen, dass die jeweiligen magischen und kultischen Handlungen mit einem „sozialen Tabu“ belegt waren, sodass fremde hier eigentlich keinen Einblick erhielten. Zwar taucht in der Historie hier der Begriff „Ergi“ auf, der belegen soll, dass dieses „soziale Tabu“ auch betitelt wurde, doch muss man dies auch kritisch hinterfragen dürfen. Ein kritisches Hinterfragen ist immer wichtig, denn letztlich ist mit dem Begriff „Ergi“ kein sozialer Tabubruch gemeint, sondern eher eine Beleidigung, die sich auf ein „weibisches“ oder „unmännliches“ Verhalten bezieht, was man, wenn man will, einfach auch mit „tratschen“ oder „verraten“ / „Verrat“ gleichsetzen kann. Hierbei ist der Begriff „Ergi“ das Substantiv und die Vokabel „Argr / Ragr“ das Adjektiv. Passender ist hier eher die Vokabel „Nīþ“, da es hier um eine Stigmatisierung bei kulturellen, sozialen und menschlichen Verfehlungen ging, also etwas, dass man ohne Weiteres anwenden kann, wenn es um Geheimnisverrat geht. Und dass ein Geheimnisverrat, gerade in Bezug auf magische, religiöse, kultische und andere Handlungen, nicht wohlwollend gesehen wurde, dürfte logisch sein.
Genauso logisch ist es, dass die jeweiligen magischen Protagonisten, also die Vǫlur / Völva, Gyðjas (weiblich) bzw. Goði (männlich), Seiðkona/Seiðkonur (weiblich) bzw. Seiðmaðr/Seiðmenn (männlich), Galdrakona (weiblich), Galdramaðr (männlich) und Vísendakona auch immer Praktikanten, Helfer, Lehrlinge, Novizen, Assistenten und Stellvertreter hatten. OK, ob hier wirklich „Praktikanten“ tituliert wurden, sei mal dahingestellt.
Da also alles irgendwie mit der Magie zu tun hat, bzw. mit Seidhr/Seiðr, ist es klar, dass hier die verschiedensten Handlungen thematisiert wurden. Wenn man also Seidhr/Seiðr in seiner vollkommenen Komplexität betreiben würde, dann ist man automatisch auch mit den Gaben der Divination gesegnet, sodass man die Titel „Völva“ oder auch „Spákona“ führte, also eine Seherin, eine Prophetin, eine „Stabträgerin“ war, sodass hier die Künste und die Gaben der Divination, der Weissagung, vollführt wurden, wobei „Völva“ hier der größere Titel war, da hier auch eine „Stabträgerin“ tituliert wurde, was bedeutete, dass sie eine große Prophetin war, die die Divination perfekt beherrschte, wohingegen die „Spákona“ auch des Öfteren als „kleine Seherin“ betitelt wurde, was wiederum bedeutet, dass hier offensichtlich die Alltagsfähigkeiten der Divination betitelt wurden, wohingegen die Stabträgerin, die Völva, die divinatorischen Aufgaben hatte, die Sippe bzw. den Stamm zu beraten. Dies ist etwas, was man in der heutigen Zeit auch ohne Weiteres nachvollziehen kann, denn wenn man magisch arbeitet, wenn man sich selbst evolutionieren will, sollte man seine divinatorischen Werkzeuge beherrschen. Ob dies jetzt die Tarotkarten sind, das Pendel, die Runen oder sonst irgendein Werkzeug, ist egal. Wichtig ist nur, dass man hier ein divinatorisches Werkzeug führen kann, um einen Kontakt zu seinem Unterbewusstsein aufzubauen, wodurch auch das eigene Tagesbewusstsein Materialien an die Hand bekommt (zum Beispiel Karten), um gewisse Thematiken einfach zu akzeptieren. Da es für „Völva“ oder „Spákona“ kein direktes „männliches Pendant“ gibt, kann man hier entweder die Thematik der „Hexe“ sehen (auch heutzutage wird eigentlich nicht Hexer gesagt, sondern manchmal „männliche Hexe“), oder einfach annehmen, dass die Divination ausschließlich den Frauen vorbehalten war, auch wenn sicherlich Männer entsprechende Fähigkeiten entwickeln konnten. Doch da es bei der Arbeit des Seidhr/Seiðr auch um einen energetischen Kontakt zu den jeweiligen archetypischen Schwingungen, Energien, Dynamiken, Mächten und Kräfte ging, muss auch die Fähigkeit der Evo- und Invokation Existenz sein. Dies wurde wiederum mit den Begrifflichkeiten der Gyðjas (weiblich) und Goði (männlich) getan, da es sich hier um die jeweilige Priesterkaste handelte, die mit den Göttern einen innigen, energetischen Kontakt pflegten, und für die jeweiligen Rituale, kultischen Handlungen und Tempelaufbauten verantwortlich waren. Man könnte hier auch einfach die Gyðja und den Goði als Zeremonienmeister sehen – da ich aber schon etwas über das Godentum geschrieben habe, soll diese Ausführung hier reichen.
Doch natürlich muss auch wieder die Galsterei bzw. die Inkantationsmagie berücksichtigt werden, wenn man Seidhr/Seiðr voll und ganz beschreiben bzw. ausführen will. So geht es also hier nicht nur um das Singen, dass rhythmische Sprechen, das Vibrieren, sondern auch um die Fähigkeit entsprechender Reimschemata und Verse zu kreieren, um Anrufungen überhaupt zu erschaffen. Die Spells, das Chanten, der klassische Zaubergesang, der Galðralag, darf eben nicht fehlen, sodass man als Seiðkona/Seiðkonur bzw. Seiðmaðr/Seiðmenn auch eben die Galsterei beherrschen musste, die Fähigkeiten der Galðrkona/Galðrkonur bzw. des Galðrmaðr/Galðrmenn. Tja, dies bedeutet, dass man für die Praxis des Seidhr/Seiðr alles beherrschen musste – Evokation, Invokation, Divination, Energiearbeit / Astralreisen / außerkörperliche Erfahrungen (Útiseta), Tempeldienst, Ritualistik … alles, was irgendwie mit der Magie zu tun hat. Und auch wenn es hier keine wirklichen, 100-prozentigen, Aufzeichnungen gibt, werden auch die Astrologie (Sternenkunde), die Meteorologie (Wetterkunde), die Geologie (Erdkunde bzw. Geländekunde), Nekromantie (Kontakt zu Toten und zur Anderswelt / Jenseits / Helheim), Phytologie (Pflanzenkunde) und sicherlich auch alle Ingenieurwissenschaften (wenn man an der Küste wohnte, sicherlich auch die Nautik / Seefahrtskunde) den Seiðkona/Seiðkonur bzw. Seiðmaðr/Seiðmenn zu eigen sein. Man musste ein Alleskönner, ein Samildánach (der Kunstfertige), ein Avatar sein! Nicht einfach, aber möglich!
Wenn Seidhr/Seiðr also bedeutet, dass man alles können muss, dann spiegelt sich dies doch auch bestimmt in der Wortherkunft wider, oder? Was heißt eigentlich Seidhr/Seiðr bzw. wo kommt es etymologisch her? Leider sind dies Fragen, die nicht vollkommen und zu 100 % beantwortet werden können. Man muss hier deutliche Abstriche machen, sodass man auch hier Vermutungen annehmen muss, um ein eigenes Bild zu kreieren. Solche Vermutungen beziehen sich darauf, dass das Wort Seidhr/Seiðr von dem „urindogermanischen / prägermanischen“ (auch wenn es immer noch nicht DIE Germanen gab, ist leider diese Begrifflichkeit adaptiert worden) Begriff „Saiðaz“ stammt. Wenn man hier eine Übersetzung kreieren will, könnte man „Zeichen, Mahnmal, Beziehung, Verknüpfung, Vorrichtung“ nehmen, was man dann, vielleicht mit einigen Zahnschmerzen, auch wieder auf eine Wahrsagerei, auf eine Divination beziehen kann. Es gibt auch noch andere Ideen, die sich zum Beispiel auf das litauische Wort „Saitas“ beziehen, was in der heutigen Zeit eher als „Link / Hyperlink“ übersetzt werden kann, damals aber auch als „Beziehung / Verbindung“ gedeutet/übersetzt wurde (saitų). Man kann aber auch zu dem präkeltischen Begriff „soito“ gehen, den man dann auch gerne mit „Zauberei“ oder auch einfach „Magie“ übersetzt, im christlichen Kontext aber auch auf den walisischen Begriff, der dann mit „Hexerei“, „Zauberei“, „Magie“ oder auch direkt mit „Teufel“ (was sich dann aber auch auf den Nachnamen „Hood“ bezieht) übersetzt werden kann.
Wenn man dann wieder in das Deutsche geht, in das Althochdeutsche, dann findet man hier den Begriff „Seito“, der dann mit „Saite“, „Band“, „Binden“ oder auch „Verbindung“ übersetzt werden kann. Man sieht also, dass die eigentliche Wortherkunft des Begriffes „Seidhr/Seiðr“ nicht ganz so einfach zu erkunden ist. Zwar kann man sich hier auf die klassische Magie beziehen, aber auch auf Verbindungen, bzw., wenn man hier wirklich die Saite nimmt, auf Schwingungen, Resonanzen und Oszillationen. Doch was soll das, mit den „Schnüren“ / den „Saiten“ in der Realität bedeuten? Man kann davon ausgehen, dass hier im magischen Kontext auch Instrumente gespielt wurden, gleichzeitig bezieht man sich auch auf entsprechende Gedichte, wie zum Beispiel die Ragnarsdrápa, ein skladisches Werk (skáld oder skæld bedeutet einfach nur „Dichter“), in denen der Begriff „Seidhr/Seiðr“ vorkommt. Dass hierdurch aber auch des Öfteren Verwirrung gestiftet wird, wird gern außer Acht gelassen. Die Verwendung von Schnüren und Saiten, bezieht sich in diesem Kontext deutlich auf die Knotenmagie bzw. auf das bewusste „Spinnen“ (in Bezug auf Spinnrad), also das Ausziehen und Drehen von Fasern zu einem Faden, sodass man in diesem Kontext seine Energien „verspinnen“ kann, um eine entsprechende Fokussierung zu erreichen. Ob man dies jetzt „Knotenmagie“ oder „Spinnenmagie“ nennt, ist eigentlich egal, wobei dann leider der Begriff „Spinnenmagie“ bei den meisten nicht als das Herstellen von einem Garn gedeutet wird, sondern sich sicherlich auf Spinnentiere bezieht, auf Arachnida, was dann definitiv nicht stimmt. Natürlich kann man auch diesen Begriff adaptieren, denn die Spinnen weben letztlich auch ihre Netze, so wie man auch mit der Magie energetische Netze weben kann, doch wird hierdurch ein echtes sprachliches Chaos ausgelöst. Dennoch sollte man dies im Hinterkopf behalten, denn selbstverständlich war beim Spinnen von Flachs oder Wolle es ohne Weiteres möglich, entsprechende Zaubersprüche, Spells oder Galdr / Galsterei auszuführen, um etwas zu erschaffen. In diesem Kontext geht es dann natürlich auch wieder um die „Schicksalsfäden“, um die drei Nornen, die Schicksalsgöttinnen, die am Fuße von Yggdrasil, an der Urdquelle, leben, und eben die Schicksalsfäden aller Existenzen, Menschen und Götter spinnen. In Bezug auf die eigenen Schicksalsfäden, sind hier wieder die Fachbegriffe Wurd/Urðr/Wyrd und Orlog/Ørlœg/Urlag zu nennen. Der Begriff Wurd/Urðr/Wyrd kann mit „das, was sich wendet“ oder mit „das, was geworden ist“ übersetzt werden. Es ist ein Begriff, der für das Schicksal und die Möglichkeit, des eigenen Energiefeldes steht, sodass man dieses Energiefeld selbst bearbeiten kann. Man kann also in sein eigenes „Schicksalsnetz“ greifen, in seine „Matrix“. Wenn man so will, besteht hier die Möglichkeit ein „Schmied seines Schicksals“ zu werden bzw. „eine Weberin seines Schicksals“. Daher ist es logisch, dass solche magischen und energetischen Arbeiten, eine dynamische Verbindung zu den drei Nornen Urd (Schicksal), Verdandi (das Werdende) und Skuld (Schuld; das, was sein soll) erschaffen, um eben in der EIGENEN energetischen Matrix des Seins zu agieren.
Tja und diese individuelle Matrix des eigenen Seins, kann mit dem Begriff Orlog/Ørlœg/Urlag übersetzt/verglichen werden, auch wenn Orlog/Ørlœg/Urlag ein Begriff ist, der im veralteten Sinne für „Krieg“, als Bedeutung eher „Vertragsloser Zustand“ stehen kann. Wenn man so will, ist der Begriff Orlog/Ørlœg/Urlag ein Synonym für die Urquelle, die alles ermöglicht, eine energetische Seins-Matrix, die dem kosmischen Prinzip des Äthers oder der Akasha-Chronik sehr nahe kommt. Statt Matrix könnte man auch einfach Netzwerk, „kosmische Gebärmutter“ oder Schöpfungsquell sagen, was dann, gerade in Bezug auf das Wort „Netzwerk“, einen Brückenbau erlaubt, einen Brückenbau zu den Begriffen „Saiðaz“, „Saitų“ und „Soito“. So wird aus dem lateinischen Wort „Matrix“ (Gebärmutter), eine Vernetzung von Computern, das Verwenden von Links und Hyperlinks - in Bezug auf die Magie sehr spannend. Gut, die Vokabel „Matrix“ hat natürlich unheimlich viele Bedeutungen, doch genau deswegen ist es sehr passend, wenn man diese Vokabel mit den Fachwörtern Wurd/Urðr/Wyrd, Orlog/Ørlœg/Urlag und Seidhr/Seiðr verknüpfen will. Alles ist mit allem verbunden, alles lebt, alles schwingt, alles agiert und evolutioniert. Alles hat eine schöpferische Tätigkeit, eine Tätigkeit, die eben magisch ist, gerade in Bezug auf die Erschaffung des Lebens, da die Gebärmutter hier ein sehr wichtiger Teil ist. Doch wenn man es primär auf Seidhr/Seiðr münzen will, ist die Matrix auch als ein Muster zusehen, welches aus Punkten besteht, wobei diese in Zeilen und Spalten angeordnet sind, vergleichbar mit Gittern oder eben wieder Netzen. Und schon ist man wieder beim Wurd/Urðr/Wyrd und beim Orlog/Ørlœg/Urlag, denn hier spielt das eigene Schicksal eine essenzielle Rolle, sodass man hier energetische Gittermuster „deuten kann“, die sehr wichtige Formgeber sind, wenn es um das Beschreiten des eigenen Weges geht. Alle Richtungen des Willens, der Evolution, der Selbstverwirklichung und der Magie selbst, sind dann in diesem Kontext hier zu finden.
Wenn man dann noch weiter mit dem Wort „Matrix“ spielen will, kann man in die Chemie gehen, wo das Wort „Matrix“ für die Summe der Hauptbestandteile eines Stoffes steht. Wenn man so will, dann ist also jeder magische Akt (und auch jeder Energiekörper, jeder Gedanke, jedes Ritual etc.) auch eine Ansammlung von essenziellen Energien, die die Gesamtexistenz des Menschen und auch der Existenz bzw. des Daseins ausmachen. Statt Chemie setzt man einfach Seidhr/Seiðr, und es wird klar, warum diese Fachvokabel letztlich alle magischen Handlungen irgendwie umschließt, durchdringt und darstellt. Ob nun Seidhr/Seiðr oder Matrix, es werden magische Arbeiten beschrieben, es werden Verbindungen beschrieben, sodass jedes Zupfen einer Saite, jeder Trommelschlag, jede Intonierung bzw. jede Beschwörung in einem Ritual (Galsterei), jede Invokation eines göttlichen Prinzips (Godentum), jede bewusste magisch-rituelle Handlung, jede Heilung, jede Verfluchung, jede Kontaktierung zu einer externen Energie (man könnte jetzt also auch wieder Fjölkynngi, Spádom/Spådom/Spádómr, Trolldom, Útiseta und Völventum schreiben) hier betitelt werden kann.
So geht es also bei Seidhr/Seiðr um einen energetischen Zugriff auf „Daseinsnetzwerke“, auf „Verkettungsenergien“ auf „Daseinsmatrizen“. Dies alles ist „MAGIE“! So ist das Wort „Seidhr/Seiðr“ in diesem Kontext als Wegschablone, als Netzwerk, als Möglichkeit zu sehen.
Es ist manchmal spannend, dass lateinische Begriffe, wie zum Beispiel das Wort „Matrix“, so breit gefächert verwendet werden können, was dazu führt, dass man hier eine Verbindung zu den Menschen schlägt, die damals „Latein“ als Sprache, als Amtssprache hatten, die Römer. Natürlich gibt es auch hier Aufzeichnungen, die sich auf die Magie bzw. auf Seidhr/Seiðr beziehen. Die Geschichtsschreiber des Römischen Reiches haben natürlich auch Aufzeichnungen verfasst, wobei man hier primär den Historiker und Senator Tacitus nennen muss. Dieser lebte in etwa in der Zeit von 58-120. Über sein Leben existieren viele verstreute Zeugnisse, und er hat sehr viel für die Nachwelt festgehalten. Unter anderem auch über den Bereich, den die Römer Germanien nannten, in einem Werk mit den Namen „Germania“! Hier geht es speziell um die Begrifflichkeiten side / sidsa, die man auch wieder mit „bezaubern“ oder „verhexen“ übersetzen kann, und was dann natürlich sehr nah an das Wort „Seidhr/Seiðr“ heranreicht. In seinen Beschreibungen geht Tacitus auf viele Bereiche ein, die man unter der großen Überschrift „Magie“ zusammenfassend kann, egal, ob es jetzt die Divination ist, also die Wahrsagerei, Erntezauber (Bezauberung von Samen, sodass bei der Aussaat alles gut ging und man eine reiche Ernte erhielt) oder die Totenbeschwörungen und Totenbannungen (hier wird z. B. der altenglische Begriff hellerūne verwendet, was sich auch wieder auf Frauen bezog, die Magie wirkten) ist. Es sollte natürlich logisch sein, dass die meisten magischen Praktiken hier nicht wirklich aufgeschlüsselt wurden, sodass die ganzen magischen Handlungen als „großes Arkanum“ („großes Geheimnis“ bzw. heagorūn) benannt wurde.
Unendlich viele Wörter beschreiben jedoch immer nur magische Aktionen. So kann man wahrlich als Abkürzung sagen, dass Seidhr/Seiðr alles beschreibt, was irgendwie magisch ist. Dies wird auch in den Geschichten so dargestellt, dass die Künste, die man besitzen und beherrschen muss, um Seidhr/Seiðr auszuführen, von den Göttern selbst kommen.
So, so, Seidhr/Seiðr kommt also von den Göttern!??! Von welchen denn? Natürlich von den Göttern des nordischen Pantheons! Aha! Also von Odin selbst, von wem auch sonst!? Nein, nicht wirklich! Odin hat die energetischen Möglichkeiten, die Machtparameter, die Kraftdynamiken, die hinter Seidhr/Seiðr stehen, von der Göttin Freyja erhalten, die eigentlich eine Vanin / Wanin ist, und mit ihrem Bruder, Freyr, und ihrem Vater Njörd/Njörðr, nach dem Krieg, der zwischen den Asen und den Vanen/Wanen ausgefochten wurde, als Friedensgarant, als Geisel die Welt Asgard besuchte.
Natürlich beziehen sich diese Informationen ausschließlich auf die Mythen, Sagen, Legenden und Geschichten, die sich in Skandinavien erzählt wurden, und die in den verschiedenen Dichtungen, den „Skalden“ niedergeschrieben wurden. Zu nennen ist hier unter anderem die Dichtung Sigurðardrápa (verfasst ca. 960) und natürlich die Edda, die jedoch viel später verfasst wurde. Die Edda ist ein relativ junges Werk, welches im 13. Jahrhundert im Rahmen der Christianisierung Islands verfasst wurde. Man kann ganz klar sagen, dass es sich um eine Aufzeichnung handelt, die von Christen geschaffen wurde, wobei man hier dennoch einen großen Fundus an Informationen finden kann. Man muss dennoch im Hinterkopf behalten, dass hier zum Teil christliche Werte zumindest im Hinterkopf des Verfassers existierten. So wird in den verschiedenen Dichtungen/Skalden berichtet, dass zum Beispiel Odin selbst eine Frau (mit dem Namen Rindr) durch seine magischen Gaben, durch Seidhr/Seiðr „bekommen“ / „erhalten“ / „verführt“ habe. Hier wird die spezielle Vokabel „Seiðberendr“ verwendet, die sehr selten in den jeweiligen Dichtungen / Skalden vorkommt, und sich auch wieder auf einen „Magier / Zauberer“ bezieht bzw. jemand der „aktiv den Zauber in sich trägt und wirken kann“. In einer weiteren Sage, die sich jedoch primär auf Island bezieht, in der Ynglingasaga, wird klar und deutlich gesagt, dass die Göttin Freya die Fähigkeiten von Seidhr/Seiðr, bzw. die Lehren / Möglichkeiten von Seidhr/Seiðr den Asen beibrachte, da sie von „Natur/Geburt“ diese Gabe hatte. In diesem Kontext hat Freya dann natürlich auch dem Gott Odin die Möglichkeiten von Seidhr/Seiðr gegeben. Andere Mythen, Legenden, Sagen und Geschichten beschreiben aber, dass der Gott Odin Seidhr/Seiðr „gefunden“ / „erschaffen“ hat, wobei man sich hier auf den Zaubergesang, auf die Galsterei bezieht, sodass allein durch den Klang, durch die Schwingungen, durch dieses besondere Versmaß, durch diese spezielle Poesieform (Galdralag) die Macht des Seidhr/Seiðr erkannt, verstanden und angewendet wurde. Doch auch in diesen Erzählungen ist ein klarer Hinweis darauf, dass eigentlich die weibliche Energie, die Grundschwingung des Archetypus der Anima eine absolut essenzielle Rolle spielt, da Andeutungen fallen, dass die Männer, bei der Verwendung von dem Galdralag, und somit der Verwendung von Seidhr/Seiðr, Kleider trugen, bzw. die Frauen nachahmten. Es sei einfach mal dahingestellt, ob es hier um spezielle, rituelle Gewandungen ging, die man im Allgemeinen als „Kleid“ oder einfach als „Kleidungsstück“ titulierte. Eine lange Robe, ist einem Kleid deutlich ähnlicher, als eine Hose! Interessant ist in diesem Kontext, dass manche Forscher meinen, dass die Männer, wenn diese Seidhr/Seiðr praktizierten, homosexuelle Grundzüge annehmen mussten, da es um eine Penetration ging. Dass in diesem Kontext eine Invokation, das Annehmen einer Gottform, auch eine Art der Penetration ist, wird mal wieder vergessen, bzw. es wird nicht gewusst, da man sich primär auf die Forschung der literarischen Texte bezieht, aber nicht auf die praktische Magie. Und selbst wenn Seidhr/Seiðr mit sexualmagischen Praktiken einherging, ist es immer noch eine „gängige und normale“ magische Praxis.
Dass hier die Sexualität tabuisiert wird, hat nichts mit Seidhr/Seiðr zu tun. Gerade in Bezug auf die Thematik zwischen „Mann“ und „Frau“ muss immer geschaut werden, ob es hier um energetische Aspekte geht, sodass man seine männliche und seine weibliche Seite zusammenbringen muss, wodurch man eine echte Einheit bildet, oder ob es darum geht, eine gewisse „Unmännlichkeit“ an den Tag zu legen, was mit der Begrifflichkeit „Ergi“ bzw. „Argr“ (aber auch earh, earg, arug etc.) getan wurde. So waren diese Begriffe eigentlich als Schimpfwörter gedacht, doch muss man hierbei wieder reflektieren, dass es etwas anderes ist, im magischen Kontext zu empfangen, als wenn man in einem sexuellen Kontext, als Mann etwas empfängt. Da es jedoch hier keine klaren schriftlichen Aufschlüsselungen gibt, wie, was, warum gemeint wurde, bleibt dies alles Spekulation. In den verschiedenen Texten, die sich auch teilweise als Gesetzestexte verstehen, existieren Hinweise, dass das Praktizieren von Seidhr/Seiðr bzw. das „Seiðmaðr“ sein, auch mit einer gleichgeschlechtlichen Aktivität verglichen wurde (kallar ragann), was dann wieder zu einem „Ehrverlust“ und einer „Stigmatisierung“ führte, die als „Niðingr“ oder „Nīþ“ bezeichnet war. Diese Stigmatisierung lässt sich aber auch darauf beziehen, dass hier ein „Bösewicht“ tituliert wurde, jemand also, der Schadensmagie betreibt, sodass sich hierdurch wieder ein entsprechender Schleier auf die negative Verwendung von Seidhr/Seiðr legt, was bedeutet das Seidhr/Seiðr primär zur Schadensmagie, zur Manipulation, zur Verfluchung und zur Bewusstseinsübernahme verwendet wurde. Bei diesen ganzen Thematiken muss man aber reflektieren, dass die jeweiligen Quellen, die Mythen, Legenden, Sagen und Geschichten eben eine christliche Prägung hatten, und man hier keine Aufzeichnungen besitzt, die deutlich vor dem 10. Jahrhundert, und somit deutlich vor der Christianisierung, verfasst wurden. So ist eine mögliche Manipulation, ein energetisches Eingreifen, ohne Weiteres als etwas „Verwerfliches“ oder auch „Weibisches“ zu sehen, zumindest dann, wenn die eigentlichen Konflikte entweder mit einem Faust-, Schwert- oder Axtkampf beglichen wurden. Nun ja, doch auch dies sollte man nicht zu wortwörtlich nehmen. Wie gradlinig, offen, direkt und aufrichtig die damaligen Männer waren, wenn es um Streitigkeiten ging, sei einfach mal in den Raum gestellt. Denn wenn man sich die verschiedenen Ränke, Intrigen und Umtriebe der Götter anschaut, wo betrogen, verschleiert, illusioniert und hintergangen wurde, dann muss die Kultur ein entsprechendes Spiegelbild gewesen sein. Odin, Thor und Loki sind hier die besten Beispiele dafür, dass Ehrlichkeit und Offenheit nicht immer verwendet wurden.
Ein anderer Blickwinkel, der Seidhr/Seiðr in einem negativen Licht erscheinen lässt, ist natürlich die Tatsache, dass Menschen, die um Wahrsagerei bitten, hier aber nur die Wahrheit hören, die dem Ego sicherlich nicht immer passt, auch sehr schnell missgünstige Informationen säen, erst recht, wenn die Prophezeiungen, die divinatorischen Arbeiten, so eintrafen, wie sie postuliert wurden.
Wahrheit! Was ist alles die Wahrheit, gerade wenn es darum geht, Seidhr/Seiðr zu thematisieren? In diesem Kontext muss man sich natürlich fragen, wie die praktischen Arbeiten, die Rituale und Riten, die divinatorischen Aktionen, die meditativen Ausführungen, wie auch die energetischen Erledigungen gestaltet waren. Gab es jetzt wilde sexuelle Ausschweifungen?! Ist dies eher eine Art der negativen Propaganda!? Wie schon erwähnt, findet man keine klaren Aufzeichnungen, die dies alles haarklein aufschlüsseln. Man muss in diesem Zusammenhang einfach akzeptieren, dass die bisherigen Niederschriften davon berichten, dass Seidhr/Seiðr primär von den Frauen praktiziert wurde, jedoch auch viele Männer mit eingeflochten wurden. Da die Männer zum Teil aber hier keine klaren Kriegereigenschaften haben mussten – man könnte auch sagen, es war ein Panoramablick und kein Tunnelblick vonnöten – wurde die Arbeitsmethode des Seidhr/Seiðr in ein schlechtes Licht gerückt. Heutzutage ist dies ähnlich, denn wenn man seinen Verstand gebraucht, andere in Diskussionen und geistigen Auseinandersetzungen ohne Weiteres überflügeln kann, wird man schnell mit Spott und Häme überschüttet. Auch dies muss man reflektieren, wenn es um die Klassifizierungen und Erzählungen des Seidhr/Seiðr geht. Wichtig ist einfach zu begreifen, dass die magische Praxis stets einen Ausgleich fordert, sodass man mit seinen männlichen und seinen weiblichen Anteilen harmoniert, dass im eigenen Inneren das wahre „Goldene Herz“ schlägt, dass die „chymische Hochzeit“ zelebriert wurde, dass man seine verschiedenen energetischen und persönlichen Anteile kontaktieren kann, sein Ego kontrollieren kann, um dann effektiv zu arbeiten. Genau deswegen ist stets der Protagonist in der Magie – und somit natürlich auch in den Arbeiten des Seidhr/Seiðr – das absolut Wichtigste. Es ist spannend, dass in den verschiedenen Mythen, Legenden, Geschichten und Sagen (wie zum Beispiel die Sage von Erik dem Roten) Berichte auftauchen, dass Seidhr/Seiðr auch zur Verfluchung eingesetzt wurde, doch trifft dies auf alle Magiearten der Natur zu. Wenn der eigene Stamm, die eigene Sippe, die eigene Gemeinschaft, die eigene Familie bedroht wird, wird man sich zur Wehr setzen – egal wie und egal womit. Wenn man über die Fähigkeit verfügt, Seidhr/Seiðr zu zelebrieren, wäre man dumm, wenn man diese Möglichkeiten nicht nutzen würde. Dies bedeutet auch, dass man eben divinatorisch arbeitet, um zu erkennen, welche Möglichkeiten die Zukunft bereithält, um dann vom Zeitpunkt der Divination reflektiert zu agieren, sodass die Zukunft entweder eintritt, die in der divinatorischen Arbeit erkannt wurde, oder, dass diese eben nicht eintritt, wenn sie für die eigenen Ziele kontraproduktiv ist.
Warum in Bezug auf Seidhr/Seiðr das Thema der Sexualität immer tabuisiert wird, liegt möglicherweise auch an den Autoren selbst. So wird zum Beispiel berichtet, dass die Frauen, die Seidhr/Seiðr betrieben, eben auch Stäbe hatten, sodass hier auch wiederum die Begrifflichkeiten / Titel „Völva“ oder auch „Spákona“, zu nennen sind, also Seherinnen, Prophetinnen oder auch „Stabträgerinnen“. Diese Stäbe sollen auch eine phallische Form gehabt haben, sodass hier natürlich die Sexualpraktiken der Masturbation denkbar sind.
Doch warum sollte so etwas gemacht werden? Ganz einfach, der Grund ist der Gleiche, warum die Hexen nackt auf ihren Besen ritten. Hierbei muss man einfach reflektieren, dass man dem Körper verschiedene Drogen auf verschiedene Art und Weise zuführen kann. Natürlich kann man einige Drogen ganz einfach oral aufnehmen, sodass man irgendetwas schluckt, hofft, dass man sich nicht über gibt, dass die Leber nicht zu viel abbaut (First-Pass-Effekt) und dass letztendlich auch einiges vernünftig verstoffwechselt wird. Doch solche Substanzen, solche Drogen, solche phytopharmazeutischen Dinge, kann man auch rektal oder vaginal aufnehmen. Auch hierdurch kann man einen Rausch erzeugen, und genau dies ist denkbar, wenn über die entsprechenden sexuellen Praktiken spekuliert wird. Ob es wirklich so war, sei einfach mal in den Raum gestellt. Möglich ist es, denn einige Stoffe lösen bei der oralen Applikation größere Probleme aus, als sie es bei einer rektalen oder vaginalen Applikation tun. Gleichzeitig muss man reflektieren, dass die Energie, die sich bei einem Orgasmus aufbaut, gigantisch ist, und dass man genau diese Energie nutzen kann, um den magischen Akt wortwörtlich zu besteuern. Auch dies ist nichts Verwerfliches und ist ein ganz normales magisches Mittel der Wahl.
Wenn man sich die verschiedenen Aufzeichnungen über Seidhr/Seiðr anschaut, bzw. sich auf das direkte Vorkommen des Wortes „Seidhr/Seiðr“ versteifen will, muss der Runenstein in der Kirche von Sønder Vinge in Dänemark betitelt werden. Hier ist es wichtig, dass es der Runenstein ist, der im 19. Jahrhundert in die Kirche geholt wurde, da der Ort Sønder Vinge über zwei Runensteine verfügt. Einer steht außerhalb und einer steht innerhalb der Kirche. Auf dem Stein, der innerhalb der Kirche steht, kann man folgende Inschrift lesen:
Guði )/ Ǿði bryti rēsþi stēn þennsi øftiR Ūrǿkiu ok Kāðu, brǿðr sīna tvā. [Verði] særði ok sēðrǣddi sāR mannr es ǿði minni þvī.
Auði / Guði Steward hob diesen Stein zum Gedenken an Órókia und Kaða, seine beiden Brüder. [Darf er betrachtet werden] ein Abnormer und ein Zauberer, dieser Mann, der dieses Denkmal zerstört.
Es geht in diesem Kontext einfach darum, dass jemand diesen Runenstein zu einem Denkmal erhoben hat, welches aber geschützt ist, falls jemand auf die Idee kommen sollte, den Stein / das Denkmal zu zerstören.
Das Wort „seðretti“ ist jedoch sehr umstritten bei den Forschern, kann aber – wenn man es will – auf die Magie, auf Seidhr/Seiðr gemünzt werden. Das große Problem ist jedoch wieder, dass die Datierung des Steins relativ jung ist, d. h. der Stein wurde in Dänemark zwischen den Jahren 970 und 1020 erschaffen, sodass auch hier schon wieder die Christianisierung deutlich vorhanden war.
Wieder in anderen literarischen Quellen, die jedoch noch später erschienen, und zwar im 13. Jahrhundert, ist einmal die sogenannte „Laxdæla Saga“ und ein anderes Mal „Frithiofs Saga“ in Bezug auf die Herkunft, den Ursprung des Seidhr/Seiðr genannt. Beide Sagen stammen aus Island, und berichten darüber, dass für das Wirken der verschiedenen Zauber, der magischen Rituale, des Seidhr/Seiðr entsprechende Gerüste aufgebaut wurden, um den jeweiligen Zaubergesang in die Weite zu tragen. Manchmal wird auch davon berichtet, dass die Seiðkona/Seiðkonur (weiblich) bzw. Seiðmaðr/Seiðmenn (männlich) auch auf den Dächern der Häuser standen, um ihre Rituale laut und klar zu verbreiten. So wurden sogenannte Seiðhiall/Seiðhjallr (jene Zaubergerüste) erschaffen, um die Galdr, die Galsterei, den Zaubergesang zu verbreiten. In beiden sagen wird davon berichtet, dass das rituelle Ziel jeweils ein Sturm war, einmal ein Schneesturm und einmal ein Sturm, der ein Schiff vernichten sollte, sodass auch hier wieder Seidhr/Seiðr mit der Schadensmagie assoziiert wird. Dieser erhöhte Sitz, wenn man will, kann man von einem „magischen Hochsitz“ sprechen, taucht in vielen Legenden, Mythen, Geschichten und Sagen auf, sodass man hier schon einen gemeinsamen Nenner finden kann. Natürlich ist dies als Requisite, als dramaturgisches Werkzeug zu verstehen, um eine gewisse Theatralik an den Tag zu legen. Wie gesagt, manchmal wurde auch einfach ein Dach erklommen, sodass man auf der einen Seite gut gesehen wurde, gleichzeitig aber auch weit gehört wurde. Je größer der Zauber, das Ritual, der Ritus organisiert war, desto größer wird auch das jeweilige Zaubergerüst, das Seiðhiall/Seiðhjallr gewesen sein, um hier eine entsprechende Machtposition zu verdeutlichen. Interessant und fragwürdig zugleich wird es, wenn es um die Anzahl der Beteiligten geht. So wird manchmal davon berichtet, dass entweder 30 oder sogar 80 Menschen an den Ritualen beteiligt waren. Nun ja, dies ist sehr fragwürdig, denn ein Ritual wird sehr chaotisch, wenn hier zu viele Protagonisten mitmachen. Wenn man jedoch die ganzen Hilfskräfte mitzählt, die Personen, die für den Aufbau verantwortlich sind, die einfach am Ritual teilnehmen, und mit im Kreis stehen, die möglicherweise Instrumente spielen, die die Zaubergerüste aufgebaut haben, dann kann man sicherlich auf 80 Personen kommen. Dies spiegelt aber definitiv nicht das eigentliche Zentrum der magischen Arbeit wider. Wenn hier fünf Menschen magisch agiert haben, dann war dies schon viel. Es geht hierbei um die Menschen, die zu Recht und in einem vollen Ausmaß den Titel Seiðkona/Seiðkonur (weiblich) bzw. Seiðmaðr/Seiðmenn (männlich) verdient haben. Es ging nicht um irgendwelche Taschenspieler, die sich über Wert verkauft haben. Natürlich kann man dies jetzt nicht mehr nachvollziehen, und man muss den jeweiligen Quellen entweder glauben, oder seine Skepsis behalten. Aus der Praxis für die Praxis kann man sehr klar und deutlich sagen, dass magische Rituale, die sich auf 30 Personen oder auch auf 80 Personen beziehen, meistens so aussehen, dass magische Menschen zusammen im Kreis stehen, dass aber eine gewisse Auswahl die eigentlichen rituellen Handlungen ausführt, und somit auch die Verantwortung tragen.
Da es im Seidhr/Seiðr auch immer wieder um einen Gesang ging, um „Seiðlæti“, ist es ohne Weiteres denkbar, dass am Ritual auch ein A-Capella Chor beteiligt war, um eine entsprechende Trance zu beflügeln, bzw. die Grundvoraussetzungen durch einen Gesang zu erschaffen. Hierbei ist es natürlich klar, wenn wirklich 30 oder 80 Personen beginnen zu singen, dass hier eine besondere Kraft entsteht. Dies findet man auch in aktuellen Ritualen immer wieder. Dennoch muss erwähnt werden, dass bei allen Ritualen, egal ob damals oder heute immer eine Ritualleitung zugegen sein wird, zugegen sein muss! Es wird in diesem Kontext des Seiðlæti und allgemeiner des Seidhr/Seiðr auch immer eine Ritualleitung vorhanden gewesen sein, die vielleicht aus zwei oder drei Personen besteht, meist aber aus einer einzigen Person, die das Ritual entworfen hat, und auch vollkommen kennt und beherrscht. In diesem Kontext wird die Ritualleitung eben alles beherrschen müssen, wozu eben auch der jeweilige Zaubergesang zählt, der in den literarischen Quellen auch als Varðlokkur betitelt wird, sodass hier ein besonderer Zaubergesang, eine besondere Art der Galsterei, des Galdr, gemeint ist, was dann auch allgemeiner als „Seiðlæti“ bezeichnet wird. Leider verschwimmen hier wieder entsprechende Fachvokabeln, sodass in diesem Fall Seidhr/Seiðr auch wieder mit dem Völventum verknüpft wird, sodass die Völva auch wieder einen besonderen Gesang anstimmt, der „Varðlokkur / Varðlokur“ genannt wird. Letztlich ist es auch wieder eine Herbeirufung, eine Anrufung, eine Evokation bzw. möglicherweise auch eine Invokation, also wiederum eine ganz normale magische Handlung. So werden in den Ritualen alle erdenklichen Energien eingeladen. Diese Energien kann man jetzt einfach als die Ahnen bezeichnen, die Hilfsgeister, die Freiseelen, die Guides, die Krafttiere, die Götter/Göttinnen aus Asgard und oder Vanaheim/Wanenheim, die Alben/Elfen, die Svartálfe/Zwerge und alle anderen Wesen, die es im energetischen Spektrum gibt!
Seiðlæti! Varðlokkur / Varðlokur! Seiðkona/Seiðkonur (weiblich) bzw. Seiðmaðr/Seiðmenn (männlich)! Vǫlur / Völva, Gyðjas (weiblich) bzw. Goði (männlich)! Galdrakona (weiblich), Galdramaðr (männlich)! Es ist wie in der heutigen Magie, es gibt zu viele Blickwinkel, die alle richtig und alle falsch sind. Man muss selbst reflektieren, entscheiden und sogar definieren, was der eigene Weg ist, wo das eigene Ziel liegt und wie man dieses Ziel erreichen will. In der damaligen Zeit wurden die Menschen, die mit der Hilfe der Magie eine helfende Hand darstellten meistens offenherzig begrüßt, geehrt und auch mit Speis und Trank versorgt. Hier muss man jedoch wieder einen klaren Schnitt ziehen, denn je stärker die Christianisierung vorangetrieben wurde, desto größer wurde der Argwohn. Allgemein kann man sagen, dass die magischen Menschen, welche Titel sie jetzt auch immer führten, von Ort zu Ort, von Hof zu Hof, von Sippe zu Sippe reisten, um dort ihre Dienste anboten, und jedes Mal mit entsprechenden Ehrbezeugungen empfangen und natürlich auch versorgt wurden.
Doch irgendwann ist letztlich alles vorbei, was in diesem Kontext auch für die Magie des Nordens galt, denn im Jahr 1281 wurde Seidhr/Seiðr regelrecht verboten, da hier drakonische Bestrafungen angedroht wurden, wenn jemand Seidhr/Seiðr praktizieren würde. Zu nennen sind hier die beiden Personen Erik II. Magnusson und der Bischof Árni Þorláksson, die eben auch vor tödlichen Bestrafungen nicht zurückschreckten. Natürlich sieht man hier sehr deutlich, dass die Christianisierung, die in weiten Teilen Skandinaviens auch recht friedlich verlief, zumindest um das Jahr 1000 herum, mit der Zeit doch immer gieriger wurde, sodass die alten Gebräuche und alten Sitten unter Strafe gestellt wurden. Es gab immer mehr Reformen, es gab immer mehr Dekrete, und letztlich war es so, dass die Strafen sehr deutlich auf den Tod deuteten, sodass hierdurch Seidhr/Seiðr mehr und mehr in Vergessenheit geraten ist, bzw. nur noch im Geheimen gemacht wurde, sodass man auch hier keine Aufzeichnungen mehr finden konnte. Ob nun Seidhr/Seiðr oder Hexerei, Fakt ist, die Christianisierung hat die Naturmagie sehr stark durch ihre Drohungen, durch ihre Strafen, durch ihre Verfolgungen beschnitten. So gab es zum Beispiel im Jahr 1326 einen echten Bußkatalog, der vom Bischof Jón Halldórssons ersonnen wurde, und in dem Seidhr/Seiðr klar und deutlich aufgeführt wurde. Zwar blieb die Volksmagie natürlich noch erhalten, sodass auch hier die Talismanmagie, das Gesundbeten, die Heilsrituale und natürlich auch die Kräutermagie in den Volksalltag integriert wurden, doch als dann die Hexenprozesse begannen, kam die nächste Deckelung dieser Naturmagie. Dies ist zwar sehr schade, aber nun einmal Realität, sodass Seidhr/Seiðr erst wieder in den letzten Jahren verstärkt auf den Plan trat - unter anderem durch dieses Buch!
*
*
*
*
*