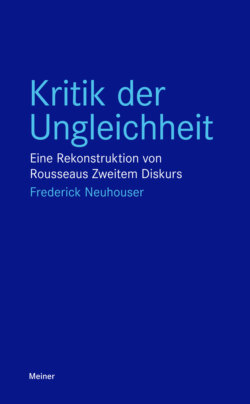Читать книгу Kritik der Ungleichheit - Frederick Neuhouser - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1 Die Natur ist nicht die Quelle sozialer Ungleichheit Natürliche und soziale Ungleichheiten
ОглавлениеIm vorliegenden Kapitel soll zum einen geklärt werden, welche Frage Rousseau zu stellen meint, wenn er den Ursprung der menschlichen Ungleichheit untersucht, und zum anderen, wie der erste negative Teil dessen beschaffen ist, was er als Antwort auf jene Frage betrachtet. Mit anderen Worten: Es sucht, sein Argument für die These zu rekonstruieren, Ungleichheiten – oder genauer die besonderen, ihn vor allem interessierenden Arten von Ungleichheit – hätten ihren Ursprung nicht in der Natur, weder in der menschlichen noch in den natürlichen Bedingungen menschlicher Existenz und auch nicht in einer Kombination von beidem. Am Ende dieses Kapitels wird uns deutlich geworden sein, warum Rousseau sich für berechtigt hält, am Schluss des Zweiten Diskurses zu erklären, er habe gezeigt, dass die Ungleichheit »im Naturzustand fast gleich null war« (DU, 267 / OC III, 162).
Bevor wir sein Argument rekonstruieren, müssen wir uns jedoch darüber klar werden, welches besondere Phänomen Rousseau im Auge hat, wenn er im Zweiten Diskurs von Ungleichheit spricht. Bereits die ersten Seiten des Zweiten Diskurses zeigen deutlich, dass Rousseau nicht nach dem Ursprung der Ungleichheit im Allgemeinen fragt, sondern nur nach dem Ursprung dessen, was er moralische Ungleichheit nennt. Moralische – oder politische – Ungleichheiten unterscheiden sich, wie behauptet, von natürlichen – oder physischen – Ungleichheiten in zwei wichtigen Hinsichten. Erstens sind sie nicht das Produkt der Natur, vielmehr sind sie – um einen Begriff zu verwenden, den Rousseau wiederholt im Zweiten Diskurs anführt – künstlich, was so viel heißt wie: Sie entstehen durch eine Art Konvention, die letztlich auf der Zustimmung der Menschen beruht (DU, 77 / OC III, 131). Zweitens sind moralische Ungleichheiten in dem Sinn sozial, dass sie darin bestehen, dass ein Einzelner – oder eine Gruppe – eine Art von Macht ausübt oder eine Art Vorteil gegenüber einem anderen besitzt. Wie Rousseau erklärt, besteht Ungleichheit nicht im »Unterschied des Alters, der Gesundheit, der Körperkraft und der Eigenschaften des Geistes oder der Seele«, sondern in »den verschiedenen Privilegien, die einige zum Nachteil der andern genießen, wie etwa reicher, angesehener, mächtiger zu sein als andere oder gar Gehorsam von ihnen verlangen zu können« (DU, 77 / OC III, 131). Da »moralisch« für uns nicht mehr dieselbe Bedeutung hat wie für Rousseau10 und »politisch« zu eng ist, um all die Ungleichheiten zu erfassen, die er untersuchen möchte, werde ich von jetzt an den Gegenstand der Untersuchung im Zweiten Diskurs als soziale Ungleichheiten bezeichnen. Ich verwende diesen Ausdruck, um anzuzeigen, dass die zu untersuchenden Ungleichheiten hier sowohl einen sozialen Ursprung haben (in menschlichen »Konventionen«) und ihrer Natur nach sozial sind, insofern sie in den relativen Vorteilen oder Privilegien bestehen, die einige Menschen gegenüber anderen genießen. Der erste der beiden Punkte wird uns den größten Teil dieses Kapitels beschäftigen, doch wenn wir ein deutliches Bild der Arten von Ungleichheiten gewinnen wollen, mit denen sich der Zweite Diskurs beschäftigt, sollten wir auch den zweiten nicht aus dem Blick verlieren.
Es ist entscheidend, sich zu vergegenwärtigen, dass soziale Ungleichheiten für Rousseau stets Privilegien sind – Vorteile, die einige zum Nachteil anderer genießen – und dass seine üblichen Beispiele Unterschiede hinsichtlich des Reichtums, des Ansehens (oder Prestiges), der Macht (über andere) und der Autorität (die Fähigkeit, anderen zu befehlen und Gehorsam einzufordern) sind. Rousseaus Sprache und Beispiele weisen auf einen Punkt hin, dessen Bedeutung später deutlicher werden wird: Bei den Merkmalen, durch die soziale, im Gegensatz zu natürlichen Ungleichheiten gekennzeichnet sind, handelt es sich um stark relative oder stellungsabhängige Eigenschaften und nicht um »absolute« Qualitäten. Die Stärke von Körper, Geist und Charakter – Unterschiede, welche die natürlichen Ungleichheiten ausmachen – sind Eigenschaften, die Individuen haben können und zu haben wünschen können, ohne sich darum zu kümmern, ob andere weniger, mehr oder auch nur dieselbe Menge davon haben. Beispielsweise ist das Ausmaß der Klugheit einer Person unabhängig davon, wie klug ihre Mitmenschen sind, und die Wünschbarkeit ihrer Klugheit hängt nicht davon ab, ob andere sie besitzen oder nicht. Soziale Ungleichheiten bestehen demgegenüber aus Ungleichgewichten in Qualitäten, bei denen der Faktor Privileg (gegenüber anderen) eine entscheidende Rolle spielt. Man sieht dies leicht im Fall der Autorität: Von jemandem lässt sich nur dann sagen, er habe Autorität, wenn es einen anderen gibt, der ihm gehorchen muss. Autorität ist immer Autorität gegenüber einem anderen, der – in dieser besonderen Hinsicht – keine Autorität hat und daher – in dieser besonderen Hinsicht – »unter« einem anderen steht. Etwas Ähnliches gilt für Macht, jedenfalls solange wir darunter mehr als physische oder geistige Stärke verstehen, denn Ungleichgewichte in dieser zählen zu den natürlichen Ungleichheiten. Ein sozial mächtiges Individuum – eines, das imstande ist, andere so zu manipulieren oder zu zwingen, dass sie seine Wünsche und Ziele ausführen, ist nur insofern mächtig, als es weniger mächtige Individuen gibt, die als Werkzeug seines Willens herhalten müssen. Die Relativität (oder Stellungsabhängigkeit) des Ansehens ist für Rousseaus Genealogie der Ungleichheit von zentraler Bedeutung und wird weiter unten ausführlich erörtert werden. Und schließlich ist das Privileg gegenüber anderen selbst für den Reichtum entscheidend, zumindest wenn wir Adam Smiths berühmter Darlegung über das »wahre Maß« des Reichtums »nach der Arbeitsteilung« folgen: Ein Mensch »ist arm oder reich, je nach der Menge der Arbeit, über die er verfügen oder deren Kauf er sich leisten kann.«11 In all diesen Fällen lässt sich der Besitz eines Gutes – Reichtum, Ansehen, Macht oder Autorität – nicht davon trennen, dass jemand benachteiligt ist, weil ein anderer es besitzt. Die Güter, aus denen der Stoff der sozialen Ungleichheiten gemacht ist, sind solche, die sich nur »zum Nachteil« eines anderen genießen lassen.
Festzuhalten ist, dass uns Rousseau durch die Definition der ihn beschäftigenden Art von Ungleichheit bereits etwas Wichtiges darüber mitgeteilt hat, wie er die Frage nach deren Ursprung zu beantworten beabsichtigt: Soziale Ungleichheit hat ihren Ursprung nicht in der Natur, wohl aber in den Meinungen und Praktiken, die aus den Tätigkeiten der Menschen entstehen: »Sie ist durch die Zustimmung der Menschen gesetzt oder wenigstens autorisiert worden« (DU, 77 / OC III, 131).12 Und mehr noch: Er hat deutlich gemacht, dass die Natur, so wie er sie begreift, den Gegensatz zum Künstlichen, zur Konvention, Meinung und Zustimmung bildet. Es lohnt sich, ein wenig bei dieser verblüffenden These zu verweilen, denn versteht man sie richtig, enthüllt sich weitgehend, wie Rousseau die Ungleichheit auffasst, deren Ursprung und Legitimität der Zweite Diskurs untersucht. Das Verblüffende dieser These liegt in ihrer Andeutung, die soziale Ungleichheit hänge von der Zustimmung der Menschen ab, vermutlich von der Zustimmung eines jeden, der zu anderen in der Beziehung der Ungleichheit steht. Auf den ersten Blick scheint die These falsch, ja widersinnig zu sein, dass soziale Ungleichheiten, und sei es nur zum Teil, deshalb existierten, weil die Besitzlosen, die Unterdrückten und die Verachteten dem Reichtum, der Macht und dem Ansehen derjenigen zugestimmt haben, die in der sozialen Hierarchie über ihnen stehen. An dieser Stelle ist jedoch entscheidend, welche Worte Rousseau genau verwendet: Die soziale Ungleichheit, heißt es, ist durch die Zustimmung der Menschen »gesetzt oder wenigstens autorisiert worden«. Dass Rousseau die Rede darüber, wie Ungleichheiten entstehen, wie sie zuerst gesetzt werden, durch die Rede darüber ersetzt, wie sie autorisiert werden, sollte uns auf die wichtige Tatsache aufmerksam machen, dass sich der Zweite Diskurs weniger mit dem realen historischen Ursprung der Ungleichheit befasst, als es zunächst den Anschein hat. In Wirklichkeit beschäftigt Rousseau in dieser Aussage vor allem, wie und warum Ungleichheiten, sind sie erst einmal entstanden, sich hartnäckig behaupten. Rousseaus grundlegende These besagt daher nicht, dass soziale Ungleichheiten zuerst durch eine Übereinkunft zwischen den Menschen in die Welt gekommen sind, sie besagt vielmehr, dass, so es sie erst einmal gibt, ihr dauerhafter Bestand von einer Art Zustimmung abhängt, die er als Autorisieren bezeichnet. Dass das Autorisieren für die Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheiten entscheidend ist, beinhaltet, dass es sich bei diesen, im Gegensatz zu jenen, die den »physischen« oder nicht-»moralischen« aus dem Reich der Natur angehören, wesentlich um normative Phänomene handelt. Soziale Ungleichheiten sind in dem Sinn normativ, dass sie in menschliche Praktiken eingebettet sind, deren Bestehen von der Überzeugung ihrer Teilnehmer abhängt, solche Praktiken seien gut, legitim oder natürlich, und das wiederum schließt ein, dass wir für die sozialen Ungleichheiten in einer Weise verantwortlich sind, wie dies nicht auf natürliche Ungleichheiten zutrifft – schließlich sind sie durch unser eigenes Tun bedingt. Zu sagen, soziale Ungleichheiten sind durch Zustimmung autorisiert, bedeutet freilich nicht, dass sie in Wahrheit legitim oder verbindlich sind. Es bedeutet lediglich, dass sie von denen, die ihnen unterworfen sind, für legitim gehalten werden und dass dieses »Autorisieren« eine bedeutsame Rolle für ihren Fortbestand spielt. (Somit ist festzuhalten, dass »Autorisieren« hier einen von der Bedeutung, die es in der zweiten der Hauptfragen des Zweiten Diskurses hat, unterschiedenen Sinn aufweist. Wenn Rousseau dort fragt, ob die soziale Ungleichheit durch das Naturgesetz autorisiert ist, dann fragt er nicht, ob Individuen an ihre Legitimität glauben, sondern ob, ungeachtet der tatsächlichen Meinungen der Menschen, das Naturgesetz sie tatsächlich rechtfertigt.)
Dieser Punkt rückt einen wichtigen Sinn ins Licht, dem zufolge soziale Ungleichheiten für Rousseau eher moralisch als physisch sind: Die Praktiken und Institutionen, welche soziale Ungleichheiten stützen, verdanken ihren Bestand größtenteils nicht der Gewalt, sondern der (stillschweigenden oder ausdrücklichen) Übereinkunft, dass sie gerechtfertigt sind. Wenn Arbeiter in kapitalistischen Unternehmen Tag ein, Tag aus ihre acht oder mehr Stunden arbeiten, ohne das Eigentum ihrer Arbeitgeber zu sabotieren oder es sich selbst anzueignen, dann tun sie das typischerweise in erster Linie deshalb nicht, weil sie fürchten, die Staatsmacht würde die bestehenden Eigentumsrechte durchsetzen – obwohl man auch nicht vergessen darf, dass diese Macht immer im Hintergrund steht, bereit, die Wenigen zu vernichten, die es wagen könnten, diese Rechte zu verletzen. Sie tun es stattdessen nicht, weil sie, möglicherweise unhinterfragt, auf irgendeiner Ebene die Legitimität oder Natürlichkeit der gesellschaftlichen Einrichtungen billigen, die sie zwingen, für ihren Lebensunterhalt zu schuften, während andere wohlhabend genug sind, ohne zu arbeiten leben zu können und sich an den Früchten der Arbeit anderer zu bereichern. Ebenso beruhen die asymmetrischen Machtbeziehungen zwischen Männern und Frauen selten ausschließlich auf der überlegenen Körperkraft der Männer, sie beruhen auch darauf, dass diejenigen, die an diesen Beziehungen teilhaben, an die Natürlichkeit oder Angemessenheit patriarchalischer Herrschaft glauben – darunter viele Frauen. Diese Einsicht ist eng mit einer, wie Rousseau meint, allgemeinen Wahrheit über das Sozialleben der Menschen verbunden: Institutionen, die allein von brutaler, physischer Gewalt oder der Drohung damit abhängen, während keiner von denjenigen, die an ihnen teilhaben, von ihrer Legitimität überzeugt ist, wären höchst instabil und ineffizient, und das nicht zuletzt deshalb, weil ein großer Teil der gesellschaftlichen Ressourcen darauf verwendet werden müsste, Zwangsmechanismen so aufrechtzuerhalten, dass die Mitglieder der Gesellschaft sie für allgegenwärtig und unentrinnbar halten.
Die Zustimmung, mittels deren die meisten sozialen Ungleichheiten autorisiert werden, ist daher nicht die für Verträge typische Zustimmung, bei der die vertragsschließenden Parteien die Bedingungen ihrer Beziehung aushandeln und ihnen ausdrücklich zustimmen, bevor sie in diese Beziehung eintreten. Die Zustimmung, die Ungleichheiten gründet, beruht vielmehr darauf, dass mehr oder weniger bewusste Überzeugungen über die Angemessenheit bestimmter Praktiken und Institutionen gehegt werden. Der Grund dafür, dass Rousseau dies für einen Typ von Zustimmung hält, liegt darin, dass, wie wir unten sehen werden, Überzeugungen oder »Meinungen« letzten Endes auf unserer Freiheit beruhen. Etwas zu glauben verlangt, dass wir aktiv der Aussage zustimmen, das-und-das sei der Fall. Vielleicht wird es deutlicher, wenn man sagt, eine Überzeugung zu haben, beispielsweise die, dass Männer von Natur aus dazu geeignet sind, über Frauen zu herrschen, beinhaltet eine Art von Verantwortung für das Geglaubte: Welche Überzeugungen wir haben, und sei es auch nur vage und stillschweigend, liegt letztlich in dem Sinn bei uns, dass es in unserer Macht als denkende Subjekte steht, über ihre Angemessenheit nachzudenken und sie dann im Lichte dieser Überlegungen fallenzulassen oder zu revidieren – sie den Belegen anzupassen, die unserer Ansicht nach für oder gegen sie sprechen. Genau darum sind soziale Ungleichheiten künstlich. Sie gehören zu der Sorte von Dingen, deren Existenz die aktive Teilnahme der von ihnen Betroffenen verlangt. Sie sind, wenn auch nicht eben absichtlich geschaffen, zumindest in ihrem Bestand auf die Zustimmung ihrer Teilnehmer angewiesen, einschließlich derjenigen, die von ihnen benachteiligt werden.
Während es hart und unfair erscheinen mag, die Unterdrückten und Benachteiligten, und sei es nur zum Teil, für ihre Lage selbst verantwortlich zu machen, beinhaltet Rousseaus Ansicht auch, dass die Macht, diesen Zustand zu ändern, zumindest teilweise in ihrer Hand liegt. Wäre soziale Ungleichheit nicht etwas, an dessen Bestand die Benachteiligten mitwirken, wäre es viel schwieriger zu erkennen, wie sie diese Situation je überwinden können. Zudem schwingt in Rousseaus Auffassung mit, dass die Philosophie, fasst man sie weit, eine wichtige Rolle beim fortschrittlichen sozialen Wandel spielt. Denn eine Philosophie, die unseren Glauben an die Legitimität bestimmter Ungleichheiten zurückweist, untergräbt damit zum Teil die Grundlagen, auf denen diese Ungleichheiten beruhen. Und eben das ist eines der Hauptziele des Zweiten Diskurses bei seiner Untersuchung über »den Ursprung und die Grundlagen (fondements) der Ungleichheit«.13
Welche Bedeutung die Meinungsabhängigkeit der sozialen Ungleichheit für Rousseaus Unterfangen im Zweiten Diskurs hat, ist unmöglich zu überschätzen. So hat sie zum Beispiel tiefgreifende Folgen für das, was er meint finden zu müssen, um den Ursprung der sozialen Ungleichheit aufzudecken. Wenn Rousseau sich selbst die Frage stellt: »Um was handelt es sich also näher in dieser Abhandlung?«, dann gibt er die potentiell irreführende Antwort: »Um die Kennzeichnung des Augenblicks im Verlauf der Entwicklung der Dinge, in dem das Recht die Gewalt ablöste und mithin die Natur dem Gesetz unterworfen wurde« (DU, 78 f. / OC III, 132).14 Der entscheidende Gegensatz in dieser Antwort ist der zwischen reinen Naturgeschöpfen – für die Gewalt die Regel ist – einerseits und moralisch oder nach Normen sich richtenden Geschöpfen andererseits. Diese werden von Recht und Gesetz regiert oder, besser gesagt, vom Gesetz und ihren Vorstellungen davon, was Recht ist.15 Dieser dunklen, aber wichtigen Aussage liegt im Kern folgende These zugrunde: Der Schlüssel zum Verständnis der Frage, woher die soziale Ungleichheit kommt, findet sich in der Erklärung, wie es möglich ist, dass Meinungen über das Recht, begriffen als Gegensatz zur reinen Natur, eine so zentrale Rolle in den menschlichen Angelegenheiten annehmen können. Wenn menschliche Gesellschaften sich typischerweise durch soziale Ungleichheiten allerlei Art auszeichnen – die ihrerseits von den Meinungen oder der Zustimmung ihrer Glieder abhängen –, dann müssen Menschen solche Geschöpfe sein, die ihre Meinungen (ihre normativen Überzeugungen davon, was an den Dingen gut und rechtmäßig ist) und nicht ihre bloße Natur über ihr Verhalten und ihre Lebensweise bestimmen lassen. Rousseaus Frage über den Ursprung der Ungleichheit kann daher folgendermaßen neu formuliert werden: Wie müssen Menschen beschaffen sein, wenn auf Meinungen beruhende soziale Ungleichheiten einen so herausragenden Stellenwert in ihrem Leben annehmen sollen? Unter der Annahme, dass wir ihn bisher richtig verstanden haben, wird es nicht weiter erstaunen, dass Rousseau glaubt, seine Antwort auf die Frage über den Ursprung der sozialen Ungleichheit hänge davon ab, einige der grundlegenden Eigenschaften der Menschen zutage zu fördern, die sowohl durch die Unterscheidung zwischen dem Menschlichen und dem rein Natürlichen gekennzeichnet sind als auch die Fähigkeit von Meinungen erklären, die menschlichen Angelegenheiten zu regeln. Im zweiten Teil des Zweiten Diskurses, dort, wo die Naturgeschöpfe des ersten Teils uns zum ersten Mal als echt menschliche Wesen begegnen, wird Rousseau in seine Darstellung genau einen solchen Faktor einführen – die Leidenschaft des amour propre – und sie liefert, wie wir mittlerweile erwarten sollten, das Kernstück seiner Beantwortung der Frage, woher die soziale Ungleichheit stammt.
Und schlussendlich hilft uns das Verständnis der Rousseau’schen Unterscheidung zwischen natürlichen und sozialen Ungleichheiten deutlich zu machen, warum er seine Aufmerksamkeit im Zweiten Diskurs auf diese beschränkt. Der offensichtlichste Grund dafür ist der, dass die beiden Hauptfragen des Zweiten Diskurses sich prompt beantworten lassen, wenn sie natürliche Ungleichheiten in den Blick nehmen: Sie entspringen selbstverständlich der Natur (DU, 77/67, OC III, 131) und sind daher durch das Gesetz der Natur autorisiert oder zumindest nicht durch es verurteilt. Vermutlich ist es präziser zu sagen, im Fall der natürlichen Ungleichheiten erhebt sich erst gar nicht die Frage danach, was sie autorisiert – ob sie legitim oder zulässig sind. Es scheint wahrscheinlich, dass Rousseau glaubt, es sei sinnvoll, die zweite, die normative Frage nur im Hinblick auf künstliche Phänomene zu stellen, auf solche, die von menschlichem Handeln (und menschlicher Freiheit) in dem oben formulierten Sinn abhängen. Im Falle natürlicher Phänomene ergeben sich keine Fragen der Legitimität oder der Kritik. Es mag bedauerlich sein, dass die Natur den einen mehr Körperkraft, eine schönere Stimme oder ein liebenswürdigeres Naturell verliehen hat als den anderen, doch sind diese Unterschiede – im Gegensatz zu dem, was die menschlichen Gesellschaften aus ihnen machen – an sich nicht ungerecht, illegitim oder ein geeigneter Gegenstand der moralischen Kritik. Für Rousseau ist das Wirken der Natur (das heißt Gottes) kein passender Adressat für eine normative Bewertung und Kritik, wohl aber ist es das unsrige – und das heißt, die Zustände, für die wir verantwortlich sind. Man darf jedoch keinesfalls das Ausmaß überschätzen, in dem Rousseau zufolge die Wirkungen der Natur dem Geltungsbereich normativer Kritik entrückt sind. Die bloße Tatsache, dass jemand blind geboren ist, während andere mit perfektem Sehsinn auf die Welt kommen, ist für Rousseau keine Form der Ungerechtigkeit oder irgendeine andere Art moralischen Gebrechens. Wie dieser natürliche Unterschied aber letzten Endes das Leben der Betroffenen beeinträchtigt, ist nicht bloß eine Folge der natürlichen Umstände. Da soziale Praktiken und Institutionen beträchtlich zur Ausgestaltung der Folgen beitragen, die natürliche Ungleichheiten für das Leben der von ihnen Benachteiligten haben, gehen diese Folgen in nicht geringem Maße auf unser eigenes Handeln zurück – wir und nicht die Natur sind für sie verantwortlich – und daher sind sie ein angemessenes Thema für die normative Frage des Zweiten Diskurses. Natürliche Blindheit ist nicht an sich eine Ungerechtigkeit, doch der Umstand, dass Blinde in einigen Gesellschaften kaum Zugang zu Bildungseinrichtungen oder öffentlichen Verkehrsmitteln haben, kann in der Tat ungerecht (und ein legitimer Gegenstand der Kritik) sein, denn dabei handelt es sich um soziale, nicht bloß natürliche Folgen von Blindheit, und die zu ändern, steht in unserer Macht.
Damit ist ein weiterer Grund genannt, warum der Zweite Diskurs sich ausschließlich mit sozialen Ungleichheiten beschäftigt: Es gehört zu Rousseaus grundlegenden Überzeugungen – für die der Zweite Diskurs eine Art Argument zu liefern beabsichtigt –, dass natürliche Ungleichheiten, obgleich sie real und von einiger Bedeutung sind, sich, verglichen mit den ungleich gravierenderen Wirkungen künstlicher Ungleichheiten, in den menschlichen Angelegenheiten kaum niederschlagen. Wenn ein Beobachter der modernen Gesellschaft sich aus Betroffenheit wegen der ihn umgebenden Ungleichheiten beschließt, den Ursprung und die Rechtfertigung der Ungleichheit zu untersuchen, dann sind die Phänomene, die ihn sehr wahrscheinlich zu seiner Untersuchung anregen, weitaus mehr das Ergebnis sozialer als natürlicher Umstände. Wie Rousseau schon ganz am Anfang des Zweiten Diskurses zeigt, sieht man, sobald man über die Sache nachdenkt, ganz schnell, dass die großen, in modernen Gesellschaften so augenfälligen Diskrepanzen in Macht, Reichtum, Ansehen und Autorität nicht unmittelbare Folgen von Unterschieden in Alter, Körperkraft, angeborener Begabung oder natürlicher Intelligenz sind. Dass Reichtum, Ansehen, Macht und Autorität schlicht die natürliche Überlegenheit derjenigen spiegeln, die darüber verfügen, »taugt vielleicht dazu, um unter Sklaven, wenn ihre Herren zuhören, verhandelt zu werden«, für diejenigen aber, die nach der Wahrheit über die Ungleichheit zwischen den Menschen suchen, hat eine solche Hypothese wenig Überzeugungskraft (DU, 77/69, OC III, 132). Dass soziale Ungleichheiten sich nicht einfach auf natürliche Unterschiede zurückführen lassen, stellt selbstverständlich keinen Beweis ihrer Illegitimität dar. Es beinhaltet jedoch, dass die meisten Ungleichheiten, auf die wir in bestehenden Gesellschaften stoßen, nicht bloß vorgegebene, natürliche oder notwendige Phänomene sind, sondern stattdessen zumindest teilweise den sozialen Umständen geschuldet sind, die Menschen aktiv aufrechterhalten und für die sie aus diesem Grund verantwortlich sind; oder anders gesagt, es zeigt nicht, dass soziale Ungleichheiten samt und sonders illegitim sind, allerdings sind sie, bescheidener ausgedrückt, ein geeigneter Gegenstand für eine moralische Bewertung und Kritik.
Mit diesen Überlegungen ist bereits ein Anfang in der Rekonstruktion von Rousseaus Antwort auf die erste Frage des Zweiten Diskurses gemacht: Woher kommen die sozialen Ungleichheiten? Denn der erste Schritt in seiner Argumentation, dass sie nicht natürlichen Ursprungs sind, besteht in genau dieser These: Die weit verbreitete Existenz sozialer Ungleichheiten lässt sich nicht als eine unmittelbare oder notwendige Folge natürlicher Ungleichheiten erklären; und dementsprechend fallen natürliche Ungleichheiten so gut wie nicht ins Gewicht, wenn es um die Festlegung geht, welche Individuen in einer bestimmten Gesellschaft in den Genuss der Vorteile von Reichtum, Ansehen, Macht und Autorität gelangen. Mit anderen Worten: Angeborene Unterschiede zwischen den Menschen beinhalten – Aristoteles und Platon zum Trotz – nicht die Notwendigkeit oder Rechtmäßigkeit sozialer Hierarchien im Allgemeinen, noch ermächtigen sie die Zuschreibung von Vorteilen, da sie »in Übereinstimmung mit der Natur« sind. Zudem beharrt Rousseau darauf, dass, selbst wenn sich herausstellte, dass natürliche Ungleichheiten eine gewisse Funktion bei der Bestimmung der relativen Stellungen von Individuen in der Gesellschaft einnehmen, sie es nicht an sich tun würden, unabhängig von einem Schwarm sozialer Praktiken und Institutionen – beispielsweise Eigentumsgesetze, Ehrenkodizes oder Konventionen über die Einsetzung der Obrigkeit –, die natürlichen Unterschieden eine Bedeutung verleihen und sie auf eine Weise kultivieren, dass ihre Folgen weit über die hinaus gehen, die sie »natürlicherweise«, ohne solche Praktiken und Institutionen, gehabt hätten. Da die Praktiken und Institutionen, die als Mittler für die Auswirkung der natürlichen Ungleichheiten auf die gesellschaftliche Stellung auftreten, veränderlich sind und von der menschlichen Freiheit abhängen, sind soziale Ungleichheiten von der Natur allenfalls unterbestimmt. Welche Formen von Ungleichheit in einer bestimmten Gesellschaften herrschen und wie weit sie sich erstrecken, das ist keine Sache natürlicher (und somit ewiger) Tatsachen, sondern eine der sozialen (und somit veränderlichen) Umstände, die, weil menschliches Zutun sie konserviert, in unser Hand liegen und so ein möglicher Gegenstand sowohl der Bewertung als auch der Reform sind.
An Rousseaus Zurückweisung der Natur als Ursprung sozialer Ungleichheiten ist jedoch noch mehr dran, und zu erkennen, worin dieses Mehr besteht, enthüllt viel über das Wesen des genealogischen Unterfangens im Zweiten Diskurs und seines zentralen Begriffs ›Ursprung‹. Unmittelbar im Anschluss an seine Feststellung, soziale Ungleichheiten ließen sich nicht auf natürliche Ungleichheiten zurückführen, wirft Rousseau eine weitere Frage bezüglich ihres Ursprungs in der Natur auf, ein sicherer Hinweis darauf, dass seine erste Behauptung seine These, soziale Ungleichheiten seien nicht-natürlichen Ursprungs, nicht erschöpft. Diese weitere Frage lautet, ob soziale Ungleichheiten nicht ihren Ursprung, oder wie Rousseau manchmal sagt, ihre Quelle (DU, 63/43, OC III, 122), in der Natur des Menschen haben. Ein Grund dafür, die Rede von der Quelle der Ungleichheit der über ihren Ursprung vorzuziehen, liegt darin, dass der erste Ausdruck den üblichen, aber irregeleiteten Eindruck abwehrt, Rousseau beabsichtige, eine in erster Linie historische Frage darüber zu stellen, wie die Ungleichheit tatsächlich in die Welt kam. Formuliert man seine Frage so, dass von der Quelle der Ungleichheit gesprochen wird, dann verspricht der Zweite Diskurs das Woher der Ungleichheit viel allgemeiner zu untersuchen, als eine rein historische Darlegung es tun könnte. Fragt man zum Beispiel nach der Quelle des Hudson oder der Quelle der Armut in den USA, dann erwartet man normalerweise nicht, eine historische Erzählung präsentiert zu bekommen, wohl aber im ersten Fall eine synchrone Darstellung der verschiedenen Nebenflüsse, deren Wasser gemeinsam den Hudson bilden, und im zweiten Fall eine Auflistung von verschiedenen Faktoren – Verlegung von Jobs in Länder mit billigerer Arbeitskraft, Gesetze, welche die Bildung von Gewerkschaften erschweren usw. Diese sollen freilich nicht erklären, wie die Armut in den USA anfänglich entstanden ist, sondern welche bestehenden Kräfte zu ihrer Fortdauer beitragen. Tatsächlich hat Rousseau diese Art von Darlegung im Blick, wenn er den Ursprung der Ungleichheit untersucht. Statt zu fragen wann, wo und warum die soziale Ungleichheit zuerst in der menschlichen Gesellschaft aufgetreten ist, möchte er wissen, welche der verschiedenen Aspekte der menschlichen Daseinsbedingungen im Allgemeinen – unsere biologische Natur, eine erworbene psychische Verfasstheit, Geschichte, zufällige soziale Umstände – zusammenwirken, um zu erklären, warum es Ungleichheit gibt und warum sie in den meisten menschlichen Gesellschaften so weit verbreitet ist.
Nachdem er festgestellt hat, dass angeborene Unterschiede unter den Individuen wenig, wenn überhaupt zu den sozialen Ungleichheiten beitragen, ist es Rousseaus nächstes Anliegen, sehr viel detaillierter zu zeigen, dass sie ihre Quelle auch nicht in der Natur des Menschen oder der allgemeiner begriffenen Natur haben. Bereits im Vorwort, noch bevor er die Fragen, die anzugehen er vorhat, richtig definiert hat, macht Rousseau deutlich, dass es für das Gelingen des Zweiten Diskurses entscheidend ist, eine präzise Vorstellung von der menschlichen Natur zu entwickeln: »Denn wie soll man die Quelle der Ungleichheit unter den Menschen kennen, wenn man nicht zuvor die Menschen selbst kennt?« (DU, 63/43, OC III, 122). Obwohl es von Anfang an recht offensichtlich ist, dass er die soziale Ungleichheit nicht als Folge der Natur des Menschen zu erklären beabsichtigt, ist es weniger deutlich, worauf seine Position hinausläuft. Da Rousseaus Antwort auf die Frage, ob die soziale Ungleichheit ihre Quelle in der Natur des Menschen hat, sich als sehr viel verwickelter entpuppt, als es zunächst den Anschein hat, müssen wir, um das Argument des Zweiten Diskurses zu verstehen, eine beträchtliche Anstrengung unternehmen, denn nur so werden wir herausfinden, worum es ihm bei dieser Frage geht und warum er sie negativ beantwortet.