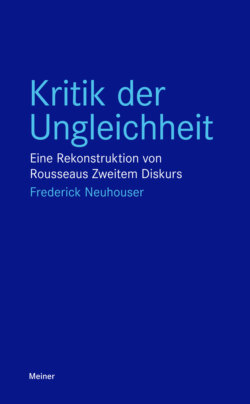Читать книгу Kritik der Ungleichheit - Frederick Neuhouser - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Quelle der sozialen Ungleichheiten liegt nicht in der Natur des Menschen
ОглавлениеKommen wir nun auf die Hauptthese zurück, die der ursprüngliche Naturzustand zusammen mit seinem Bild von der Natur des Menschen begründen soll, dass nämlich soziale Ungleichheiten ihre Quelle nicht in der Natur haben. Worauf ich oben bereits hingewiesen habe, besteht ein Teil dieser These in der Behauptung, die ursprüngliche Natur des Menschen allein liefere keine psychologischen Anreize, mit denen sich erklären ließe, warum Menschen ein Motiv haben, die Ungleichheiten anzustreben, die sie tatsächlich schaffen. Anders ausgedrückt: Keine der beiden Arten von Motiven, die sich aus den ursprünglichen Anlagen des Menschen ergeben, macht ihn geneigt oder gibt ihm Gründe, Ungleichheiten anzustreben – es sei denn sehr kurzfristige Vorteile, die unter bestimmten Umständen wünschenswert sind, weil sie einem anderen Zweck dienen. Im Falle von Mitleid liegt das auf der Hand: Obwohl es denkbar ist, dass ein kurzfristiger Vorteil unter ungewöhnlichen Umständen dem Zweck nützen könnte, das Leiden anderer zu lindern – beispielsweise wenn ein Angreifer, der einer schwachen dritten Partei Leid zufügen möchte, über große Körperkraft verfügt –, gibt es keinen Grund zu meinen, dass Empfänglichkeit für den Schmerz anderer den Naturmenschen systematisch dazu motivieren sollte, Ungleichheiten anzustreben, sei es mit Blick auf ihr eigenes Wohl oder als Mittel für den charakteristischen Zweck des Mitleids, Schmerzen anderer zu verringern.47 Wo es um den amour de soi-même geht, liegt der Fall komplizierter. Rousseau behauptet jedoch auch hier, dass es im rein natürlichen Eigeninteresse nichts gibt, was Menschen dazu bewegen könnte, um ihrer selbst willen Ungleichheiten zu wünschen: Bei den vom amour de soi-même erstrebten Gütern – etwa Nahrung, Unterkunft und Schlaf – handelt es sich ausnahmslos um Güter, die nicht-relativ sind bzw. nicht von der jeweiligen Stellung der Menschen zueinander abhängen, und daher bestehen sie weder in Vorteilen gegenüber anderen, noch werden sie dadurch bestimmt. Wie gut ich nachts schlafe, befriedigt mein eigenes Ruhebedürfnis und ist ganz und gar davon unabhängig, wie gut oder schlecht die Menschen um mich herum ihre Nacht verbracht haben. Der bloße Wunsch nach geruhsamem Schlaf gibt mir keinen Grund an die Hand, besser als andere schlafen zu wollen.
Aber könnte der amour de soi-même nicht Wesen, die ihn besitzen, mit einem ständigen Anreiz ausstatten, Ungleichheiten als Mittel zu ihren Zwecken zu erstreben? Viele Philosophen neigen zur Bejahung dieser Frage – Hobbes ist dafür das berühmteste Beispiel und sicherlich der wichtigste Gesprächspartner, an den Rousseau hier denkt48 – und auch der gesunde Menschenverstand wäre schnell mit einem ›Ja‹ dabei, denn es fällt (uns) leicht, sich plausible Szenarien vorzustellen, in denen man das, was man wünscht oder benötigt, nur bekommt, wenn man andere übertrumpft. Dennoch ist es wichtig, sich über die Hintergrundannahmen, die in solche Szenarien einfließen, im Klaren zu sein. Eine Situation, auf die Philosophen oft hinweisen, wenn sie über Selbstliebe im Allgemeinen nachdenken, ist die, in der mehrere eigennützigen Individuen vor der Aufgabe stehen, eine Torte in Stücke zu schneiden und sie unter sich zu verteilen. Ihr Eigennutz wird jeden Einzelnen dazu bewegen, sich selbst das größte Stück zuzuschanzen.49 In Anbetracht dieser beiden Annahmen – der Wunsch, seinen Anteil schrankenlos zu vergrößern, und die festgelegte Menge des zu verteilenden Guts – erkennt man leicht, wie Menschen veranlasst werden können, nach Bedingungen der Ungleichheit zu streben. Was Rousseau bezweckt, wenn er ein so dürftiges Bild der ursprünglichen Natur des Menschen malt, lässt sich jedoch unter anderem so verstehen, dass er damit die Naturgegebenheit dieser vorausgesetzten Bedingungen anzweifelt. Bezogen auf die erste würde Rousseau entgegnen, dass nichts am rein natürlichen amour de soi-même den Wunsch zu erklären vermag, ein gewünschtes oder benötigtes Gut zu maximieren – im Gegensatz dazu, lediglich hinreichend davon zu erhalten, um ein bestimmtes Bedürfnis oder einen bestimmten Drang zu befriedigen. Anders gesagt: Obwohl er in den uns bekannten Gesellschaften sehr weit verbreitet ist, ist der Wunsch, etwas zu maximieren – insbesondere der Wunsch, unbegrenzt zu maximieren –, kein Wunsch, den die Natur uns einpflanzt, und das heißt, er ist nicht in den Zwecken der Selbsterhaltung und des rein animalischen Wohlergehens allein enthalten. Stattdessen beruht der Wunsch, so viel wie möglich für sich rauszuschlagen, ebenso auf Meinungen darüber, worin das eigene Wohlergehen besteht, wie auch auf erworbenen Gewohnheiten und Anlagen, die jedoch nach Rousseaus Ansicht nicht dem Reich der Natur angehören, sondern dem des Künstlichen, Veränderlichen und gesellschaftlich Geformten, also dem, was das Produkt menschlicher Freiheit ist. Die allein dem natürlichen amour de soi-même entspringenden Begierden und Bedürfnisse besitzen einen natürlichen und verhältnismäßig leicht zu erreichenden Sättigungspunkt, jenseits dessen sie aufhören, Forderungen an ihren Träger zu stellen, natürlich nur so lange, bis die normalen Naturkreisläufe sie wieder entzünden. Die (uns) vertrauten Phänomene der Begierden, die die natürlichen Bedürfnisse übersteigen oder nicht über einen Sättigungspunkt verfügen, entspringen in Rousseaus Augen eher den kontingenten sozialen und historischen Umständen als der Natur, und sich Klarheit darüber zu verschaffen, unter welchen Umständen sie auftreten, ist eine der Hauptaufgaben des 2. Teils.
Nun könnte jemand meinen, um aus dem amour de soi-même einen Anreiz zur Herstellung von Ungleichheit abzuleiten, brauche man nur die Beispiele auszutauschen und sich auf das nicht weniger vertraute Szenario zu konzentrieren, in dem etwa vier Schiffbrüchige in einem Rettungsboot treiben, das nur für drei gemacht ist. Damit hätten wir ein einleuchtendes Szenario, das, indem es zeigt, wie der amour de soi-même den Wunsch erzeugen kann, gegenüber anderen im Vorteil zu sein, aus der Natur selbst eine Anlage zur Herstellung von Ungleichheit erzeugt. Insofern es vermeidet, einen künstlichen Impuls zur Maximierung der eigenen Güter zu postulieren und den Individuen lediglich ein dem natürlichen amour de soi-même innewohnendes Ziel, die Selbsterhaltung, setzt, kommt dieses zweite Beispiel der Erfüllung seines Zwecks näher als das erste. Man muss freilich festhalten, dass dieses Beispiel nur überzeugt, weil es Knappheit als Annahme in das vorgestellte Szenario hineinnimmt: Der Umgebung, in der sich die Individuen wiederfinden, fehlt es laut Hypothese an hinreichenden Ressourcen, um die biologischen Bedürfnisse aller zu befriedigen. Rousseau leugnet ja nicht, dass solch ein Szenario selbst in einer von allen künstlichen Umständen, die durch die Überzeugungen und den Willen der Menschen ins Spiel kommen, vollständig unberührten Welt möglich ist. Daher ist es nicht falsch zu sagen, dass unter bestimmten besonderen Umständen der Wunsch, gegenüber anderen im Vorteil zu sein – der Trieb, Ungleichheiten zu schaffen –, eine mögliche Folge des rein natürlichen amour de soi-même ist. Gleichwohl ist es bedeutsam, dass die Individuen sich Ungleichheit nur zweckgebunden wünschen – zur Sicherung ihres eigenen Überlebens – und dass dieser Zweck, wie alle anderen Zwecke des amour de soi-même, dem erfolgreichen oder erfolglosen Erreichen desselben Zwecks anderer letztlich gleichgültig gegenübersteht. Selbst wenn in diesem Szenarium das Erreichen des eigenen Zwecks danach verlangt, sich einen Vorteil über einen anderen zu verschaffen, über den, der in diesem Rettungsboot einer zu viel ist, so gehört dieser Vorteil nicht wesentlich dem Endzweck des amour de soi-même, dem Überleben, an. Begehrt wird er nur, weil äußere Umstände ein Überleben sonst unmöglich machen. Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelangt man durch das weniger extreme Beispiel des gewöhnlichen Hungers: Die einzigen Bedingungen, unter denen allein der amour de soi-même ein hungriges Geschöpf mit dem Anreiz ausstattet, von etwas mehr als andere zu bekommen – zum Beispiel mehr Nahrung, mehr Kraft oder mehr Einfluss –, sind die, wenn mehr zu haben notwendig ist, um sein oberstes Interesse zu befriedigen, ausreichend Nahrung zu haben, ungeachtet dessen, was andere haben, um ihr Unwohlsein zu stillen. Wie beide Beispiele zeigen, ist das Streben nach einem Vorteil gegenüber anderen nur unter Bedingungen der Knappheit eine rationale Strategie für den amour de soi-même.
Das führt uns unmittelbar zu dem, was ich oben den zweiten Teil der Rousseau’schen These genannt habe, dass soziale Ungleichheiten ihre Quelle nicht in der Natur haben: die Behauptung, es gebe keine notwendigen oder unveränderlichen Eigenschaften der äußeren Welt, auf die Menschen um der Befriedigung ihrer natürlichen Bedürfnisse willen so reagieren müssen, dass sie jenseits der Ungleichheiten, mit denen sie geboren worden sind, weitere Ungleichheiten schaffen. Die vorausgegangenen Überlegungen haben deutlich gemacht, dass Rousseaus Einspruch gegen die Behauptung, soziale Ungleichheiten hätten ihre Quelle in der Natur, von einer Annahme über das Ausmaß und die Bedeutung natürlicher Knappheit abhängt, eine Annahme, die sich in seiner Beschreibung des ursprünglichen Naturzustands als eines des Überflusses niederschlägt, wodurch Arbeit, Kämpfe und Privateigentum sowohl unnötig als auch unerwünscht sind (DU, 83 – 87 / OC III, 134 f.). Viele Leser sind geneigt, Rousseaus Aussagen über die natürliche Fruchtbarkeit der Erde als Ausdruck eines naiven und ungerechtfertigten Glaubens an die Güte der Natur abzutun. Um die Zulässigkeit seiner Annahme zu beurteilen, muss man sich jedoch klar vor Augen führen, was genau sie beinhaltet und welche Rolle sie in seiner Darlegung des Ursprungs der Ungleichheit spielt.
Wenn Rousseau vom Überfluss als natürlicher Bedingung ausgeht, dann will er damit nicht bestreiten, dass irgendeine Art von Knappheit in den menschlichen Angelegenheiten von herausragender Bedeutung ist und daher von der Sozialphilosophie ernstgenommen werden muss. Der Witz seiner Behauptung liegt vielmehr darin, die Art von Knappheit zu benennen, die einen so herausragenden Stellenwert in der menschlichen Gesellschaft einnimmt, und ihre Quelle sozusagen dingfest zu machen. Rousseaus These ist die, dass der Großteil der Knappheit, von der die realen menschlichen Gesellschaften betroffen sind, nicht natürlichen, sondern sozialen Ursprungs ist. Sie ist, mit anderen Worten, keine notwendige Folge allgemeiner Tatsachen der menschlichen und nichtmenschlichen Natur, sie ist stattdessen ein Produkt der Gesellschaft, und das heißt: Sie entspringt sozialen Einrichtungen, die ihrerseits (größtenteils unvorhergesehene) Folgen der Handlungen und Überzeugungen von Menschen sind, die, gerade weil sie frei sind, auch anders hätten ausfallen können. Obgleich Rousseau die Möglichkeit einer natürlichen Knappheit einräumen kann, ist er dazu verpflichtet, sie als ein unveränderliches oder grundlegendes Merkmal der Lage des Menschen abzulehnen. Hinzukommt, dass, sofern sie existiert – immer dort, wo die reale Knappheit teilweise auf rein natürliche Faktoren zurückgeht –, sie verglichen mit der Knappheit, die ihre Quelle in sozialen, von Menschen geschaffenen Umständen hat, vernachlässigbar ist. Wenn Rousseau begeistert den Überfluss des Naturzustands beschreibt, sollten wir ihn nicht so verstehen, als treffe er eine Tatsachenaussage über die natürliche Verfügbarkeit von überlebensnotwendigen Ressourcen. Stattdessen schlägt er eine Art theoretischer Abstraktion vor. (Wiederum ist es wichtig, sich die hypothetische und analytische Funktion des Naturzustands vor Augen zu führen.) Mithilfe der Annahme eines natürlichen Füllhorns, die durch das Ausblenden des Beitrags der Natur zur Knappheit zustande kommt, soll unser Blick von dem Typ von Knappheit abgelenkt werden, der normalerweise, aber zu Unrecht vom Common Sense für den einzigen und bedeutendsten gehalten wird, um so ausschließlich den Typus ins Auge zu fassen, von dem Rousseau meint, er würde für den weitaus größten Teil der Knappheit aufkommen, die zur Herstellung von Ungleichheiten in den realen Gesellschaft beiträgt – und eben diese substantielle These liegt seiner Annahme eines natürlichen Überflusses zugrunde. So gesehen veranschaulicht Rousseaus Einstellung zur Knappheit eine allgemeine Tendenz seines Denkens, nämlich zur Entnaturalisierung und damit zur Entmystifizierung des Sozialen.50 In diesem Fall besteht die Entnaturalisierung der Knappheit in dem Nachweis, dass Knappheit in keiner der zwei möglichen Bedeutungen der Natur entspringt: Erstens findet sich in der Verfassung der Natur selbst – der Beziehung zwischen den biologischen Bedürfnissen des Menschen und den natürlichen Ressourcen der Erde – oder zweitens im Charakter des unsozialisierten Mitleids und des amour de soi-même nichts, was erklären würde, warum Knappheit ein notwendiges oder weitverbreitetes Merkmal des sozialen Lebens der Menschen ist. Die Stoßkraft dieses Arguments hängt weitgehend von der Erkenntnis ab, wie im zweiten Teil die Einführung von künstlichen sozialen Bedingungen und einer »nicht-natürlichen« Leidenschaft Rousseau in die Lage versetzt, eine Erklärung für die machtvolle Neigung der Menschen anzubieten, Knappheit – aller möglichen Typen und großen Ausmaßes – zu produzieren und folglich darzulegen, warum im Gesellschaftszustand weitreichende Ungleichheiten nahezu unvermeidlich sind.
Wir sind jetzt in der Lage, die in Teil I des Zweiten Diskurses dargelegten Hauptelemente von Rousseaus Argument zusammenzufassen, dass nicht die Natur die Quelle sozialer Ungleichheit ist. Seine Argumentation lässt sich als Zurückweisung dreier möglicher natürlicher Erklärungen der sozialen Ungleichheit – wie auch aller Kombinationen der drei – verstehen. Erstens sind soziale Ungleichheiten nicht die unmittelbaren oder notwendigen Folgen natürlicher Ungleichheiten. Obwohl es Letztere gibt, erklären sie weder die Existenz sozialer Ungleichheiten im Allgemeinen noch warum bestimmte Individuen die Stellung einnehmen, die ihnen innerhalb der bestehenden Hierarchien zufällt. Wenn natürliche Ungleichheiten überhaupt bei der Beschaffenheit sozialer Ungleichheit ins Gewicht fallen, dann nur zu einem sehr kleinen Teil, und spürbar sind sie, wenn überhaupt je, nur im Rahmen von sozialen Praktiken und Institutionen, für deren Entstehen der Mensch, nicht die Natur verantwortlich ist und die daher im Prinzip auch anders aussehen könnten. Zweitens liefern die beiden natürlichen Leidenschaften des Menschen, Mitleid und amour de soi-même, den Menschen keinen Anreiz, Ungleichheiten schaffen zu wollen, außer unter bestimmten Bedingungen des Mangels, denn für die Endzwecke eines jeden ist es gleichgültig, wie gut oder wie schlecht es anderen beim Erreichen ihrer natürlichen Zwecke ergeht. Drittens gibt es keinen Grund zu glauben, dass die Bedingungen (solche des Mangels), unter denen Mitleid und amour de soi-même die Menschen veranlassen könnten, nach einem Vorteil gegenüber anderen als Mittel zur Erreichen ihres Endzwecks zu streben, als notwendig oder typisch in einer Welt gelten, in der Begierden nicht von unnatürlichen Leidenschaften verändert worden sind und in der künstliche soziale Einrichtungen Knappheit nicht zu einer systematischen Notwendigkeit gemacht haben.
Der Gedanke, der uns zu den Themen führt, die im nächsten Kapitel abzuhandeln sind, ist der folgende: Wenn soziale Ungleichheit eher als unser Werk denn als das der Natur zu begreifen ist, dann müssen wir irgendwie verständlich machen, was uns dazu motiviert, sie zu erzeugen, und wie wir gesehen haben, liefert uns weder das Mitleid noch der amour de soi-même dafür eine Erklärung. Im 2. Kapitel werden wir den positiven Teil von Rousseaus Ansicht über den Ursprung der Ungleichheit untersuchen, seine Darstellung dessen, wie systematische soziale Ungleichheiten möglich und nahezu unvermeidlich werden, sobald eine bestimmte »künstliche« Leidenschaft, der amour propre, seinem Bild der ursprünglichen Natur des Menschen zugefügt wird.