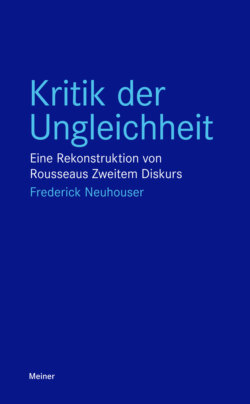Читать книгу Kritik der Ungleichheit - Frederick Neuhouser - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Natur des Menschen und ihre zwei Bedeutungen
ОглавлениеDie Hauptschwierigkeit entspringt hier den schwer fassbaren Wörtern »Natur« und »Natur des Menschen«, die von Rousseau, wie schon dem Leser, der zum ersten Mal zum Zweiten Diskurs greift, nicht entgehen wird, in mehreren Bedeutungen verwandt werden. Diese Bedeutungsvielfalt ist nicht weniger augenfällig in der Art und Weise, in der Rousseau das zentrale theoretische Konstrukt des 1. Teils behandelt: den Naturzustand.16 Den in den verwandten Begriffen »Natur«, »Natur des Menschen« und »Naturzustand« enthaltenen Schwierigkeiten nähert man sich am besten durch die Untersuchung jener Passage, in der Rousseau zum ersten Mal erklärt, welcher grundlegenden Herangehensweise er sich bedienen wird, um zu zeigen, dass die soziale Ungleichheit nicht der Natur entspringt:
… denn es ist kein leichtes Unternehmen zu entwirren, was an der jetzigen Natur des Menschen ursprünglich und was künstlich ist, sowie einen Zustand richtig zu erkennen, den es nicht mehr gibt, vielleicht nie gegeben hat und wahrscheinlich nie geben wird, über den man aber dennoch richtige Begriffe nötig hat, um den jetzigen Zustand richtig beurteilen zu können.17 (DU, 67 / OC III, 123)
Aus diesem Abschnitt geht unter anderem hervor, dass der Naturzustand einschließlich seiner Schilderung der Natur des Menschen Rousseaus Versuch darstellt, das Ursprüngliche (oder Natürliche) von dem zu unterscheiden, was am Menschen und in der menschlichen Gesellschaft, so wie wir sie kennen, künstlich ist. In dieser Hinsicht können wir über den Naturzustand sagen, er habe eine beschreibende oder erklärende Aufgabe: Er zielt darauf ab, jene Aspekte unserer Existenz zu enthüllen, die ihre Quelle in der Natur haben (und folglich in notwendigen, unveränderlichen Faktoren, die wir hinnehmen müssen), und jene, die ihre Quelle in uns haben – die unser Werk sind, statt das Werk Gottes oder der Natur – und daher im Prinzip auch durch uns veränderbar sind.
Dass dem Naturzustand auch eine zweite, normative Aufgabe zukommt, wird am Ende dieses Abschnitts deutlich, nämlich in der These, dass wir unsere ursprüngliche Beschaffenheit kennen müssen, wenn wir unseren gegenwärtigen Zustand richtig beurteilen – das heißt bewerten – wollen. Das deutet darauf hin, dass die Beantwortung der entscheidenden normativen Frage des Zweiten Diskurses – in welchem Maße und warum sind soziale Ungleichheiten rechtfertigbar? – für Rousseau davon abhängt, zu einem richtigen Verständnis der Natur des Menschen und unserer natürlichen Beschaffenheit zu gelangen, damit wir in die Lage versetzt werden, die wichtigste, nach einer Erklärung suchende Frage des Zweiten Diskurses – woher stammen die Ungleichheiten? – dadurch zu beantworten, dass wir präzise zwischen dem unterscheiden, was an diesen Ungleichheiten auf uns zurückgeht und was der Natur geschuldet ist. Mit anderen Worten: Rousseaus Darlegung des ursprünglichen Naturzustandes – und der ursprünglichen Natur des Menschen – ist für das Unterfangen des ganzen Zweiten Diskurses grundlegend und wird eine wichtige Rolle sowohl bei den normativen als auch bei den nicht-normativen Aufgaben spielen, die darin in Angriff genommen werden. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, im Einzelnen zu untersuchen, was für eine Art von theoretischem Werkzeug der Naturzustand für Rousseau ist und wie er dazu dient, die »künstlichen« sozialen Einrichtungen zu erklären, zu bewerten und schließlich auch zu kritisieren, an deren Legitimität er letztendlich interessiert ist. Im Laufe dieses Vorhabens ist es nicht weniger notwendig, die verwirrendste Behauptung in dem oben zitierten Abschnitt zu verstehen: Dass es den Naturzustand möglicherweise nie gegeben hat und es ihn wahrscheinlich niemals geben wird, dass wir ihn aber dennoch kennen müssen, um unsere gegenwärtige Lage zu bewerten. Da das gegenwärtige Kapitel der Beantwortung der ersten der beiden Fragen des Zweiten Diskurses gewidmet ist – woher stammt die soziale Ungleichheit? –, werde ich meine Aufmerksamkeit hier auf die beschreibende und erklärende Funktion des Naturzustands beschränken. Wenn wir im 3. Kapitel daran gehen, Rousseaus Ansicht von der Legitimität oder Begründbarkeit der Ungleichheit zu rekonstruieren, werden wir noch einmal auf den Naturzustand zurückkommen müssen und die Funktion zu verstehen suchen, die er bei der normativen Beurteilung der Gesellschaft und der Gesellschaftskritik einnimmt.
Wiederholen wir noch einmal: Rousseaus Ausarbeitung des Naturzustandes in Teil 1 des Zweiten Diskurses ist dazu gedacht, eine zentrale Rolle bei der Erklärung des Ursprungs sozialer Ungleichheiten zu übernehmen. Oder genauer: Er möchte darlegen, wo die sozialen Ungleichheiten nicht herkommen: nämlich weder aus der Natur des Menschen noch aus der allgemeiner aufgefassten Natur – und auch nicht, wie wir bereits gesehen haben, aus den natürlichen Ungleichheiten selber. Der Inhalt von Rousseaus These, soziale Ungleichheiten hätten ihre Quelle nicht in der Natur des Menschen oder in der Natur überhaupt lässt sich in zwei Thesen zusammenfassen: Erstens dass die Natur des Menschen nicht die psychologischen Anreize liefert, die erklärten, warum Menschen ein Motiv haben, sich die Ungleichheiten auszusuchen, die sie tatsächlich schaffen, und zweitens dass es keine fest vorgegebenen Eigenschaften der Außenwelt gibt, auf die Menschen sich beziehen müssen, um diejenigen natürlichen Bedürfnisse zu befriedigen, welche die Schaffung von Ungleichheiten fordern oder gar fördern, die die ihnen von der Natur auferlegten, aber verhältnismäßig unbedeutenden natürlichen Ungleichheiten übersteigen. Rousseaus negative Antwort auf die erste Frage im 1. Teil des Zweiten Diskurses – die Natur ist nicht die Quelle sozialer Ungleichheiten – bereitet den Weg für seine positive und sehr komplexe Antwort auf dieselbe Frage im 2. Kapitel, in dem neue, nicht-»natürliche« Elemente in die psychische Ausstattung der Menschen und ihre Sozialbeziehungen eingeführt werden. Im Rest dieses Kapitels wird die Rekonstruktion der beiden soeben zusammengefassten Thesen zu leisten sein. Bevor ich mich dieser Aufgabe zuwende, ist jedoch noch etwas mehr über Rousseaus äußerst verwirrende Verwendung des Ausdrucks »Natur« im Allgemeineren zu sagen.18
Entsprechend den beiden Hauptfunktionen, die ich dem Naturzustand zugewiesen habe, führt der Begriff der Natur im Allgemeinen im Zweiten Diskurs einen sowohl normativen als auch erklärenden Sinn bei sich, ja tatsächlich im gesamten Werk Rousseaus.19 »Natürlich« bezieht sich daher manchmal auf die Art von Leben, das Menschen und andere Wesen haben sollten, trotz der Tatsache, dass ihr tatsächliches Leben oft wenig Ähnlichkeit mit dem hat, was die Natur vorschreibt. Diese normative Funktion wird im Zweiten Diskurs ganz besonders durch das Aristoteles-Zitat deutlich, das als Epigraph der Schrift dient – »Nicht in Verderbtem, sondern in dem, was sich nach der Natur richtig verhält, ist zu betrachten, was natürlich ist« (DU, 61 / OC III, 109) –, aber auch in Aussagen, in denen die Bewohner des Naturzustands als solche geschildert werden, die sich »die von der Natur vorgeschriebene Lebensweise«20 (DU, 99 / OC III, 138) bewahrt haben, und das heißt sie führen, angesichts der Wesen, die sie sind, ein unverdorbenes oder gutes oder angemessenes Leben (DU, 183 ff. / OC III, 160). Dieser Gebrauch von »natürlich« ist auch in anderen Schriften Rousseaus zu finden – zum Beispiel im Emile, wo es über dessen Erziehung heißt, sie solle ihn zu einem natürlichen Menschen (E, 430 f., 522 / OC IV, 483, 549) machen, das heißt, er soll so erzogen werden, wie es »dem Wesen des Menschen schickt und dem menschlichen Herzen angemessen ist« (E, 104 / OC IV, 243). In diesem normativen Sinn verwendet, ist das Gegenteil von ›natürlich‹ verderbt, entartet oder unpassend für die Art von Wesen, die wir sind.
In seiner nicht-normativen Bedeutung ist dem »Natürlichen« nicht das »Verderbte« oder »Unpassende« gegenübergestellt, sondern das »Künstliche«. Gebraucht Rousseau »natürlich« in diesem Sinn, dann verbindet er das Künstliche mit dem Eingriff menschlicher Meinungen oder Urteile, derart, dass etwas als künstlich gilt, wenn es in irgendeiner Weise durch »Meinungen verändert« (E, 111 / OC IV, 248) worden ist. Aus diesem Grund klassifiziert er, wie wir oben gesehen haben, die sozialen Ungleichheiten, die auf der Zustimmung der Menschen oder den Überzeugungen hinsichtlich ihrer Begründbarkeit beruhen, als künstlich und unterscheidet sie so von natürlichen Ungleichheiten. Eine andere Möglichkeit, das Künstliche zu definieren, besteht darin, es als Ergebnis – oder Teilergebnis – menschlichen Handelns zu bezeichnen, wobei Handeln im Unterschied zum bloßen Verhalten der Tiere von der Meinung oder dem Urteil über den Zweck oder die Güte dessen, was man tut, bestimmt ist. Allein durch die Disposition, Schmerzhaftes zu meiden, motiviert zu sein, hebt uns noch nicht über das Reich der Natur hinaus (E, 111 / OC IV, 248), während ein durch Urteile bestimmtes Verhalten – etwa ein Urteil darüber, was zu tun gut wäre – als Ausdruck autonomen Handelns, als ein Fall von menschlichem statt bloß natürlichem Tun, gilt. Beispiele für das Natürliche in diesem Sinn sind die rein »mechanischen« Wirkungen, die im Naturzustand, noch »vor dem Verstand« (DU, 71 / OC III, 126), von der Selbstliebe (amour de soi-même) und dem Mitleid auf das tierähnliche Verhalten des Menschen ausgehen. Das bestimmende Merkmal des Natürlichen ist, wie Rousseau an einer anderen Stelle in aller Klarheit sagt, dass es sich »ohne Bewusstsein und Wille« vollzieht (E, 154 / OC IV, 280). Wenn der Mensch aber gestützt auf seine Urteile und seinen Willen in die Welt eingreift, dann kommt Künstlichkeit in sie hinein und eine durch einen solchen Eingriff veränderte Welt hört damit auf, in dem zweiten, nicht-normativen Sinn des Wortes völlig natürlich zu sein.
Obgleich Rousseau dies weniger ausdrücklich darlegt, als er es hätte tun können, werden Eingriffe aufgrund von Urteilen darum als künstlich betrachtet, weil Urteile zu fällen Freiheit erfordert.21 Im Anschluss an die Stoiker, die ihn in seiner Jugend so stark beeinflusst hatten, nimmt Rousseau an, dass Wollen und Urteilen einen spontanen Akt der Zustimmung oder Billigung einschließen: entweder in Bezug auf eine Aussage – in diesem Fall ist das Ergebnis ein Urteil – oder in Bezug auf etwas, was gut zu sein scheint – dann ist das Ergebnis eine Handlung (E, 553 – 560, 572 f. / OC IV, 571 – 576, 585 f.). Daher gilt ihm, wie wir oben gesehen haben, der Glaube an die Legitimität einer Form der sozialen Ungleichheit, der eine Art Urteil ist, als eine Weise der Zustimmung. Was das Natürliche vom Künstlichen – und auch das rein Tierische vom Menschlichen (DU, 107 / OC III, 141 f.) – unterscheidet, ist im Grunde das Fehlen oder Vorliegen von Freiheit. Eine Welt, die auf irgendeine Weise durch menschliche Freiheit – menschliches Urteil oder menschlichen Willen – verändert worden ist, kann nicht mehr als vollkommen natürlich gelten. Allein der im ersten Teil des Zweiten Diskurses beschriebene ursprüngliche und »hypothetische« (DU, 81 / OC III, 133)22 Naturzustand bildet nach diesem Maßstab eine wahrhaft natürliche Welt, während die im zweiten Teil geschilderte Welt – wo zum ersten Mal Menschen auftauchen – stets in irgendeinem Maße künstlich ist.
Es lohnt sich, auf eine Implikation der beiden Bedeutungen von »natürlich«, wie ich sie gerade ausgeführt habe, aufmerksam zu machen, da sie, sobald wir Rousseaus Kritik der Ungleichheit erörtern werden, sehr bedeutsam wird: Anders als die Leser oft meinen, verwendet Rousseau das Wort »künstlich« in einem normativ neutralen Sinn. Für Rousseau gibt es keinen Grund – sei er begrifflicher oder anderer Art –, dass etwas Künstliches (etwas, das von Meinungen oder Willensakten bestimmt ist) zugleich auch unnatürlich im Sinne von schlecht oder verdorben sein muss.23 Wenn er später die Gesellschaft (und die sie begleitende Leidenschaft, den amour propre) als künstlich bezeichnet, dann geht es ihm nicht darum, dass die Menschen durch ihre Sozialbeziehungen notwendig korrumpiert werden, und auch nicht darum, dass sie ihrer »wahren« oder idealen Natur entfremdet sind. Er will damit vielmehr sagen, dass die Gesellschaft etwas ist, was Menschen machen, und das heißt etwas, das Ergebnis von menschlichem Glauben und Willen ist. Das Wichtige an dem Gedanken, die Gesellschaft sei künstlich, liegt darin, dass reale Menschen zwar nicht ohne Sozialbeziehungen der einen oder anderen Art leben können, die spezifischen Formen dieser Beziehungen in der Realität jedoch äußerst verschieden sind und von vielen Zufallsfaktoren abhängen, zu denen auch der menschliche Wille zählt. Menschen können nicht frei wählen, ob sie innerhalb oder außerhalb der Gesellschaft leben wollen, doch da die Natur uns nicht, wie den Bienen und Ameisen, soziale Einrichtungen vorgegeben hat, ist es an uns zu entscheiden, wie wir unsere Sozialbeziehungen ausgestalten. Auch wenn der Zweite Diskurs für gewöhnlich so gelesen wird, stellt Rousseau sich das menschliche Dasein gerade nicht ohne dauerhafte Sozialbeziehungen vor, sowenig wie er es sich ohne Liebe, Vernunft, Sprache oder den Trieb, von anderen geachtet zu werden (amour propre), vorstellt – all dies ist, wie wir sehen werden, ebenso künstlich wie die Gesellschaft, darum aber für ein gutes Leben der Menschen nicht weniger unerlässlich.
Wenn wir diese beiden Bedeutungen von Natur – die eine als Gegensatz zum Künstlichen, die andere zum Verderbten oder Korrumpierten – im Kopf behalten, dann können wir allmählich verstehen, was es für Rousseau heißt, die Quelle der moralischen Ungleichheit nicht in der Natur des Menschen zu verorten. Dass »Natur des Menschen« genau dieselbe zweifache Bedeutung wie »Natur« im Allgemeineren aufweist, wird uns nicht weiter erstaunen. Da Rousseau annimmt, es gebe wichtige Verbindungen zwischen der normativen und der erklärenden Bedeutung von »Natur des Menschen« – ein Thema, auf das im 3. Kapitel zurückgekommen wird – ist es wohl richtiger zu sagen, er stütze sich auf eine einzige Auffassung von der Natur des Menschen, die aber zwei verwandte Aspekte hat. Für die Logik des Rousseau’schen Arguments bleibt es dennoch wichtig, den normativen vom nicht-normativen Aspekt seiner Auffassung von der Natur des Menschen zu unterscheiden, auch wenn es später genauso wichtig sein wird, die Frage aufzuwerfen, wie die beiden seiner Ansicht nach ineinandergreifen. (Um der sprachlichen Einfachheit willen werde ich mich weiter auf zwei Auffassungen von der Natur des Menschen beziehen, obgleich nicht vergessen werden sollte, dass sie für Rousseau eng miteinander verbunden sind.)
Rousseaus normative Auffassung von der Natur des Menschen erscheint im Zweiten Diskurs hauptsächlich in Verbindung mit seiner Rede von der »Verdorbenheit« und der »Erniedrigung« der Natur des Menschen, welche die im zweiten Teil geschilderten Veränderungen der Menschen und ihrer Gesellschaft begleiten (DU, 81, 243 ff., 125 ff. / OC III, 133, 183 f., 207). Im Emile tritt die normative Bedeutung der Natur des Menschen stärker zutage, vor allem in der Hauptthese des Werkes, die eigentliche Aufgabe der Erziehung bestehe darin, dem Menschen zur Verwirklichung seiner wahren Natur zu verhelfen. Die Auffassung von der Natur des Menschen, die es Rousseau ermöglicht, in beiden Schriften von der Verdorbenheit und Erniedrigung des Menschen zu sprechen, ist insofern normativ, als sie jene Charakterzüge im Einzelnen bestimmt, die Menschen zwar haben sollten, aber oft nicht aufweisen und deren Fehlen gerade das ausmacht, was Rousseau unter einer entwürdigten menschlichen Existenz versteht. Die Erörterung dieser Bedeutung von Natur des Menschen werde ich mir für das 3. Kapitel aufsparen, wo ich Rousseaus nicht-normative Einstellung zur sozialen Ungleichheit rekonstruiere. In diesem Kapitel, in dem es mir um den Ursprung der Ungleichheit geht, werde ich seine beschreibende oder erklärende Auffassung von der ursprünglichen Natur des Menschen untersuchen, wie sie in seiner Schilderung des Naturzustands im ersten Teil enthalten ist. Ein Grund, um mit ihr zu beginnen, ist der, dass Rousseaus nicht-normative Auffassung von der Natur des Menschen schwerer zu verstehen ist und typischerweise zu mehr Verwirrung führt als seine vergleichsweise einfache Auffassung von der wahren – oder idealen – Natur des Menschen.