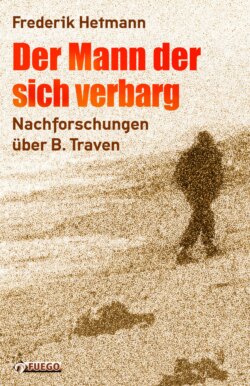Читать книгу Der Mann der sich verbarg - Frederik Hetmann - Страница 11
ОглавлениеEs gibt eine merkwürdige Tatsache, die auch dazu beigetragen haben mag, dass solche Gerüchte entstanden und fortlebten. Adolf hat Hormina geheiratet und ihr seinen ehrlichen Namen gegeben. Das Kind aber, das sie schon vor der Eheschließung zur Welt gebracht hat, der kleine Otto, bleibt bei ihren Eltern.
Otto muss zunächst seine Großeltern als Eltern erlebt haben. Sie haben ihn ausgesprochen verwöhnt Gerade, weil die Großeltern so liebevoll mit dem kleinen Otto umgegangen sind, ist die Bindung an sie stark, wird er sie gar nicht als Großeltern, sondern als Eltern kennengelernt haben.
Der Aufenthalt bei den Großeltern endet, als Otto etwa sechs Jahre alt ist. Um das Jahr 1888 wird der Großvater krank, und Hormina setzt durch, dass sie ihr erstgeborenes Kind zu sich nehmen darf. Sie hat inzwischen zwei weitere Kinder zur Welt gebracht, Willi Ende des Jahres 1884 und Gertrud im Mai 1888. Otto verträgt diese Verpflanzung in die andere Familie schlecht. Außerdem protestieren die bisherigen Pflegeeltern. Großmutter und Großvater fällt es schwer, sich ein Leben ohne ihr Ottochen vorzustellen. Hormina verspricht, den Jungen zurückzubringen, sobald es ihrem Vater bessergehe. Aber es wird nicht mehr besser mit dem Alten, und Otto bleibt bei seinen Eltern.
Es gibt einen naheliegenden Grund, weshalb das Kind in den ersten Lebensjahren bei den Großeltern untergebracht worden ist: Die finanzielle Lage des Ehepaars Feige scheint in diesen Jahren nicht allzu rosig gewesen zu sein. Die Feiges übersiedeln zunächst in Adolfs Heimatort Finsterwalde, in den nächsten Jahren ziehen sie nach Grünberg. Dort werden ihnen weitere drei Kinder geboren. Als Otto zehn ist, geht es wieder nach Schwiebus zurück. 1893 kommt seine Schwester Margarethe zur Welt 1895 sein Bruder Ernst. Damit hat nun der reichliche Kindersegen sein Ende.
Die Mutter ist eine regsame Frau. Sie schreibt die Briefe für andere Leute, die nie schreiben gelernt haben. Sie ist geschickt in Handarbeiten. Sie spielt mit den Kindern Theater, und die Amateurgruppe reist mit den einstudierten Stücken sogar zu Gastspielen in die Ortschaften der Umgebung. In der Familie gibt sie den Ton an. Wenn sie sagt, wir müssen dies oder jenes tun, heißt das, ihr Mann hat das zu erledigen.
Ottos Situation in dieser Familie hat seine bis 1981 lebende Schwester mit dem Satz umschrieben:
»Er fühlte sich nie bei uns zu Hause.«
Rückschauend schildert sie ihn als »eigenwilligen Einzelgänger«, der sehr stark auf seine Kleidung achtete und sein Eigentum behütete. »Er zog sich fast immer von den anderen zurück, las sehr viel.« Sein jüngster Bruder Ernst hat es nicht viel anders dargestellt: »Er war ein eigenartiger, seltsamer Junge, der ganz in seiner eigenen Welt lebte, in einer Welt, in der es für andere keinen Platz gab.« Otto Feige ist ein guter Schüler. Er möchte aufs Gymnasium, später dann Theologie studieren, um Pfarrer werden. Für den Sohn eines Ziegelei-Arbeiters ist das nur möglich, wenn er ein Stipendium bekommt. Aussichten darauf hat Otto in Schwiebus, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Eltern für den Lebensunterhalt des Gymnasiasten und späteren Studenten aufkommen. Genau daran aber scheitern Ottos hochfliegende Pläne.
Die Eltern, die insgesamt für sechs Kinder aufkommen müssen, bestehen darauf, dass der Älteste nach Abschluss der Volksschule abgeht und eine Schlosserlehre bei der Firma Meier in Schwiebus beginnt.
Inzwischen hat sich die Berufssituation des Vaters geändert. Adolf Feige hat in Schwiebus als Hausmeister gearbeitet. Er hat sich umschulen lassen, um in einer in der Nähe liegenden Brikettfabrik den Posten eines Vorarbeiters zu bekommen. 1900 – sein Sohn Otto ist jetzt 18 Jahre alt – hört Adolf Feige, dass eine andere Brikettfabrik in Wallensen, Niedersachsen, Arbeiter sucht. Dort gibt es Werkswohnungen, eine Betriebskrankenkasse, die Aussicht auf eine Altersrente. Also zieht Adolf mit der Familie nach Niedersachsen um.
Nur Otto und sein Bruder Willi bleiben in der Lehre in Schwiebus zurück.
Auch als Otto ausgelernt hat, hält er sich offenbar noch einige Zeit in der Stadt auf. Anfang des Jahres 1902 wird er, nun zwanzigjährig, zum Militär eingezogen und dient für zwei Jahre bei den Bückeburger Jägern. Die Geschwister erzählen später, dass Otto auf seine schmucke grüne Uniform stolz gewesen sei, und dass er in ihr bei den Mädchen Eindruck gemacht habe.
Bis dahin ist, was die äußeren Ereignisse angeht, das Leben des Otto Feige so verlaufen wie das vieler Jugendlicher aus jener sozialen Schicht, in die er hineingeboren worden ist: Volksschule, Handwerkslehre, Militärdienst
Aber es muss in diesen Jahren in Otto Feige noch anderes vor sich gegangen sein.
Er wirkt auf Menschen, die ihn näher kennen, als Außenseiter. So die Aussagen seiner Geschwister. Er erweist sich als intelligent, will höher hinaus als die Mehrzahl seiner Altersgenossen.
Wie kommt es, dass Otto als «anders« empfunden wird, es wohl tatsächlich auch ist?
Nicht ausgeschlossen, sogar wahrscheinlich, dass er sich diese Frage selbst auch gestellt hat, als es Konflikte gab zwischen seinem eigenen Berufswunsch und der Festsetzung der Eltern: »Du kommst in die Lehre zu Meier, Punktum!«
Es ist eine Zeit, in der gemeinhin keine langen Diskussionen zwischen Eltern und Kindern über solche Fragen stattfinden. Was der Vater festsetzt, hat zu geschehen. Die Großmutter, die nach dem Tod des Großvaters mit in der Familie Feige lebt, konnte ihm da wohl auch nicht helfen, wenn man auch weiß, dass sie ihn sonst verwöhnt und den anderen Enkelkindern vorgezogen hat. Die Entscheidung der Eltern ist vernünftig.
Trotzdem wird es heruntergewürgten Zorn bei Otto gegeben haben, vielleicht auch Pläne, wie er sich dem Willen der Eltern entziehen könnte. Einfach durchbrennen, zur See fahren. Aber durchgebrannt ist er nur in der Phantasie.
Genährt werden Phantasien und Tagträume durch die Bücher, die Otto liest, nämlich – und darin nun unterscheidet er sich durchaus nicht von vielen Jungen seines Alters – Coopers Der letzte Mohikaner und Hunderte von Seefahrergeschichten und Piratengarne.
Der Held in Coopers Buch ist das Waisenkind Natty Bumpo. Es wird von Missionaren gefunden und aufgezogen, aber zu seiner wahren Identität findet es erst, als es unter die Indianer gerät. Seine verschiedenen Namen »Lederstrumpf«, »Wildtöter«, »Falkenauge« und »La Longue Carabine« besagen etwas über die Achtung, die ihm die Indianer entgegenbringen.
Viel später wird der erwachsene Mann, der einmal Otto Feige geheißen hat, die Indianer der südlichsten Provinz Mexikos, Chiapas, kennenlernen, Indianer, die relativ unberührt von den Einflüssen westlicher Zivilisation leben. Indianer, bei denen ein Mensch nicht nach dem beurteilt wird, was in Papieren und offiziellen Dokumenten über ihn steht, sondern spontan, nach den Erfahrungen, die man hier und jetzt mit ihm macht.
Die Pubertät ist auch die Zeit, in der sich in der Auseinandersetzung mit den Eltern das Ich, das Selbst, das Eigenständige im Wesen eines Menschen entwickelt und ausprägt. Ich habe unterstellt, dass in Schwiebus bei Ottos Geburt Gerüchte herumerzählt worden sind. Eines Tages kommen sie Otto zu Ohren. Er muss sich mit der Vorstellung auseinandersetzen: Der Mann, an den ich mich als Kind mühsam genug gewöhnt habe, ist vielleicht gar nicht mein Vater. Mein Vater ist ein Adeliger, ein Prinz, der Kaiser. Toll!
Otto sagt sich: »Kein Wunder, dass ich anders bin als sie.«
Was als Klatsch, als Häme auf ihn zukommt, könnte er zur psychologischen Selbstverteidigung benutzt haben: »Ihr könnt mich demütigen, mich verständnislos behandeln. Eines Tages wird sich mein richtiger Vater zeigen. Dann wird sich alles ändern.«
Wenn Otto solche »Spinnereien« ausgesprochen hat, mag er von manch einem ausgelacht worden sein.
»Der Kaiser sein Vater ... lächerlich. Warum nicht gleich der liebe Gott!«
Wenn solche Tagträume als Trost, als Schutz gegen die Verletzungen durch eine raue Umwelt, der man sich nicht gewachsen fühlt, helfen sollen, muss ihre Glaubwürdigkeit verstärkt werden ... durch eine Geschichte. Sie muss so glaubwürdig klingen, dass sie auch andere überzeugt. Selbst dann, wenn ihr Wahrheitsgehalt gering ist. So könnte Otto begonnen haben, Geschichten zu erfinden.
Ich stelle mir vor, einmal erzählte er die unwahrscheinliche Geschichte vom anderen Vater, vom reichen, mächtigen Mann so gut, dass sie ihm einer glaubte, dass sie jemanden beeindruckt, dass sie Otto Ansehen verleiht.
So wird ihm etwas höchst Wunderbares klar: gut Geschichten zu erzählen bedeutet, etwas Wirklichkeit werden lassen, was es vorher nur als Phantasie gegeben hat. Gewöhnlich entsteht so Literatur. Aber diese Fähigkeit taugt unter Umständen auch noch zu etwas anderem. Man kann so das Leben Wirklichkeit werden lassen, das man sich wünscht. Man nimmt einen Namen. Man erfindet zu diesem Namen Erlebnisse, Daten, Ereignisse, die die Daten miteinander verbinden. Ein anderer Mensch ist geboren. Man kann sich selbst durch diesen Vorgang unsichtbar machen. Man kann so das schützen, worauf sonst alle herumtrampeln, was sie misshandeln, beleidigen, verletzen ... wozu man, allein aus sich selbst heraus, nicht stark genug ist, um es zu bewahren: das Selbst.
Es spielt keine Rolle, ob Otto bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr diese mit dem Geschichtenerfinden verbundene Eigenschaft schon genau erkannt hat. Solche Entdeckungen vollziehen sich unter vielen Proben und Rückschlägen. Man kann eine Begabung dazu haben, aber selbst dann baut sich die Fähigkeit dazu erst langsam auf. Man wird zuerst Aufschneider, Angeber, ja Lügner genannt. Daran erkennt man, dass die Zuhörer das, was Fiktion ist, noch als solches durchschauen, dass es einem noch nicht gelungen ist, sie davon zu überzeugen, hier sei von Wirklichkeit die Rede. Man muss seine Erfindung verbessern. Die Fakten müssen glaubwürdiger gewählt werden. Die Art des Erzählens ist noch nicht raffiniert genug. Bis man dann endlich einmal den Triumph erlebt: Sie haben es geglaubt. Es ist mir gelungen, aus der Möglichkeit Tatsächlichkeit werden zu lassen. Das ist wirklich ein Triumph.