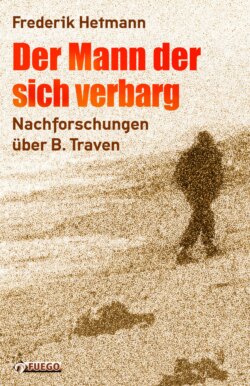Читать книгу Der Mann der sich verbarg - Frederik Hetmann - Страница 15
ОглавлениеZurück durch die Zeit. Zurück durch den Raum. Zurück aus der Provinz Chiapas nach Wallensen in Niedersachsen, in die gute Stube der Familie Feige.
Aus dem Militärdienst heimgekehrt, hat sich dort der älteste Sohn eingerichtet. Er ist völlig verändert. Er bekennt sich plötzlich zu einer sehr radikalen Form des Sozialismus3. Oder war es gar Anarchismus? Durch seine Geschwister, die fast achtzig Jahre später glaubhaft über sein plötzlich erwachtes Interesse an Politik berichten, wissen wir um die Spannungen in der Familie, die sich dadurch ergaben. Wir wissen gar nichts darüber, wie es zu dieser Radikalisierung bei ihm gekommen ist.
Vermutungen sind möglich: Die Wut über den Drill und den Schliff bei den »Preußen«, also beim Militär; die Begegnung mit einem Menschen, der Eindruck auf ihn gemacht hat und ihm solche Gedanken nahebrachte, könnten der Anlass gewesen sein. Vielleicht aber ist er auch in einem Buch darauf gestoßen. Denkbar auch, dass die Aktionen der Anarchisten in Frankreich, die »Politik der Tat«, von der er in jeder Tageszeitung hätte lesen können, ihn begeisterten und mitrissen.
Nun klebt er Plakate an die Wände der guten Stube, und auf dem Buffet stapeln sich Flugblätter. Er nimmt keine Arbeit an, stattdessen probt er Reden. Die Arbeiter müssen über die Ausbeutung durch die Fabrikherren aufgeklärt werden.
Die Arbeiter haben nichts zu verlieren als ihre Ketten, aber eine Welt zu gewinnen. [ ... ] Der Arbeiter muss eines Tages die politische Gewalt ergreifen, um die neue Organisation der Arbeit aufzubauen; er muss die alte Politik, die die alten Institutionen aufrechterhält, umstürzen, wenn er nicht, wie die alten Christen, die das vernachlässigt und verachtet haben, des Himmelreichs auf Erden verlustig gehen will ... Gewalt ist es, an die man eines Tages appellieren muss, um die Herrschaft der Arbeit zu errichten.
Solche Sätze kommen in den Reden vor, die er übt. Die Eltern und Geschwister lauschen hinter der geschlossenen Tür, und was sie da hören, verstört sie beträchtlich. Was ist nur aus ihrem Otto geworden? Wer hat dem Jungen dieses rote Gift in die Hirnwindungen gespritzt? Kaum hat man einigermaßen sein Auskommen, ist gesichert gegen Krankheit und Alter, da muss dies geschehen. Wenn er noch wenigstens ein Sozi wäre. Die Sozialistengesetze, die die Partei in die Illegalität zwangen, sind 1890 aufgehoben worden. Dass man sozialdemokratisch wählt, dafür hätten zumindest die Landarbeiter in Wallensen noch Verständnis. Aber ihr Otto ist ja einer, der vor Gewalt nicht zurückschreckt. In seinen Reden kommt auch der Satz vor: »Dem guten Willen die offene Hand, dem schlechten die Faust.« Er findet die Sozialdemokratie, die auf parlamentarischem Weg Reformen anstrebt, zu zahm. Von ihm kann man hören, dass die Sozialdemokratie ein Papsttum züchte, schlimmer als die katholische Kirche.
»Kannst du dich nicht ein bisschen mäßigen, Junge«, bittet die Mutter, »wir werden in Verruf kommen, wenn das so weitergeht. Und immer diese Zänkereien mit Vater beim Abendbrot. Es hat doch nun mal keinen Zweck. Du wirst ihn nicht überzeugen. Und er dich nicht. Und die Welt ist auch immer noch die gleiche, seit sie Gott geschaffen hat.«
Er liest ihr als Antwort ein Zitat vor, das von seinem Lieblingsdichter Shelley stammt, ein Zitat, mit dem die biedere Frau wohl nicht viel anfangen konnte:
»Kein Gesetz hat das Recht, die Menschen abzuschrecken, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit zu üben. Der Mensch soll die Wahrheit sprechen, bei welcher Gelegenheit auch immer. Eine Pflicht kann niemals ein Verbrechen sein; und was nicht verbrecherisch ist, kann folgerichtig auch nicht schädlich sein.«
Er war doch immer still, schüchtern, unauffällig – aber lass ihn reden oder schreiben, und plötzlich wird er frech, aufsässig, rücksichtslos und ungebärdig. Er denkt nicht daran, seine Ansichten zu verbergen. Es macht ihm ausgesprochenen Spaß, die Familie und seine Umgebung damit zu schockieren. Ein wenig ist es auch die Rache dafür, dass man ihn um die Chance gebracht hat, aufs Gymnasium und danach auf die Universität zu gehen. Der Vater sagt eines Tages: »So geht das nicht weiter. Solange du die Füße noch unter unseren Tisch streckst, hast du dich anständig zu benehmen.«
»Und was ist anständig, lieber Vater?«, fragt Otto. »Ist es etwa anständig, eine Frau für drei Monate ins Gefängnis zu schicken, nur weil sie behauptet hat, der deutsche Kaiser wisse wenig davon, wie ein Arbeiter lebe?«
»Lass den hohen Herrn aus dem Spiel!«
Otto schießt der Gedanke durch den Kopf, dass dieser hohe Herr vielleicht sein Vater ist. Nein, das kann nicht sein. So ein Scheißkerl ist nicht sein Vater, darf nicht sein Vater sein. Er verbittet sich das. Und dann fällt ihm ein, dass niemand sich seinen Vater aussuchen kann. Er muss grinsen. Das reizt Adolf Feige. Er springt plötzlich auf, haut die Faust auf den Tisch. Er nennt Otto einen Tagedieb, einen Faulenzer, einen Schmarotzer, einen vaterlandslosen Gesellen und was nicht alles noch. Adolf Feige stellt seinem Sohn ein Ultimatum:
»Entweder du hast dir bis nächste Woche eine Arbeit gesucht, oder ich werde deinen Krempel eigenhändig raus auf die Gass' werfen.«
»Ich gehe schon von allein«, sagt Otto, »und du kannst gewiss sein: Für immer!«
Das nimmt niemand ernst. Am nächsten Morgen ist Otto verschwunden. Er hat, wie sich später herausstellt, alles Geld von seinem Sparbuch abgehoben. Er hat seinen Koffer gepackt, den er während seiner Militärzeit gekauft hat.
»Wenn er nichts mehr zu fressen hat, wird er schon wieder heimkriechen, der Lauser«, sagt der Vater grob. »Das glaube ich nicht«, wagte die Mutter zu erwidern, »dazu ist er viel zu stolz.«
»Stolz würde ich das nicht nennen ... hochnäsig ... hat ja immer gemeint, er sei was Besseres. Und du und deine Leut ihr habt ihn auch noch darin bestärkt.«
»Und du und seine Geschwister ... ihr habt, seitdem er bei uns ist, immer auf ihm herumgehackt. Das hat auch alles noch schlimmer werden lassen.«
Otto kommt nicht zurück. Sie werden sich nach ihm umgehört haben, nachdem ihre erste Wut verraucht war. Bei ihrem engen Familienzusammenhang müssen sie erklären, warum Otto an diesem Geburtstag oder jener Hochzeit nicht teilnimmt.
Es gibt ein Bild von der Silberhochzeit der Eltern. Da hat man einfach einen anderen jungen Mann mitfotografiert, dem den Kopf abgeschnitten, und Ottos Kopf auf diesen Hals gesetzt. Otto selbst finden sie nicht.
Zum ersten Mal in seinem Leben hat er es verstanden, sich unauffindbar zu machen. Was er treibt, wovon er lebt, wie er sich durchschlägt, ist ein Rätsel.
Niemand hat es je in Erfahrung bringen können.
Er selbst hat später nur Andeutungen gemacht. Er habe als Agitator unter den Arbeitern im Ruhrgebiet gelebt und sei von dem kompromisslerhaften Verhalten der Sozialdemokratischen Partei schwer enttäuscht worden.
Nach den Erfahrungen der Revolution 1918, nachdem die Räteherrschaft im Freistaate Bayern und der sogenannte Spartakusaufstandes4 in Berlin durch die von einer sozialdemokratischen Regierung herbeigerufenen Freikorpsverbände niedergeschlagen wurden, wird er schreiben:
Der freiste Staat der Welt in der Tat: Wucherer und Schieber, Raubmörder und Mörder von Revolutionären leben in Wonne und Wollust. Arbeiter und Revolutionäre werden hingeschlachtet, in Gefängnissen und Zuchthäusern gemartert. Dass es einmal so kommen würde, wenn die Sozialdemokraten die Macht hätten, habe ich sozialdemokratischen Arbeitern bereits im Jahr 1905 gesagt.
Wenn das stimmt, und man traut ihm solche Äußerungen durchaus zu, dann sind die Folgen vorstellbar.
Ist er als Agitator dieser Partei oder einer Gewerkschaft aufgetreten, so dürfte ihn nach der Familie nun auch noch die Partei hinausgeworfen haben.
Eine Kommunistische Partei gibt es damals in Deutschland nicht. Es gibt einen linken Flügel, eine kleine Gruppe innerhalb der Sozialdemokratie, die dem Revisionismus, wie ihn Eduard Bernstein Ende des Jahrhunderts vorgeschlagen hat, energischer widerspricht als die Mehrheit der Partei, ein Grüppchen von Männern und Frauen, das unter Umständen mit Massenstreiks die bürgerliche Gesellschaftsordnung umstürzen will, wie das eben in diesen Jahren im zaristischen Russland versucht worden ist, eine Gruppe, die entschieden jedem Militarismus und allen Rüstungsprogrammen entgegentritt. Und sie haben es schwer, diese Männer und Frauen. Schwer auch mit den eigenen Genossen. Eine wichtige Persönlichkeit auf diesem Flügel der Partei ist Rosa Luxemburg, die sich allerdings zu diesem Zeitpunkt in Warschau in Haft befindet. Sie hat geholfen, die Revolution von 1905 vorzubereiten und ist festgenommen worden. Die deutsche Sozialdemokratie wird sie freikaufen.
Es fällt schwer, sich Otto Feige, der sich nun bald »Ret Marut« nennen wird, als linientreues, dem Revisionismus zuneigendes Parteimitglied vorzustellen. Aber bei aller Radikalität seiner Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft und dem Wirtschaftssystem des Kapitalismus wird er auch immer ein eifriger Verteidiger der Rechte des Individuums sein. Er wird klar zu machen wissen, dass der Sowjetkommunismus mit seinem Gesellschaftsideal wenig zu tun hat. Im Grunde kritisiert er schon sehr früh, zunächst im Rahmen der bürgerlich-monarchistischen Gesellschaft, eine Form der Herrschaft, die später gerade in sozialistischen Staaten zu den fürchterlichsten Auswüchsen führt: die Bürokratie. Er widersetzt sich »der entsetzlichen Angewohnheit, alles … in ein Register einzutragen, in eine Rubrik zu bringen«. Verlogenheit empört ihn, Heuchelei ebenso.
Standesdünkel, die sinnlosen Kriege der imperialistischen Mächte, die das Lebensglück einfacher Menschen zerstören; die wahnwitzige Gewohnheit, Glück oder Unglück des Menschen von einem Stück Papier oder einem Stempel abhängig zu machen.
Hier muss nun auf einige Schriftsteller und einen Philosophen hingewiesen werden, mit deren Werken Otto Feige bzw. Ret Marut in dieser Zeit in Berührung gekommen ist. Da ist vor allem der Philosoph Max Stirner mit seinem Werk Der Einzige und sein Eigentum. Um besser Widerstand gegen Zeitgeist und Gesellschaft leisten zu können, wird darin dem Menschen geraten, ein Doppelleben zu führen: Als registrierte Person soll er sich untergehen lassen, für die Öffentlichkeit tot sein. Hinter der Maske eines Pseudonyms, die ihn tarnt und schützt, soll er die Position des »Empörers« um so entschiedener vertreten.
Ein anderer Gedanke knüpft sich an die geometrische Figur der Spirale. Das Leben ist eine Folge von Toden und Auferstehungen. Man muss untergehen, um sich in Wahrheit zu erfahren. Man muss sterben, um lebendig zu werden. Oder, um Stirner wörtlich zu zitieren: »Die Wahrheit besteht in nichts anderem als in dem Offenbaren seiner selbst«, (man könnte auch sagen der eigenen Identität) »die Befreiung von allem Fremdem, die äußerste Abstraktion oder Entledigung von aller Autorität, die wiedergewonnene Naivität.«
Es ist hier nicht die Frage, wie originell diese Philosophie ist, und was sich für oder gegen sie sagen lässt. In unserem Zusammenhang ist entscheidend, dass sie doch offenbar auf eine ganze Anzahl von Schriftstellern auf der Schwelle zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert beträchtlichen Eindruck gemacht hat. Romain Rolland greift in seinem großen Entwicklungsroman Johann Christof solche Gedanken auf, wenn er in der Einleitung zum letzten Band schreibt: »... was meine Seele war, ich werfe sie hinter mich wie eine leere Hülle. Das Leben ist eine Folge von Toden und Auferstehungen. Lass uns sterben, Christof, auf dass wir wiedergeboren werden.«
Der anarchistische Schriftsteller und Philosoph Dr. Ernst Samuel publiziert unter dem aus einem Anagramm gebildeten Pseudonym Anselm Ruest. Ein Verwandter von ihm, Salomo Friedlaender, der heute gerade wieder als Autor von phantastischen Kunstmärchen bekannt wird, dreht einfach das Wort »anonym« um und nennt sich Mynona. Gustav Landauer benutzt für frühe Arbeiten den Decknamen »Kaspar Schmidt«, bei dem es sich nun wiederum um den bürgerlichen Namen von Max Stirner selbst handelt. Inwieweit auch Tucholskys zahlreiche Pseudonyme – sieben an der Zahl – unter denen er in der Weltbühne schrieb, solche Wurzeln haben, wäre zu untersuchen. Fragt man sich ganz allgemein nach dem Grund für diese Lust am Pseudonym, so gibt darauf Rolf Recknagel in der Einleitung zu B. Traven/Ret Maruts Frühwerk eine meiner Ansicht nach sehr einleuchtende Antwort: »All diese Autoren«, so schreibt er, »gerieten meist als Jugendliche in krassen Widerspruch zu ihrem Elternhaus einschließlich der ganzen Sippschaft und Klasse. Sie brachen aus, entschwanden hinter Decknamen für ihre Attacken ...«. Hinzuzufügen ist höchstens noch, dass vielen – und unter ihnen auch Otto Feige/Ret Marut – das Land, in das sie hineingeboren waren, Deutschland, zuwider war:
Könnte ich doch nur ein Fremdstämmiger werden, um keine Blutgemeinschaft mit diesem ... Deutschland mehr zu besitzen.
Und es entspricht nun gewiss auch der literarischen Zeitströmung des Expressionismus, wenn man die ganze alte Welt als dem Untergang geweiht ansieht und Hoffnung nur in einer neuen Welt zu sein scheint, in die man aufbrechen will, um neu geboren zu werden.
»Rettung kommt durch Fragen und Suchen und Wandern! Deshalb lasst uns dorthin wandern, wo Wahrheit, Weisheit, Errettung und Licht ist.«
Und ab er so gesprochen hatte, brach er auf in ein fernes Land noch am selben Abend.
In diesem Zusammenhang ist dann auch die Wahl des Pseudonyms »Marut« zu verstehen. Die Marut (Plural) kommen in den altindischen Gesängen des Rigveda vor. »Sie treten auf als Sturmwesen, welche die Wolken lockern und weichmachen; sie sind Rudras Genossen beim Sieg über die Dämonen ... ihren Ursprung weiß keiner; nur sie allein wissen um ihren Geburtsort untereinander. Mit Schwingen bedecken sie einer den anderen und kämpfen zusammen.« (Max Schmid)
Bilder der Anonymität und der Solidarität sind also in Ottos neuem Namen verbunden. Es ist, als ob dieser Name ausdrücken solle: Ich will einer von jenen Empörern sein, die sich mit einem Pseudonym vermummen, um wirksamer kämpfen zu können.
Nach drei Jahren, die im Dunkel liegen, und die Otto als politischer Agitator, auf jeden Fall aber unter höchst unsicheren und schwierigen materiellen Verhältnissen verbracht hat, taucht er unter dem Namen Ret Marut und als Schauspieler wieder auf.
Diese Berufswahl scheint so konsequent, dass man von selbst darauf kommen könnte, auch, wenn sie sich durch kein Dokument belegen ließe.
Wie der Geschichtenerzähler, der aus der Phantasie Wirklichkeit werden lässt, sich ganz und gar in seine Geschichte versenken und in ihr aufgehen muss, so muss der Schauspieler sich vollkommen mit seiner Rolle identifizieren.
Schauspieler sein heißt unter anderem, in eine andere Gestalt schlüpfen, sie zu Leben erstehen und sie sterben zu lassen.
Es ist dies ein ganz ähnlicher Prozess, wie ihn Ottos Lieblingsphilosoph als Lebenshaltung empfiehlt. Eine gewisse Begabung für die Schauspielerei mag Otto durch seine Mutter gehabt haben, die, wie wir hörten, mit den Kindern Laientheater spielte. Man muss dazu bedenken, dass Schauspieler einer der wenigen Berufe ist, in die man unter Umständen auch ohne Zeugnisse und Papiere hineinspringen kann. Jedenfalls war dies zu Anfang des Jahrhunderts noch möglich.
Dass man sich als Schauspieler durchaus im Widerstand gegen die bestehende Gesellschaftsordnung empfinden kann, erweist sich an einer von Ret Marut verfassten Groteske mit dem Titel Der Schauspieler und der König. Ein König und ein Schauspieler sind befreundet. Sie treffen sich gelegentlich. Es ist das vermeintlich so ganz Andere des Künstlerdaseins, was den Schauspieler für den König interessant macht. Der Schauspieler hingegen scheint ein Mensch zu sein, der genau weiß: Man darf nur spielen, was dem König gefällt, sonst ist es bald mit dessen Theater-Begeisterung und der Freundschaft zwischen zwei Menschen aus so unterschiedlichen sozialen Gruppen vorbei. Wörtlich heißt es bei Ret Marut weiter:
Eines Nachmittags gingen beide im Park spazieren. Den Abend vorher hatte der Künstler einen König gespielt. Ein Shakespearscher König war es nicht. Die mochte der königliche Theaterfreund nicht leiden. Denn die Könige Shakespeares waren trotz ihres Gottesgnadentums ganz richtige Menschen, die lieben und hassen, morden und regieren – je nachdem, wie es ihnen gerade in den Kram passte.
Die Rolle des am letzten Abend dargestellten Königs hatte jedoch ein Dichter geschrieben, der mit achtzehn Jahren Anarchist, später aber Geheimer Hofrat wurde.
Begreiflich, dass diese Rolle dem König sehr gefiel und Anlass wurde, dass er sich mit dem Schauspieler über das Königsproblem unterhielt.
»Was hast Du für ein Empfinden, lieber Freund, wenn Du einen König darstellst?«
»Ich fühle mich ganz und gar als König, so dass ich keine Geste machen könnte, die dem Charakter des Königs nicht entsprechen würde.«
»Das begreife ich sehr gut. Die Masse Statisten, die sich, den Regie-Anordnungen folgend, vor Dir zu beugen haben, halten das Gefühl königlicher Würde in Dir wach und suggerieren dem Publikum, Du seiest ein echter König.«
»Für das Publikum bleibe ich auch ohne Statisterie ein König – selbst dann noch, wenn ich ganz allein auf der Szene stehe und einen Monolog spreche!«
Diese rein künstlerische Auffassung des Schauspielers reizte den König, zwischen sich und dem Bühnenkönig einen scharf begrenzten Vergleich zu ziehen: »Eine unüberbrückbare Kluft zwischen dem wirklichen und dem Theaterkönig ist aber doch vorhanden. Du magst noch so vorzüglich den König gespielt haben: Mit dem Augenblick, wo sich der Vorhang senkt, hörst du auf, König zu sein. Die Suggestion und die Statisterie machen Deiner Herrlichkeit ein Ende, sobald sie versagen. Ich aber, mein Lieber, bleibe König, selbst, wenn ich im Bett liege!«
Darauf sagte der Schauspieler: »Mein lieber Freund, der Vergleich passt auf uns beide. Wir fuhren vorhin im Wagen bis zum Tor des Parkes. Auf den Straßen standen und liefen unzählige Leute. Sie grüßten – Du danktest. Sie schrien aus Leibeskräften: Vivat – und Hoch – Du lächeltest etwas blasiert. Aber wenn diese Leute einmal aufhören, freiwillig Statisterie zu bilden, dann hörst Du – nicht nur im Bett, sondern am hellen Tage – dann hörst auch Du, mein Freund, auf, ein wirklicher König zu sein!«
Der König blieb mit einem scharfen Ruck stehen. Er sah den Schauspieler fest an. Seine Lippen wurden blass und zuckten. Plötzlich drehte er sich um.
Mit raschen Schritten ging er zum Wagen und fuhr zurück.
Allein.
Die Freundschaft war aus.
Die Freunde sahen sich nie wieder.
Und nie wieder besuchte der König ein Theater.
Er wurde ein Denker.
Bekam die fixe Idee, ein ganz gewöhnlicher Sterblicher zu sein.
Musste infolgedessen abdanken.
Starb fünf Jahre später.
Im Wahnsinn.
Sagte man.
Für die Spielzeit 1907/08 erwirbt Ret Marut am Theater in Essen eine Mitgliedskarte der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger. 1908 spielt er in Suhl im Thüringer Wald, in der nächsten Saison in dem ebenfalls im Thüringer Wald gelegenen Ohrdruf. Von dort ist eine polizeiliche Meldekarte erhalten, in der als Geburtsort San Francisco, als Geburtsdatum der 25.2.1882 angegeben ist. Von Ohrdruf geht Marut nach Crimmitschau in Sachsen, eine Stadt mit Textilindustrie, eine »der ältesten Zentren der deutschen Arbeiterbewegung«. Dort hat es 1903/04 einen großen Streik gegeben. Bei einer Rede vor Streikenden in Chemnitz ist jener Satz gefallen, der 1904 zu Rosa Luxemburgs erster Gefängnisstrafe wegen Majestätsbeleidigung geführt hat:
»Der Mann, der von der guten und gesicherten Existenz der deutschen Arbeiter spricht, hat keine Ahnung von den Tatsachen.«
Eines der ersten Stücke, in denen Marut in Crimmitschau auftritt, ist das Lustspiel Im bunten Rock. Der ihn betreffende Abschnitt in der Theaterkritik der Lokalpresse lautet:
»Der im Waffenrock steckende junge Gelehrte Dr. Wendland machte einen vortrefflichen Eindruck; wir wollen Herrn Marut unsere Anerkennung dazu aussprechen.« Auch als Pfarrvikar weiß er durch »Haltung, Gang und Mienenspiel« zu gefallen und erregt Heiterkeit, während er in dem Schauspiel Die Else vom Erlenhof den jähzornigen Heiratskandidaten Bertel »recht effektvoll« spielt. Das ist alles »Schmiere«, oder wie Marut es später selbst nennt »Zirkus«. Aber auch an einer »Schmiere« kann man lernen. Vielleicht wird die Heuchelei und doppelte Moral bürgerlicher Gesellschaft selten so augenscheinlich wie im Milieu dieser kleinen Bühnen. Einerseits sind Schauspielerinnen und Schauspieler Ausgestoßene, andererseits braucht man sie doch ... zur Ablenkung, für einen Pseudo-Kunstgenuss. Kunst soll schön sein, Theater: damit man sich zeigen kann, weil der Mensch nun mal etwas fürs Gefühl braucht und sich nach soviel Gewerbefleiß auch mal entspannen muss. Aber bitte, Kunst möge nur nicht ernst machen. Sie soll schmücken, bestätigen, verklären, erheben, nicht aufschrecken, kritisieren, die Zähne zeigen.
Im März 1909 tritt nach allerlei Komödien und Possen, nach viel Schmieren- und Klamauktheater, Marut in einem Theaterstück auf, das vom Thema her sehr wohl kritisch, desillusionierend, entlarvend sein könnte. Es heißt Heines Leiden. Es schildert den Aufenthalt des jungen Heine in Hamburg. Ein junger Mann, der seine ersten Gedichte geschrieben hat, soll partout Kaufmann werden, im Kontor des reichen Onkels Salomo. Und er hat auch noch das Unglück, sich in seine schnippische Cousine zu verlieben. Heine wird später über diese Situation den knapp-ironischen Vers schreiben:
»Es ist die alte Geschichte
doch ist sie ewig neu und
wem sie just passieret,
dem bricht das Herz dabei.«
Marut spielt den jungen Heine. Und was schreibt der Crimmitschauer Anzeiger? – Mit Wohlwollen?
»Wir freuen uns, Ret Marut einmal in einer größeren Rolle gesehen zu haben, die uns sein Spiel besser würdigen ließ. Er ist in unseren Berichten des öfteren vielleicht sehr knapp weggekommen. Um so mehr ist es uns ein Bedürfnis, heute durch rückhaltlose Anerkennung seiner gestrigen Leistung Versäumtes nachzuholen. Über Heine liegt der Zauber der Jugend, des Werdenden, des Großes Versprechenden; die Begeisterung für die Kunst, der eigenartige Reiz des in heißer stürmischer Liebe entbrannten Jünglings, dessen Herz zugleich innige Dankbarkeit gegen den Onkel erfüllt, der ihm viel Gutes erwiesen; oft aber erfüllte ihn tiefe schmerzliche Bitterkeit, dass er den Erwartungen aller derer, die ihn lieben, nicht entsprechen kann. Alles dies wusste Ret Marut in überraschend lebenswahrer Weise zur Darstellung zu bringen. Vornehm in Miene, Wort und Haltung, packend in seiner Leidenschaftlichkeit war sein Heine eine durchaus sympathische Persönlichkeit, der man die wärmste Anteilnahme nicht versagen konnte ...«.
Da hat man die Kunstgesinnung der Kleinbürger, die auch den jungen Brecht so aufreizte.
In Crimmitschau verliebt sich Ret Marut in die Schauspielerin Elfriede Zielke, die häufig, wie aus den Theaterkritiken zu ersehen, in denselben Stücken wie er aufgetreten ist. 1910 geht Marut mit ihr vorübergehend nach Berlin. Vielleicht um seine Ausbildung als Schauspieler zu vervollständigen, vielleicht aber auch, um den Versuch zu unternehmen, als freier Schriftsteller zu leben, denn schon zu dieser Zeit hat er kleine Satiren, Kurzgeschichten, bösartige Parabeln verfasst.
Elfriede Zielke erzählt er den ersten jener zahllosen von ihm erfundenen Lebensromane. Er will auf einem Schiff geboren worden sein. Die Geburtsurkunde liege in San Francisco bzw. habe sich dort befunden. Das Erdbeben oder der sich anschließende große Brand in der Stadt im Jahre 1906 hätte das Dokument leider vernichtet. (Auffällig, dass die Jahreszahl 1906 in etwa mit Ottos neuem Leben als Ret Marut übereinstimmt.)
Seine Mutter, sie soll eine Irin gewesen sein, hat angeblich, als er zwölf Jahre alt war, Selbstmord begangen. Danach sei er von einer Gouvernante erzogen worden, und als Tänzer in der ganzen Welt herumgekommen.
Rudolf Recknagel weist in seinem Buch über B. Traven darauf hin, dass dieser Lebenslauf ganz offensichtlich aus der Handlung eines Romans von Hermann Bang mit dem Titel Die Vaterlandslosen abgeleitet worden ist.
Geboren wurde er auf der Insel der Vaterlandslosen, das ist die Donauinsel Adah-Kaleh unweit des Eisernen Tores. Seine Mutter, eine Dänin, starb aus Schwermut und Sehnsucht nach ihrer Heimat. Die Erziehung Joans erfolgt durch eine Gouvernante. Der Vater weilt meist in London. Joan bleibt bis zu seinem Lebensende heimatlos und einsam.«
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass Ret Marut Kollegen erzählt, sein Vater sei rumänischer Abstammung.
Als das Gespräch aufs Heiraten kommt, erklärt Marut seiner Freundin, die inzwischen ein Kind von ihm erwartet, sie müsse ihn nach England begleiten. Nur dort seien die nötigen Papiere zu beschaffen.
Am 20. März 1912 kommt das Kind Elfriede Zielkes und Ret Maruts zur Welt: eine Tochter, die den Namen Irene erhält.
Marut hat inzwischen eine Tour mit einer Wanderbühne durch Pommern, Ost- und Westpreußen, die Provinz Posen und Schlesien hinter sich und ist am Stadttheater in Danzig engagiert. Auch Elfriede spielt bald wieder. Im August 1913 treffen sie sich noch einmal zu einem vierzehntägigen Urlaub in Tangermünde, wo Elfriede ein Engagement hat.
Ende 1914 kommt es zwischen ihnen endgültig zum Bruch, und zwar unter bühnenreifen Umständen.
Elfriede Zielke hat einen Verehrer, den sie offenbar in der Erwartung, Ret Marut werde sie doch noch heiraten, mehrfach abgewiesen hat. Nun – der Erste Weltkrieg ist inzwischen ausgebrochen – hat sich jener Herr Garding hinter die Mutter seiner Angebeteten gesteckt, die ihre Tochter gern unter der Haube sähe. Herr Garding ist zum Militär einberufen worden. Über die Mutter gelingt es ihm, von Elfriede die Zustimmung zur Eheschließung zu erpressen, »weil er sonst im Krieg den Freitod suchen würde«.
Seit Mai 1912 hat Marut ein Engagement am Schauspielhaus Düsseldorf. Er erhält ein Monatsgehalt von 170 Mark brutto, spielt meist Nebenrollen. Ohne zusätzliches Entgelt arbeitet er auch noch an der Theaterzeitschrift Masken mit. Im Sommer 1914 spielt er am Künstlertheater in München, das aber nach Kriegsausbruch schließt. Marut tingelt in Solingen, Köln, Metz und Straßburg. Am 30. Juni wird ein mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus bestehender Vertrag für die nächste Saison nicht erneuert. Er will gleich Urlaub nehmen. Als die Leitung des Theaters das ablehnt, kündigt er mit einem Brief, der einen einzigen geheimnisvoll klingenden Satz enthält:
Ich stehe vor dem Abschluss sehr weitgehender Verpflichtungen, die meine absolute Objektivität und völlige Parteilosigkeit dem Schauspielhaus gegenüber bedingen.
In Düsseldorf hat er die Schauspielschülerin Irene Mermet (Bühnenname: Irena Alda) kennengelernt. Das Mädchen ist 1893 in Köln geboren. Sie ist die Adoptivtochter des Kaufmanns Fritz Mermet, hat 1913/14 der frei-sozialistischen Siedlungsgemeinde (Volkslandbund) angehört. Sie hat dann für kurze Zeit eine Schauspielschule besucht, die sie mit 450 Mark Schulden verlässt. Mit ihr zusammen reist Marut nach München, um dort einen Kleinverlag für anarchistisch-pazifistische Schriften zu eröffnen, der Irene Mermets Namen trägt, während er ab September 1917 damit beginnt, die Zeitschrift Der Ziegelbrenner herauszugeben. Schon die Notiz im Impressum verrät etwas von der rabiat-anarchistischen Nonkonformität dieses Blattes. Sie ist zugleich auch ein bissiger Tadel über gewisse damals wie heute übliche Unarten im Pressewesen: