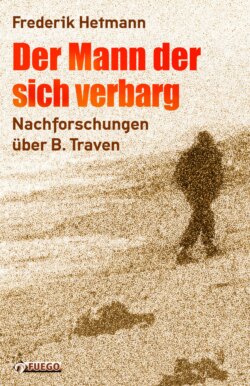Читать книгу Der Mann der sich verbarg - Frederik Hetmann - Страница 13
ОглавлениеStellen wir uns vor: Es gibt einen Mann, der einen Wunsch solcher Art hat, wie wir ihn hin und wieder alle einmal haben. Er will fort von Allem. Fort ans Ende der Welt. Dort, so meint er, könne er allem Ärger, aller Angst, aller Bedrohung entgehen. Dort, so hofft er, werde sich das Paradies auf Erden finden lassen.
Für den Mann, der sich B. Traven nannte, liegt das Paradies auf Erden in Chiapas, dem südlichsten Bundesstaat von Mexiko. Er wird sich am Ende seines Lebens wünschen, dass die Asche seines Leichnams über diesem Land ausgestreut werden solle. Man hat diesem Wunsch entsprochen.
Über Chiapas hat B. Traven ein ungewöhnliches Reisetagebuch verfasst. Es heißt Land des Frühlings. Das Buch ist in Deutschland zum ersten Mal 1928 und danach in einer Prachtausgabe mit zahlreichen Originalfotos 1981 bei der Büchergilde Gutenberg, dem Stammverlag Travens, wiedererschienen. Auf den ersten Seiten dieses Buches wird Chiapas beschrieben, beschrieben, wie man nur ein Traumland schildern kann:
Die gewaltigen Ruinen von Palenque, mit ihren grandiosen Überresten von Palästen und Tempeln, die Ruinen anderer untergegangener, verlassener oder vergessener uralter indianischer Städte bei Tonala, bei Ocosingo und an vielen andern Plätzen sind ein Beweis dafür, dass in Chiapas einstmals eine hochentwickelte Kultur bestand, die keinen Einfluss von Asien oder Europas aufweist und die völlig auf eigener Erde gewachsen war. Was in den Dschungeln und Urwäldern von Chiapas, unter dem überwucherten Schutt von Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Bergrutschen noch der Entdeckung wartet, kann vielleicht eines Tages zu der Erkenntnis führen, dass in Chiapas die Anfänge menschlicher Zivilisation und Kultur gesucht werden müssen.
Diese Ansicht Travens wird durch die wissenschaftlichen Forschungen nicht bestätigt. Hans Helfritz schreibt in seinem Buch Amerika – Inka, Maya und Azteken:
»Nach dem Stand der heutigen Forschung können wir mit einiger Bestimmtheit sagen, dass 20.000 bis 12.000 Jahre v. Chr. jagende Nomadenstämme von Asien nach Alaska eingewandert sind. Ihr Lebensunterhalt wurde durch die Jagd auf große Tiere des Pleistozän bestimmt. Kulturell standen die paläo-asiatischen Völker etwa auf derselben Stufe wie Gruppen des höheren Paläolithikums in der Alten Welt […]. Nach dieser ersten Einwanderungswelle erschienen auf dem ganzen amerikanischen Kontinent Gruppen von Völkern, die zwar auch noch der Jagd nachgingen, sich aber mehr und mehr mit dem Sammeln von Früchten und Muscheln beschäftigten. Ihre Vertreter könnte man mit den mesolithischen Gruppen der Alten Welt vergleichen. Sie erreichten Südamerika vielleicht zwischen dem 8. und 5. Jahrhundert v. Chr.
Von 5000 bis 3000 v. Chr. erschien eine dritte asiatische Einwanderungswelle in Nordamerika. Sie gehörte einer Zivilisation an, die man die zirkumpolare genannt hat. Man glaubt in diesen Stämmen die ursprünglichen Träger der sogenannten Eskimal-Alëuten-Kultur zu erkennen und stellt sie auf die Stufe des frühen Neolithikums. Am Ende dieser Periode können wir bei dieser Gruppe den Gebrauch des Kupfers, die Herstellung von Keramik, von Geweben und Lederarbeiten und das Halten von Hunden feststellen, die den Polarhunden verwandt sind.«
In der Einführung zu Land des Frühlings merkt man, dass es sich hier um das Loblied auf eine Wahlheimat handelt, um einen Bericht, in dem Wirklichkeit, die tatsächlich phantastische Züge hat, Wunsch und Traum sich überblenden.
Chiapas wird für Traven zum irdischen Paradies, wie es wohl alle Menschen im Stillen suchen und nur wenige es finden.
In seinen Tälern und Niederungen hat der Staat durchaus tropisches Klima. Auf dem Hochland der Sierra Madre, die in zwei Armen von Westen nach Osten und von Westen nach Südosten den ganzen Staat durchzieht, ist das Klima, ähnlich dem Spätfrühling in Mitteleuropa, ziemlich beständig das ganze Jahr hindurch. Es gibt auf der Erde keine Pflanze, keine Frucht und auch kein Tier, die nicht in einem Teil dieses Staates ebenso gut gedeihen wie in ihrer Urheimat …
Auch was die Bevölkerung angeht, so hat Chiapas für Traven eine besondere Bedeutung: Es ist das Land der Indianer schlechthin:
Der Staat hat [Mitte der Zwanziger Jahre] etwa vierhunderttausend Einwohner, von denen wenigstens dreihunderttausend reinblütige Indianer sind, die ihre eigene Sprache sprechen und die in ihren eigenen Städten, Dörfern und Siedlungen wohnen, wo sie nur ihren Caciquen, Häuptling, als Bürgermeister oder Ortsvorsteher haben. Diese Indianer haben nicht nur ihre eigene Sprache erhalten, sondern sie leben auch noch nach ihren eignen uralten Sitten und Gebräuchen, die sich von den unsrigen völlig unterscheiden und die durch die Europäer und durch die katholische Religion nur wenig und nur äußerlich beeinflusst worden sind.
Im Staat Chiapas finden wir den Indianer, den Ureinwohner des Kontinents, in allen Stufen der Zivilisation.
Die Lacandonen sind völlig unzivilisiert Sie leben auf der primitivsten Stufe, sie siedeln nicht in Dörfern, bauen entweder gar keine Wohnhütten oder nur solche aus Zweigen. Die Mehrzahl der Indianer im Staate darf als halbzivilisiert betrachtet werden. Es sind die Indianer, die als Kleinlandwirte und zumeist in ihren eigenen Kommunen leben …
Hier wird klar, weswegen Traven die Indianer bewundert: Die genossenschaftlichen Formen ihres Zusammenlebens sind dem Anarchisten2 sympathisch.
Soweit Traven selbst, und nun meine Vorstellung: Ich stelle mir vor, dass es in Chiapas ein Café Altamira gibt, eine armselige Herberge, ein Blockhaus mit Vordach. Der Busch beginnt gleich gegenüber. Es ist Regenzeit, die dort gewöhnlich, wie ich von Traven weiß, von Anfang bis Ende September dauert. Ich weiß aus seinen Aufzeichnungen weiterhin, dass es auch dann nur drei Stunden ununterbrochen regnet und höchstens gegen Abend noch einmal ein heftiger Regenschauer niedergeht. Aber in jenem Jahr – es könnte doch sein! – regnet es mehr als gewöhnlich. Es hat so heftig geregnet, dass sie ihre Reise haben unterbrechen müssen. Der weiße Mann und sein Begleiter, ein Indio, sitzen, zur Untätigkeit verurteilt, in dieser primitiven Herberge, liegen vielleicht auch tagsüber in Hängematten, die langsam schaukeln, wobei die Stricke ein knarrendes Geräusch von sich geben. Durch das Bewusstsein des Weißen, der vor seinen Augen Regen rinnen sieht und dessen Körper gleichmäßig hin- und herbewegt wird, zieht als ein breiter Strom von Bildern die Geschichte jenes Landes, in das es ihn verschlagen hat.
An die Azteken denkt er, jenes Volk, das Mexico City zum ersten Mal begründete, jenes Volk, für das die Begegnung mit den »weißen Göttern« zur Katastrophe wurde.
Was war, ehe die Weißen kamen?
Zuerst lebten die Azteken, wie ihre Annalen berichten, als ein wanderndes Volk. Nach ihrem Stammeshelden nannten sie sich Mexitli und gaben so diesem ganzen Land seinen späteren Namen. Um das Jahr 1090 brachen sie aus dem »Land der weißen Farbe«, Aztlan, auf. Ganz ähnlich wie das Volk Israel, dem sein Gott ein gelobtes Land versprochen hatte, vertrauten auch die Azteken auf das Wort ihres Gottes Huitzilopochtli, am Ende aller ihrer Irrfahrten würden sie in einer ihnen vorbestimmten Heimat glücklich werden.
In den Chroniken über die Züge der Azteken werden Namen von Städten und Landschaften erwähnt, die aber nichts anders bedeuten, als dass diese Suche in alle vier Himmelsrichtungen führte. Am Ende – so wieder die mythischen Berichte – kommen die Azteken nach Tollan oder Tula, zum Weltmittelpunkt, unter dem man sich realgeschichtlich das Zentrum des zu dieser Zeit schon bestehenden Toltekenreiches vorzustellen hat. Sie empfangen dort die Gaben der höheren Kultur.
Belegbar durch archäologische Funde ist, dass die Azteken an der Zerstörung Tollans beteiligt gewesen sind und etwa zwanzig Jahre dort gelebt haben. Dann aber setzten sie ihre Wanderung fort. Sie gelangten auf das Gebirgsplateau im Inneren Mexikos, in die Hochebene Anahuac, das »Land nahe dem Wasser«. Damit war die sich dort befindende Seenplatte gemeint.
Allerdings ist diese Namensgebung erst durch die europäischen Geographen viel später erfolgt. Sie nahmen das aztekische Wort für »Meeresküste« und ordneten es dieser Hochebene voller Seen zu. Über die Wanderungen der Azteken berichten alte Bilderschriften im Codex Boturini oder im Atlas Goupil-Boban, wie die fachmännischen Bezeichnungen für diese Manuskripte lauten. Sie beschreiben die Zeit von der letzten Sintflut bis zur Gründung der Hauptstadt des späteren Aztekenreiches in Tenochtitlan. In einer Schrift wird der Ort dieser Stadt als ein hoher Berg dargestellt, der aus dem Wasser aufragt. In einer anderen sieht man an diesem Ort einen Altar. In einer Höhle am Fuß des Berges gibt Huitzilopochtli Hinweise über den weiteren Verlauf der Reise. Und eine Zahl, die sich auf dem Bild findet, ermöglicht wieder eine historische Zuordnung dieses Ereignisses. Es könnte 1168 stattgefunden haben. Die Strapazen der Wandernden hatten zunächst noch kein Ende.
Am »Berg der Heuschrecken« liefern sie sich mit den Nachkommen der Tolteken eine Schlacht. Sie werden besiegt und danach versklavt. Da sie sich als Krieger Verdienste erwerben – man vermutet, dass sie eine ihren Herren unbekannte Kriegs- oder Waffentechnik gekannt haben –, erhalten sie schließlich die Freiheit zurück und nehmen danach ihre Wanderungen über die Hochebene wieder auf. Sie erreichen die Inseln der Seenplatte. Dann vollzieht sich auf einer Insel im Texcoco-See ein orakelhaftes Ereignis:
»Hier gewahrten sie einen Adler von außergewöhnlicher Größe und Schönheit, der auf einem Feigenkaktus saß. Seine Flügel waren gegen die aufgehende Sonne hin entfaltet, und in seinen Krallen hielt er eine Schlange. In dieser Erscheinung glaubten die Azteken das Zeichen des Himmels zu erblicken und legten daher dort den Grundstein zu ihrer künftigen Hauptstadt Tenochtitlan. Es ist derselbe Platz, den heute das Zentrum der Stadt Mexico einnimmt.«
Zunächst dürfte sich an der Stelle in den Jahren zwischen 1325 und 1370 ein recht bescheidener Altar aus Binsen und Blättern, geschmückt mit den Abzeichen des Schutzgottes Huitzilopochtli, gestanden haben.
Sehr schnell aber entwickelte sich eine blühende Stadt. Voraussetzung dazu war eine agrarkulturelle Großtat: die Anlage der »Chinampas« oder der »schwimmenden Gärten«.
»Zunächst wurden rechteckige Flöße aus Flechtwerk und Schilf gebaut, auf die man etwa 1 Meter hoch schwarze Erde häufte. Hierauf legte man wieder eine Schicht Flechtwerk und Schilf, dann wieder Erde und so fort, bis die Flöße eine Höhe von 3 bis 5 Metern erreicht hatten. Nun konnte man sie bepflanzen, zunächst mit Gras und Schilf und an den Rändern mit Weiden, die dem Ganzen Halt gaben. Nach etwa vier Jahren haben diese kleinen schwimmenden Inseln durch die ständige Berieselung und Düngung mit immer wieder neu aufgetragenem Schlamm so viel an Boden gewonnen, dass man auf ihnen alle Arten von Gemüse und Blumen ziehen und sogar leichte kleine Strohhütten, Chinanales, errichten konnte.«
Der kulturelle Sprung, den die Azteken taten, ist erstaunlich. Innerhalb von zwei oder drei Jahrhunderten scheinen sie von primitiven Jägern zu Ackerbauern und Stadtbewohnern geworden zu sein, wobei sie allerdings von früheren Kulturvölkern, den Teotihuakanern und den Tolteken viele Errungenschaften übernahmen, um aber danach alle Spuren dieser Einflüsse sorgfältig zu verwischen. Es wäre möglich, dass die Vernichtung der Staatsarchive unter dem Aztekenkönig Itzcoatl im 15. Jahrhundert eben zu diesem Zweck geschah.
Eine weitere wichtige, machtpolitische Grundlage für den raschen und strahlenden Aufstieg des Aztekenreiches war der Bund der Staaten von Mexiko (der Azteken), von Texcoco und Tlocopan. Sie hatten vereinbart, sich in Kriegen gegenseitig zu unterstützen, und die Beute jeweils gerecht untereinander aufzuteilen.
Recht bald führten Wohlstand, Sicherheit und kulturelle Fertigkeiten im Aztekenreich dazu, dass die Bevölkerung beträchtlich zunahm. Das Reich weitete sich bis zum Atlantischen und Stillen Ozean und bis in den Bereich der heutigen Länder Guatemala und Nicaragua hin aus. Die in Kriegen eroberten Gebiete wurden dem Kernland nie einverleibt, sondern mit Hilfe starker Garnisonen besetzt gehalten.
Im Reich selbst gab es einerseits eine kleine Elite, zu der Krieger, Priester und Beamte gehörten, die sehr aufwendig und komfortabel lebten. Im Schatten standen die Bauern, die in ihren Stroh- und Lehmhütten inmitten von Maisfeldern und Agavenpflanzungen auch damals ein eher bescheidenes Dasein führten, aber das anspruchsvolle Leben der Oberschicht möglich machten.
Allerdings war es auch genau diese Schicht der Bauern, die den Untergang des Reiches nach dem Eindringen der Spanier relativ unbehelligt überstand.
Es ist erstaunlich, dass ein so großes, kulturell differenziertes Reich wie das der Azteken praktisch ohne Geld auskam. Die Steuern wurden in Naturalien erhoben, über ihre Einziehung, die jährlich, in manchen Gegenden sogar alle 80 Tage stattfand, wachten an jedem Ort Beamte, über ein gutausgebautes Straßennetz liefen nicht nur diese Einnahmen ins Zentrum des Landes, über sie trugen Kuriere auch Nachrichten über alle wichtigen Vorkommnisse nach Tenochtitlan. »Alle zwei Meilen war eine Post-Station, Techialoyan genannt. Ein Eilbote lief mit seinen Depeschen, die in der Form von hieroglyphischen Bilderbogen angefertigt waren, bis zur ersten Station. Dort wurden sie von einem anderen Eilboten in Empfang genommen und von ihm zur nächsten Station weiterbefördert. Auf diese Weise durcheilten die Nachrichten mit unglaublicher Schnelligkeit das Land. Besonders gut scheint das Stafettensystem auf dem Weg von der atlantischen Küste zur Hauptstadt funktioniert zu haben, denn schon wenige Tage, nachdem die Schiffe des Cortes auf der Reede des heutigen Veracruz Anker geworfen hatten, traf die erste Gesandtschaft Moctezumas (Montezuma ist die spanische Schreibweise des Namens) aus der 450 Kilometer entfernt gelegenen Hauptstadt bei Cortes ein und überreichte ihm Gastgeschenke. Zusammen mit der Gesandtschaft kamen auch Leute, deren Aufgabe es war, von allem, was sie dort bei den fremden Ankömmlingen sahen, Bilderbogen anzufertigen; es waren die ›Bildreporter Moctezumas‹.«
Sehr leicht ist es den nach Amerika kommenden Spaniern gefallen, die Religion der Azteken und der mit ihnen in einem kulturellen Zusammenhang stehenden Nachbarvölker als unmenschlich und grausam in Verruf zu bringen und daraus eine Berechtigung für die Unterwerfung und Kolonialisierung dieser Gebiete abzuleiten. Betrachtet man die Religion der Azteken unvoreingenommen, so kommt man zu einem wesentlich anderen Bild. Bei allem, was man über diese Religion hört, und was einem zunächst vielleicht befremdlich erscheint, sollte man sich des Satzes von George C. Vaillant erinnern:
»Die aztekische Religion erwuchs aus der Begegnung mit den Naturkräften, aus der Furcht vor ihnen und aus dem Versuch, sie in Grenzen zu halten.«
Unser immer nur von der Sichtweite des Christentums und Europas als Mittelpunkt der Welt ausgehendes Denken macht in der Beurteilung dessen, was grausam und barbarisch sei, merkwürdige Unterschiede.
Die Menschenopfer der Azteken werden ohne weiteres als primitiv und barbarisch eingestuft. Wenn aber im Alten Testament in frühester Zeit ebenfalls von Menschenopfern die Rede ist (Abraham/Isaak), wird dies als besonders intensive Form der Gottesliebe interpretiert.
Eine besondere Bedeutung in den religiösen Vorstellungen der Azteken spielte der Mythos von der mehrmaligen Zerstörung und Neuschaffung der Welt, was bestimmt mit den in der Umwelt beobachteten Naturgewalten (Vulkane, Wirbelstürme etc.) zusammenhängt.
Dieser Mythos wiederum, der beispielsweise auch auf dem im Haupttempel Tenochtitlans gefundenen Kalenderstein angedeutet wird, führte zu einer besonderen Entwicklung der Astronomie und des Zahlenwesens.
Die Entstehung der Welt erklärten die Azteken mit einem »allgegenwärtigen Gott, der alle Gedanken kennt«. Er war aber so groß, so gewaltig, so allmächtig und wunderbar, dass er vom Menschengeist nicht gedacht werden konnte. Wohl auch, um den verschiedenen Naturerscheinungen gerecht zu werden, erfand man sich dreizehn Hauptgötter und mehr als zweihundert Götter niederen Ranges. Der Wichtigste unter allen war zweifellos Huitzilopochtli, ein Kriegsgott, der sich den Menschen als Kolibri zeigte und mit der Stimme eines Kolibris zu ihnen sprach. Von seiner Vogelgestalt her meinte man darauf schließen zu können, dass es sich ursprünglich um einen mächtigen Häuptling mit einem Tanzmantel oder einem Kopfschmuck aus dem Federkleid dieses Vogels handelte, der schließlich zum Gott erhoben wurde. Als Kriegsgott ist Huitzilopochtli der Sohn der Sonne, der Morgenstern, der seine feindliche Schwester, den Mond, besiegt und das Heer der Sterne vor sich hertreibt. Die Seelen der gefallenen Krieger und der Geopferten aber werden zu Kriegern im Heer der Sterne. Der Mond hingegen ist Urbild der weiblichen Seele und Ort ihrer Rückkehr nach dem Tod des Menschen.
Neben Huitzilopochtli steht Tezcatlipoca oder »der rauchende Spiegel«.
Man könnte sagen, er sei das Böse, auch als ein Doppelgänger Huitzilopochtlis, als Verkörperung des Nachthimmels, des Winters und der Himmelsrichtung Norden. Jedenfalls befürchtete man immer, dass er Verbrechen begehe, die die kosmologische Ordnung entscheidend störe. Deswegen wurde ihm einmal im Jahr der schönste gefangene Krieger geopfert. Angeblich waren seit Anfang der Welt die Götter darum besorgt, den Durst der Sonne mit Blut zu stillen, weil sie sonst das Land verbrennen würde.
Wichtig ist, dass die Azteken Tezcatlipoca und auch ihren anderen Göttern ursprünglich nur Tieropfer, vor allem Hunde und Wachteln darbrachten. Die Menschenopfer – vom Opfer selbst angeblich nicht als Grausamkeit empfunden – kamen erst zweihundert Jahre vor dem Einfall der Spanier auf. Ihre Einführung scheint im ursächlichen Zusammenhang mit der Ausweitung des Reiches gestanden zu haben.
Je größer die Macht der Menschen auf Erden war, desto machtvoller im magischen Sinn mussten auch die Opfer werden. Zuerst waren es jeweils immer nur einzelne Menschenopfer. Die Chronisten berichten später von 20.000 Menschenopfern in einem Jahr, und 1486 sollen bei der Einweihung eines Tempels zu Ehren Huitzilopochtlis sogar 70.000 Menschen ihr Leben gelassen haben.
Man könnte sagen, dass die eigenen Taten und das Verlangen nach Macht Angst vor dem Zorn der Götter hervorriefen. Dies sollte dadurch wiedergutgemacht werden, indem man etwas sehr Wichtiges und Wertvolles an die Götter hingab.
Für eine solche Deutung spricht übrigens auch, dass der beim Großen Opferfest Getötete ein Jahr gehätschelt, verwöhnt, geschmückt, ja regelrecht verehrt wurde.
Überhöhte Besteuerung der Vasallenprovinzen und eine sich immer mehr ins Irrsinnige steigernde Ausweitung der Menschenopfer, sowie eine zunehmende Ausweitung der Rituale gehören bestimmt mit zu den Voraussetzungen für den raschen Sturz des Aztekenreiches nach Eintreffen der Spanier.
Dabei spielte nun die Mythen um eine Gestalt eine wichtige Rolle, deren Wesen und Bedeutung noch heute viele Geheimnisse umgibt, während sie andererseits über den Zusammenbruch des Aztekenreiches hinaus Symbolgestalt indianischen Bewusstseins in Mexiko geblieben ist: Quetzalcoatl.
Bei den Azteken ist er ein Wind- und Regengott. Er verkörperte den Vegetationszyklus. Aber es lässt sich schwer ausmachen, ob da erst ein mächtiger König, ein Mensch mit besonderen Fähigkeiten war, der eben deswegen als göttlich verehrt wurde, oder ob sich ein König der Gestalt oder Maske eines Gottes zur Verstärkung der eigenen Macht und Würde bediente.
Quetzalcoatl taucht schon bei dem zeitlich früheren Volk, bei den Tolteken auf und wird dort auf mythische Weise mit der Gründung der Hauptstadt Tollan in Verbindung gebracht:
»Im Jahr 1 Rohr wurde Ce Acatl Topiltzin, der Priester (1 Rohr Federschlange) geboren, der sich Quetzalcoatl nannte. Und es heißt, dass seine Mutter eine Frau namens Chimalman war. Und so, sagt man, kam Quetzalcoatl in den Schoß seiner Mutter: indem sie einen großen, herrlichen grünen Türkis verschluckte.«
Dieser Mann wird also zum Priesterkönig und zum mythischen Begründer des Toltekenreiches. Seine Ausbildung in der Jugend erhält er in der Priesterschule von Xochicalco, wo man den damals in Mexiko noch ziemlich unbekannten Regengott verehrte.
Er ist es, der Tula oder Tollan gegen beträchtliche Widerstände zur Hauptstadt des Toltekenreiches macht, dessen fünfter Herrscher er gewesen ist.
Historisch setzt man seine Regierungszeit auf 947 bis 999 n. Chr. an, so steht es in der Chronik der Königreiche, und für die Richtigkeit dieser Angabe spricht dass auf einer bildlichen Darstellung Quetzalcoatls sich die Datierung 8 Feuerstein = 980 n. Chr. Findet. Um das Jahr 1000 scheint der heilige König der Tolteken von Feinden oder Widersachern gestürzt worden zu sein. Er konnte entkommen und gelangte auf die Halbinsel Yukatan zu den Mayas, die ihn aufnahmen und verehrten. Die Verschmelzung toltekischer Kunst- und Architekturstile mit denen der Mayas, die sich um diese Zeit vollzieht, könnte hier ihre Wurzeln haben.
Anderen Berichten zufolge wurde der tugendhafte Priesterkönig von Dämonen zur Sünde verführt. Er vernachlässigte seine religiösen Pflichten und verließ, als er seine Verfehlungen erkannte, voll Trauer mit seinem Gefolge die Königsstadt Tollan. Sahagun schildert die Flucht Quetzalcoatls folgendermaßen: »Alle Häuser aus Muschelschalen und Silber, die er besaß, ließ er zerstören, ehe er ging ... Die Tropenbäume verwandelte er in Dornenakazien, und die Tropenvögel ließ er davonfliegen ... Auf seinem Weg ruhte er auf einem Stein sitzend aus. Hände und Füße drückten sich in den Felsen ab – er nannte den Ort Temacpalco. Nach Tollan zurückblickend, musste er weinen. Auf seinem weiten Zug kam er durch die Gegend des Schneegebirges; da starben seine Diener, Bucklige und Zwerge, vor Kälte. Traurig weinte er und stimmte Trauergesänge an. Er blickte in die Ferne zum Schneegebirge Poyauhtecatl bei Tecamachalco (womit der Pico de Orizaba gemeint ist). Endlich am Ufer des Meeres angelangt, ließ er Coatlapechtli, ein ›Schlangenfloß‹, bauen. Darin sitzend wie in einem Schiff, fuhr er über das Meer; niemand weiß, wie er nach Tlapallan, dem ›Land der Morgenröte‹ kam.«
»Danach«, schreibt Hans Helfritz, »verliert sich die Gestalt Quetzalcoatls in einem unentwirrbaren Durcheinander von Mythos und Geschichte. Immer wieder taucht jedoch die Sage auf, dass Quetzalcoatl eines Tages hier als Gott zurückkehren werde.«
Mehr über das Gottwesen Quetzalcoatls erfahren wir in dem Buch von Jose Lopez Portillo. Dort heißt es:
»... er ist Gott der Vorsehung, der Ernährung ... ist Herr der Morgenröte, stellt das Gleichgewicht zwischen Geist und Materie her, ist Herr der Buße. Doch über all seine mythischen Taten ragt jene heraus, mit der Quetzalcoatl nach der vierten Zerstörung der Welt die Menschheit neu erschuf.
Die Götter fürchteten sich vor einer unbewohnten Erde. Wie in allen Religionsmythologien brauchten die Götter den Kult der Menschen. In diesem Mythos wird ein Kampf zwischen Leben und Tod begonnen. Als Quetzalcoatl in die Unterwelt hinabsteigt, um die Menschheit neu zu schaffen, stellt sich Mictlantecuhtli diesem Vorhaben entgegen und erschwert die Aufgabe Quetzalcoatls. Zuerst stellt er ihn auf die Probe und gibt ihm eine Spiralmuschel zu blasen, welche keine Löcher aufweist. Würmer, Bienen und Hummeln eilen Quetzalcoatl zu Hilfe. Als er die kostbaren Knochen in seinen Besitz gebracht hat, fällt er in ein Loch, eine Falle, welche Mictlantecuhtli hatte graben lassen. Die Knochen werden zerstreut und untereinandergeworfen und von Wachteln angepickt. Xolotl, sein Zwillingsbruder oder Nahual, hilft ihm, nach kurzem Tod und Wiederauferstehung nach Tamoanchen zu gelangen. Quilaztli, eine irdische Gottheit, mahlt die Knochen, und Quetzalcoatl tut Buße, indem er sein männliches Glied über ihnen ausbluten lässt; auf diese Art erschafft er die Macehuale. Seinem Beispiel folgen auch alle anderen Götter, welche bereits in Teotihuacan Opfer dargebracht hatten, um die Sonne und den Mond zu schaffen; nun sühnen sie, um die Menschen zu verdienen. So beginnt das Leben in der Fünften Sonne, und aus den genannten Gründen wird der gewöhnliche Mensch Macehualli genannt, was heißt ›der, welcher durch das Opfer [der Götter] verdient wurde‹.«
Damit erweist sich die Funktion Quetzalcoatls als eine ganz ähnliche wie die von Jesus im jüdisch-christlichen Religionszusammenhang. Man begreift damit besser, in welche Aufregungen, Schwierigkeiten und Zweifel die Ankunft Cortes, den die Azteken für Quetzalcoatl hielten, diese gestürzt haben mag.
Die Situation ist durchaus jener vergleichbar, die entstehen würde, wenn in unsere Welt der abermals auferstandene Christus käme. Indem Quetzalcoatl mit der Erschaffung der jetzigen Menschen verbunden ist, die er durch Selbstopfer erreicht hat, klärt sich einmal die Bedeutung der Menschenopfer, und man sieht diese in einem nicht mehr so grausamen Licht. Wie sich der Gott für die Menschen opferte, will sich der Mensch für den Gott opfern.
Darüber hinaus wird auch verständlich, warum, über die Katastrophe des Untergangs des Aztekenreiches hinaus, gerade diese mythologische Gestalt in der Volkstradition und Folklore Mexikos weitergelebt hat. Sie hat mit dem Beginn der indianischen Welt zu tun. Sie steht für einen der wichtigsten religiösen Bezüge dieses Kulturkreises.
Der Mann, der in der Hängematte im Café Altamira liegt, der Mann, dem die Bilder aus der frühen Geschichte jenes Landes durch den Kopf gehen, in das er entflohen ist, um vergessen zu werden und das Paradies zu suchen, kennt das Argument, dass die Spanier nur deshalb Mexiko erobern konnten, weil sie mit ihren Musketen und Feldschlangen das überlegene Waffensystem besaßen.
Aber haben die Waffen wirklich alles entschieden? Wenn ihn diese Frage nicht loslässt, so deshalb, weil hinter ihr eine andere Frage steht, die ihn seit Langem beschäftigt: Wer siegt im Lauf der Geschichte? Wer geht unter? Wer überlebt? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten regeln sich Überleben oder Untergang?
Es fallen ihm Sätze ein, die er kürzlich gelesen hat »Wenn die Azteken auch nicht selten überraschend aus dem Hinterhalt zuschlugen, so hielten sie sich doch an die altüberlieferten Kriegsregeln, und wenn sie Verträge schlossen, so hielten sie sich auch daran. Den Spaniern aber, die einen ›totalen Krieg‹ führten, war jedes Mittel recht.
Sie kannten keine Gnade und keine Duldung einer fremden Religion; für sie gab es nur eine einzige Religion, die Religion ihres Kaisers Karl V. ›Die Mexikaner unterlagen‹, sagte Jacques Soustelle, ›weil ihr Denken, das auf politischem und religiösem Gebiet einer überlieferten Vielheit gehorchte, einem Kampf gegen die Dogmatik der staatlichen und religiösen Einheit nicht gewachsen war.‹«