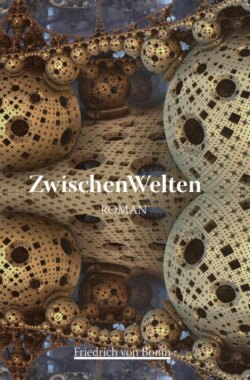Читать книгу ZwischenWelten - Friedrich von Bonin - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.
Als wir in Ungarn ankamen, hatten wir einen großen Teil unserer Soldaten verloren. Krankheit und Tod war im Heer, Seuchen breiteten sich aus und versetzten die Männer in Angst und Schrecken. Aber immer noch war unsere Armee stark genug, Mansfeld und Bethlen zu schlagen. Diese entzogen sich jedoch der Schlacht, Mansfeld ging nach Venedig, wo er starb, Bethlen schloss einen Sonderfrieden mit dem Kaiser und starb kurz darauf ebenso.
Mein Gebieter hatte also gesiegt, ohne eine Schlacht zu schlagen, wurde aber angewiesen, sofort wieder nach Norden zu marschieren, um in den dänischen Krieg einzugreifen. Wieder zog die Armee durch das schon ausgezehrte Land, wieder ernährte Wallenstein seine Soldaten mit den Vorräten, die er in den Dörfern fand und als „Kontributionen“ beschlagnahmte.
Der Krieg finanziert den Krieg.
„Was will der Herr“, sagte der Feldherr in einer der wenigen ruhigen Minuten, die wir auf dem Feldzug in seinem Zelt verbrachten, sein Diktat unterbrechend, „ich bin das Gesetz im deutschen Reich, wo ich hinkomme. Wer würde mich an irgendetwas hindern wollen, so lange ich diese Armee hinter mir habe. Sollen sie sich beschweren, solange ich siege, wird der Kaiser mich halten.“
Und Wallenstein siegte. Er drängte den dänischen König aus Niedersachsen hinaus in sein eigenes Land und belagerte dann, den Krieg ostwärts tragend, Stralsund, das allerdings bis zuletzt widerstand.
Der Kaiser war meinem Herrn dankbar, setzte die Herzöge von Mecklenburg ab und verlieh das Herzogtum an Wallenstein.
Die katholischen Waffen waren siegreich gewesen, allerdings hatten die Neider meines Herrn am kaiserlichen Hof in Wien immer mehr Erfolg. Besonders die Belehnung mit dem mecklenburgischen Herzogtum war ihnen ein Dorn im Auge, hatten sie doch schon missgünstig auf seine Erhebung in den Fürstenstand und den Erwerb des Herzogtums Friedland gesehen. Nun, nachdem die katholischen Waffen so erfolgreich waren, bedrängten sie den Kaiser, einen so mächtigen, aber eben dadurch auch gefährlichen Feldherrn zu entlassen. Besonders Maximilian von Bayern, sein alter Widersacher, wurde immer wieder in Wien vorstellig.
Endlich entschloss sich der Kaiser 1630, dem Drängen nachzugeben und berief den Herzog von Friedland von seiner Feldherrnwürde ab.
Wallenstein war bleich, als ich ihm das Dekret des Kaisers vorlas. Wir waren in Gitschin, seinem Sitz in Friedland, wohin er in kleiner Begleitung geeilt war, um nach dem Rechten in seinem Herzogtum zu sehen.
„Sehe der Herr, was der Dank ist in der Welt“, flüsterte er leise, und, da ich schwieg, „oder ist der Herr der Meinung, dass das echte Dankbarkeit ist?“
„Nein, Fürstliche Gnaden“, antwortete ich nun, noch immer konnte ich mich an die Anrede „der Herr“ nicht recht gewöhnen, „das ist sogar grober Undank.“
„Mag sein“, antwortete er, jetzt wieder kräftiger, „aber der Herr wird sehen, die Waffen werden nicht schweigen und bald wird man mich wieder brauchen.“
Aber auch Wallenstein war undankbar gegen seine Mitmenschen. Kurz nach seiner Absetzung kam die Nachricht, dass de Witte sich in Prag in seinem eigenen Teich ertränkt habe. Sechshunderttausend Gulden sei er zuletzt schuldig gewesen und habe nicht gewusst, woher die zu nehmen seien. Von Wallenstein hatte er trotz immer drängenderer Botschaften nichts bekommen, nichts vom Kaiser, und neue Kredite waren nicht aufzutreiben gewesen. Auch seine eigenen Bankiers, das Haus Seyffenberg und Söhne in Amsterdam, denen er die letzten Kredite mit zwanzig Prozent habe bezahlen müssen und auch bezahlt habe, hätten ihm keine weiteren Fristen mehr eingeräumt. Und so habe de Witte keinen weiteren Ausweg als den Selbstmord gewusst.
„Von der Fahne geflüchtet ist er, der Witte“, war alles, was mein Herr dazu sagte und dann erhob er hohe Forderungen an den Nachlass des gescheiterten Bankiers.
2.
Hans Reinstätten war, immer an der Seite seines Kameraden Karl, in der Armee Wallensteins bis nach Süden gekommen. Alle Seuchen und alle Krankheiten waren an ihnen vorübergegangen, sie erfreuten sich bester Gesundheit, und Hans´ Beliebtheit bei seinem Rittmeister steigerte sich von Tag zu Tag. Nur Wallenstein kamen sie nicht nahe, mal waren sie als reiterliche Vorhut weit voraus geschickt worden, um zu erkunden, mal blieben sie hinter dem Heer zurück, um den Rücken zu decken.
„Macht nichts“, tröstete der Rittmeister, „das wird schon noch mit deiner Beförderung, mach nur so weiter.“
Und so hatte sich Hans Reinstätten an den Kriegsdienst gewöhnt, auch an die Plünderungen der Dörfer, aus denen sie die Steuern eintreiben mussten. An Vergewaltigungen und Morden beteiligte er sich nach wie vor nicht.
Nun waren sie auf dem Rückmarsch nach Norden und Hans fühlte, dass er seinem Heimatdorf wieder näherkam, ohne dass es auf Wallensteins Weg lag. Auf Befehl seines Rittmeisters nahm er an einer Besprechung der Kavallerieoffiziere teil, auf der er auf einer Karte sehen konnte, dass sie etwa vier Tagesritte westlich der Neissemündung vorbeimarschieren würden.
Zwei Nächte lag er schlaflos, ohne Karl von seiner Unruhe zu erzählen.
In der dritten Nacht erhob er sich lautlos und schlich sich aus dem Lager, dahin, wo er sein Pferd, angeblich um es weiden zu lassen, angepflockt hatte. Leise, um die Schläfer nicht zu wecken und die Wachen nicht zu warnen, führte er das Tier etwa einen Kilometer weit weg, Richtung Osten, saß auf und galoppierte in der gleichen Richtung weiter. Er wusste, dort, im Osten, war sein Heimatdorf, war Gesine, und er trieb sein Pferd an, von Sehnsucht und Angst gejagt.
Er war inzwischen erfahren genug, um zu wissen, dass er das Tier alle zwei Stunden eine halbe Stunde im Schritt gehen lassen musste, um es nicht zuschanden zu reiten, aber schwer fielen ihm die langsamen Phasen. Wäre es nur nach ihm gegangen, wäre er im Galopp durchgejagt, immer von der Sorge um sein Dorf und der Sehnsucht nach Gesine getrieben.
Nach drei Tagen, er konnte nur noch einen halben Tag von Neissmund entfernt sein, traf er auf die breite Spur einer großen Zahl von Soldaten, die offenbar vor einem oder zwei Tagen hier marschiert waren, in Richtung Oder. Sie mussten an dem Ort vorbeigekommen sein, wenn sie nicht die Richtung gewechselt hatten. Hans trieb sein Pferd zu einer letzten, verzweifelten Anstrengung an und erreichte nach vier Stunden den Fluss. Leise wie immer plätscherte die Neiße, eine wohltuende Ruhe ging von dem lebendigen Wasser aus, die aber Hans´ Gemüt nicht beschwichtigen konnte, im Gegenteil. Von der Hauptspur des Heeres ging eine Spur von vielleicht fünfzig Reitern die Straße zum Dorf hinaus, Hans kannte das: Man hatte eine Abordnung geschickt. Und als er den Weg weiter ritt, begleitet nur von dem keuchenden Schnauben seines Pferdes, sah Hans die ersten Häuser des Dorfes, nur noch Brandruinen. Kahl ragten die verkohlten Dachsparren in den Himmel, eine stille, aber gewaltige Anklage. Angstvoll ritt er weiter, alle Häuser waren verbrannt, Hans sah die ersten Leichen liegen, auch sie verkohlt, hier ein verstümmelter junger Mann, tot, mit allen Anzeichen der brutalen Folter, der er erlegen war. Hans hielt sich ein Tuch vor die Nase, um den Gestank von Brand und Leichenverwesung aushalten zu können, er ritt durch das Dorf, fand aber kein Anzeichen von Gesine oder einer anderen Frau, auch keine weiteren Leichen. Sie mussten die Frauen verschleppt haben, Hans wusste, was das bedeutete, nämlich ein verlängertes Leiden, er hatte das bei seinen eigenen Kameraden gesehen.
Plötzlich riss er sein Pferd herum und trieb es zum wilden Galopp, zurück, hinaus aus dem Dorf, an den Fluss.
Dort schlug er sein Lager auf in der Hoffnung, das leise Plätschern würde seine Phantasien beruhigen und abtöten. Er konnte nicht essen, er lag auf der Decke, hörte, wie sein Pferd das Gras zupfte, zufrieden schnaubte, aber vor seinem inneren Auge liefen immer die gleichen Bilder ab: Das Dorf, das er erobert hatte, die Kameraden, die mit schiefem Lächeln vor dem Haus warteten, bis sie an der Reihe waren, vermischten sich mit dem Gesicht Gesines, die unter dem Körper eines sie vergewaltigenden Soldaten schrie, weinte, schluchzte, sich wehrte. Er versuchte gewaltsam, an etwas anderes zu denken, vergebens, nach Sekunden waren sie wieder da, die Bilder. Kein Schlaf, bei dem er sich erholen konnte, keine Ruhe vor diesen Bildern.
Im Morgengrauen erhob sich Hans Reinstätten mit stierem Blick, nestelte ein Seil von dem Sattel, ging, das Pferd am Zügel führend, zum Dorf, zu Gesines Elternhaus. Dort fand er einen Hocker und einen stabilen Sparren, der noch nicht verbrannt war. Er knüpfte, immer mit dem gleichen stieren Blick, eine Schlinge in das Seil, darin hatte er Übung, sie hatten Gefangene aufgehängt, warf das Seil über den Sparren, legte die Schlinge um den Hals, stieg auf den Hocker unter dem Sparren und sprang. „Gesine, verzeih mir“, war das letzte, woran er denken konnte.
3.
Der Herzog von Friedland hatte fast prophetisch recht gehabt. Kurz nach seiner Entlassung flammte der Krieg wieder auf. Der schwedische König Gustav Adolf II. betrat den Kriegsschauplatz im deutschen Reich. Um ihn versammelten sich nun die protestantischen Fürsten, einige freiwillig, um der protestantischen Sache zu dienen, andere deshalb, weil die Schweden vor ihren Hauptstädten standen und drohten, sie zu erobern und zu plündern. Mit den Schweden war eine neue Qualität der Gewalt in den Krieg gezogen. Der „Schwedentrunk“ machte die Runde, sie fesselten den Delinquenten, sperrten ihm den Mund mit einem Stück Holz auf und gossen Jauche hinein, bis er erstickte. Nicht, dass diese Art der Folter neu gewesen wäre, auch die bisherigen Kriegsparteien kannten sie, aber die Schweden traten besonders roh und gewalttätig auf.
Ich hörte mit Freuden den Geschichten zu, die nach Gitschin drangen. In denen wurde der schwedische König als ein blonder Kriegsengel dargestellt, gerecht, protestantisch, stark, gütig und eben unbesiegbar. Ich wusste es besser: Er war gewalttätig und roh wie seine Soldaten und ob er wirklich unbesiegbar war, würde mein Herr herausfinden.
Tatsächlich drangen die Schweden auf ihrem Siegeszug bis Süddeutschland vor, bedrängten den bayrischen Kurfürsten und drohten sogar, bis Wien selbst zu stürmen. Schweden waren in der Armee nur wenige, nur der König, sein Kanzler und seine Generale. Sie zogen die deutschen Soldaten an sich, die für die protestantische Sache kämpfen wollten. Ohne den Ruf des glaubensfesten Protestanten hätte der Schwede kaum ein so mächtiges Heer aufbauen können. Und Gustav Adolf hatte von meinem Herrn gelernt. Auch hier finanzierte der Krieg den Krieg, grausamer noch und gieriger als bei dem Herzog von Friedland.
4.
Oft hatte mich der Herr noch gerufen zu den Sitzungen mit Seni, in denen er die Zukunft voraussehen wollte, um planen zu können. Immer hatte ich dieselbe Antwort auf dieselbe Frage gegeben: Nein, die Zukunft könnten wir nicht voraussehen, er nicht, Seni nicht, ich nicht, niemand. Aber niemals gab er sich zufrieden, er schien mit mir zu ringen, er vermutete Kräfte in mir, die ich nie offenbarte und deren Grenzen er daher auch nicht kannte.
Immer deutlicher wurde der Zwiespalt in ihm, immer größer die Aggressivität, der Wille zum Erfolg, immer stärker aber auch die Sehnsucht nach friedlichem Landleben im Kreise seiner Familie. Ich steuerte, wo ich konnte, meines Auftrages eingedenk, und am stärksten konnte ich ihn auf diesen Sitzungen beeinflussen.
„Soll ich dem Kaiser dienen?“, fragte er sich in dieser Zeit. Er war der einzige, der dem Schwedenkönig Einhalt gebieten konnte, aber konnte er das wirklich? „Werde ich siegen?“
Und immer gab Seni die Antwort, die ich verweigerte.
„Fürstliche Gnaden werden siegen“, brummte er, seine Stimme tiefer und voller als sonst, wenn wir die Séancen abhielten, und ich wusste genau, er redete dem General nach dem Mund, er wollte ihn wieder in kaiserlichen Diensten wissen, ich ahnte, es war zu seinem finanziellen Vorteil. Aber ich, auf den Wallenstein hoffte, weil er meine Kraft spürte, ich hielt mich zurück. Ich würde erst eingreifen, wenn eine Entscheidung getroffen wurde, die meinem Auftrag zuwiderlief.
Briefe wechselten hin und her zwischen Gitschin und Wien, zwischen München und Wien und zwischen München und Gitschin. Zwei Jahre habe der schwedische Albtraum jetzt gedauert, niemand könne dem Schweden beikommen, jetzt müsse Wallenstein, der Herzog von Friedland, ihn besiegen.
„Sehe der Herr“, wieder diese Anrede, „jetzt kann ich den Herren die Bedingungen machen. Mein Heer wird von ihnen bezahlt, nicht mehr von mir vorfinanziert. Ich bin entschlossen, ich werde den Vertrag akzeptieren.“
Ich habe die Vereinbarung von Göllersdorf, wie sie genannt wurde, selbst geschrieben, von meinem Herrn diktiert. Darin bekam er alle Vollmachten, Truppen auszuheben, Kontributionen festzulegen, beliebige militärische Operationen durchzuführen und sogar eigenmächtig diplomatische Verhandlungen zu führen, mit wem er wollte.
Die Tinte war noch nicht trocken unter seiner Unterschrift, da begann er seine Vorbereitungen. Er hob Truppen aus in ungekannter Zahl, indem er hohen Sold versprach, und vertrieb als erstes die Sachsen, die sich mit schwedischer Unterstützung in Böhmen festgesetzt hatten. Unmittelbar danach zog er nach Nürnberg und schlug sein Lager vor der Stadt auf, die von den Schweden gehalten wurde. Nürnberg und seine Umgebung hatten nun zwei Heere zu unterhalten, die Stadt litt unter den Armeen in ihrer Nähe, Seuchen und Krankheit taten ein Übriges, bald war Nürnberg entvölkert, wer noch lebte, floh.
Zwei Tage dauerte die Schlacht in der Nähe der Stadt, zwei Tage dröhnten die Kanonen, zwei Tage metzelten sie sich, dann gaben die Schweden die Schlacht auf und zogen ab. Der Nimbus des unbesiegbaren Gustav Adolf war gebrochen, durch meinen Herrn, den General Albrecht von Wallenstein.
5.
Beide Heere zogen nun nach Norden. Noch eine Schlacht schlugen sie, Wallenstein und Gustav Adolf, die Schlacht bei Lützen, in der der schwedische König an einer Kugel starb.
„Ich glaube nicht, dass der Tod ihres Königs sie zum Aufgeben bringen wird“, sagte Wallenstein in einer Beratung mit seinen Generalen, „die Herren werden sehen, der Oxenstierna gibt nicht nach, ich kenne ihn.“
Axel von Oxenstierna, schwedischer Kanzler zu Lebzeiten Gustav Adolfs, hatte nach der Schlacht von Lützen die Führung der Schweden übernommen und zog mit seinem Heer, schlimmer raubend und mordend als vorher, durch Norddeutschland.
Gustav Adolf war tot, die kaiserlichen Waffen mindestens ungeschlagen, aber dennoch: die Strapazen und Aufregungen waren an dem Herzog von Friedland nicht spurlos vorübergegangen.
Er hatte sich in der Schlacht von Lützen noch einmal aufgeschwungen. Seit Jahren verschlimmerte sich sein Leiden, eine schwere Gicht, die sein Leibarzt Seni wissenschaftlich Podagra nannte. Tage-, sogar wochenlang war er an sein Lager gefesselt, er konnte nicht aufstehen. Wenn er sich seinen Truppen zeigen wollte oder musste, wurde er in einer Sänfte getragen. Schon Wochen vor der Schlacht bei Lützen litt er, war bettlägerig. Die Schlacht selbst leitete er von einer Sänfte aus, musste so mit ansehen, wie die Schweden seinen rechten Flügel zerschlugen und kein Entsatz kam, weil sein General, der Graf von Pappenheim, nicht rechtzeitig eingriff.
Da erhob er sich von der Sänfte, ließ sich unter schlimmen Schmerzen auf ein Pferd heben und zeigte sich an dem gefährdeten rechten Flügel seinen Soldaten, sie zum Kampf und zum Aushalten anfeuernd. Dass die Schlacht nicht ganz verloren ging, lag allerdings mehr daran, dass Pappenheim doch noch rechtzeitig eintraf. Er rettete Wallenstein ein ehrenvolles Unentschieden in dem Treffen.
Nach der Schlacht ließ sich der Generalissimus zwei Wochen lang nicht sehen. Ich wurde zweimal zu ihm gerufen, beide Male war sein Leibarzt Seni bei ihm.
Der Herzog war gezeichnet von den schwersten Schmerzen. Sein Gesicht war verzerrt, schweißgebadet diktierte er mir kurze Briefe, um mich dann wieder hinaus zu winken. Düster und drohend war das Gesicht beide Male, versunken in seiner eigenen Welt des Schmerzes.
Er sei jetzt dem Seni vollständig hörig, munkelte man in seiner Umgebung. Wenn der ihn nicht behandele, treibe man Astrologie. Wallenstein sollte verfangen sein in düsteren Prophezeiungen über sein Ende, das ihm Seni als sehr blutig dargestellt habe, so hieß es.
Ich war zu den letzten Sitzungen nicht mehr eingeladen worden, er vertraute mir noch, das wusste ich, aber er glaubte mir wohl endlich, dass ich die Zukunft nicht voraussagen konnte. Der einzige, den er außer Seni zu sich ließ, war sein alter Kammerdiener Jean, der mir aber nichts erzählte.
„Zu traurig ist das, was ich sehe“, antwortete er auf meine Fragen, „als dass ich darüber reden könnte.“
Dann, nach zwei Wochen, wurde ich erneut vor ihn gerufen. Ich traf seinen Arzt bei ihm an, den dunklen, kleinen Italiener, der mich misstrauisch ansah, als wollte ich ihm seinen Patienten entfremden oder mich wieder in ihre Sitzungen drängen. Seni war immer, wenn ich ihn in diesen Tagen sah, in seinen weiten schwarzen Mantel gehüllt, das Gesicht immer noch bartlos, die Stirn niedrig, mit dichten, kohlschwarzen Brauen über den stechenden Augen.
Den ganzen Tag diktierte mein Herr mir und zwischendurch fragte er mich auch, wie es draußen, beim Heer, aussah.
„Der Kaiser wird mich entlassen“, vertraute er mir an, „er hat mir immer misstraut und jetzt, da ich so krank bin, kann ich nicht nach Wien reisen, um meinen Widersachern zu begegnen. Er wird auf sie hören und mich entlassen. Wer wird seine Schuld bei mir bezahlen?“
Immer wieder sprach er davon, er sei alt und krank und werde im Alter arm sein und nicht mehr wissen, wo er wohnen und was er essen solle.
Ich tröstete ihn, wo ich konnte, aber dann warf er mich hinaus, er wolle mit dem Arzt astrologische Sitzungen abhalten, sagte er mir, dabei hätte ich nichts zu suchen.
6.
„Man muss Frieden machen mit ihm“, sagte Wallenstein immer wieder und nahm Kontakt zu Oxenstierna auf. Hin und her gingen Boten zwischen den Schweden und meinem Herrn, aber nie brachten sie Schriftliches, nie Konkretes, beide Parteien trauten sich nicht über Lippenbekenntnisse hinaus.
„Herr Hans Georg von Arnim ist da und wünscht seine Fürstliche Gnaden zu sprechen“, meldete der Kammerdiener. Der General hatte sich auf sein Herzogtum in Gitschin begeben. Er diktierte mir gerade einen Brief an den Kaiser, den ich noch heute mit Boten auf den Weg bringen sollte mit Bitten um Geldmittel. Er sei, so hatte er mir diktiert, nicht mehr in der Lage, die erheblichen Beträge vorzustrecken, die fürstliche Kasse sei erschöpft, weil sie die bis heute entstandenen Ausgaben vorfinanziert habe. Sehr häufig hatte ich derartige Briefe zu schreiben, aber der Kaiser in Wien war in ständigen Geldnöten. Seine Schuld bei dem Herzog von Friedland wuchs ins Unermessliche.
„Arnim?“, sinnierte der Herzog, „ich kenne ihn, er war General unter meinem Kommando, das ist allerdings Jahre her.“
Er hatte üble Schmerzen heute, die Gicht plagte ihn erneut. Die Anfälle kamen jetzt immer häufiger, Wallenstein klagte nicht mehr, aber ich sah, wie er litt, zuweilen krümmte sich der ganze Körper unter den Anfällen. Mich, seinen Vertrauten, konnte er diese Krankheit sehen lassen, er bemühte sich aber, sie vor Fremden geheim zu halten. Ich erwartete daher, dass er den Besucher wegschicken würde, zumal es spät abends war.
„Schicke ihn herein“, sagte er stattdessen, und, zu mir gewandt: „Ich will doch sehen, was der Herr bringt, er ficht jetzt unter Oxenstierna, soviel ich weiß. Was mag er wollen?“
Jean führte einen groß gewachsenen Mann herein, in voller Montur, den Säbel umgeschnallt, die schwere Reiterpistole am Gürtel. Sein Gesicht war unter dem dichten, braunen Vollbart fast nicht zu sehen, aber die großen blauen Augen blitzten herausfordernd.
„Danke, Fürstliche Gnaden, dass Sie mich noch empfangen. Ich hatte gehofft, dass Sie sich meiner erinnern und die späte Abendstunde meinen Besuch nicht hindern würde, zumal der Anlass sich besser für den Abend eignet.“
Er verbeugte sich tief vor dem General.
„Arnim, tatsächlich, Sie sind es, kommen Sie herein und nehmen Sie Platz. Rheidt, mein Schreiber“, stellte er mich vor, „Rheidt, besorgen Sie dem Herrn ein Glas Wein und nehmen mit uns hier Platz.“
Ich gab den Befehl an den Kammerdiener weiter. Kurze Zeit später standen drei Pokale für uns auf dem Tisch, mit dem gelben Tokaier gefüllt, der auf den Ländereien des Generals gekeltert wurde.
„Also gut, Arnim, was führt Sie her?“
„Ich diene, wie Eure Fürstlichen Gnaden sicher wissen, bei den Schweden, direkt als Oberstgeneral bei dem schwedischen Kanzler, Axel von Oxenstierna.“
Wallenstein nickte.
„Dass ich hier bin und so spät abends komme, geschieht mit dem Wissen meines Kanzlers. Fürstliche Gnaden und der schwedische Kanzler haben Boten hin und her geschickt, um den Frieden zu sondieren. Diese Boten haben viel Zeit und Kraft verschwendet, ohne aber dem Frieden auch nur einen Pistolenschuss näher gekommen zu sein.“
Wallenstein nickte erneut zustimmend und abwartend.
„Die Schweden bieten daher Euren Fürstlichen Gnaden einen ehrenvollen Frieden an. Wir werden uns zurückziehen, sobald der Herzog von Friedland sich persönlich für die Bedingungen verbürgt, die wir aushandeln. Wir, das heißt die Schweden und Oxenstierna, wollen nicht mehr mit dem Kaiser verhandeln. Ferdinand II., lässt der Kanzler Eurer Fürstlichen Gnaden sagen, ist für uns nicht mehr vertrauenswürdig. Eine unserer Grundbedingungen ist die freie Religionsausübung in allen Ländern des Deutschen Reiches. Wer katholisch ist, mag das bleiben, wer protestantisch ist, soll das ebenfalls bleiben dürfen.“
Der Besucher machte eine bedeutsame Pause und sah meinen Herrn an. Der schwieg, ich konnte seinem Gesicht nicht ansehen, ob er die Worte des schwedischen Generals positiv oder negativ aufnahm. Vielleicht schwieg er auch nur, weil die Gicht ihm einen Schmerzanfall bescherte.
„Nun?“ fragte Hans Georg von Arnim.
„Der Herr rede weiter“, forderte Wallenstein ihn auf.
„Ich will nicht verhehlen“, fuhr Arnim fort, „dass man auf schwedischer Seite einer entsprechenden Versicherung des Kaisers nicht glauben wird. Zu oft hat Ferdinand sein Wort gebrochen. Wenn aber Eure Fürstliche Gnaden sich mit seiner Armee an die Spitze Böhmens setzen wollte, könnten wir über die Linien verhandeln, hinter die wir uns zurückziehen.“
Arnim sah den Herzog gespannt und fast ängstlich an. Ich verstand ihn. Was er hier vorschlug, war ein Hochverrat des kaiserlichen Generals an seinem Herrn. Wenn dieser General jetzt die Wache rufen, den Besucher festnehmen und erschießen lassen würde, wäre er im vollen Recht. Arnim genoss keineswegs diplomatische Immunität, war er doch ohne Einladung mit dem Vorschlag eines Verrats gekommen. Gespannt erwartete ich die Reaktion des Herzogs. Der schwieg immer noch, lange, und richtete sich dann in seinem Lehnstuhl auf.
„Arnim“, sagte er sehr leise, „was Sie hier vorschlagen, ist gefährlich für Sie und mich. Ich stimme weder zu noch lehne ich ab. Ihre Worte haben nur ich und mein Schreiber hier, Rheidt, gehört. Niemand sonst sollte von diesen Worten wissen.“
„Fürstliche Gnaden verzeihen“, unterbrach ihn der Besucher, „der schwedische Kanzler kennt die Vorschläge, schließlich hat er sie gemacht.“
Wallenstein nickte zustimmend.
„Aber“, sagte er dann, „lassen Sie uns einen Augenblick so tun, als zöge ich Ihren Vorschlag in Erwägung. Was hätten die Schweden uns dann anzubieten?“
„Die Schweden wollen vor allem eines: sich aus Deutschland zurückziehen und den Krieg beenden. Ich will offen sein. Oxenstierna hat Verbindung zum französischen Hof aufgenommen. Der Kardinal Richelieu, der die französische Politik für seinen König Ludwig den dreizehnten bestimmt, will uns gegen die Habsburger in Wien und in Spanien beistehen. Sie sind mit ihren eigenen Protestanten jetzt fertig, hat er uns ausrichten lassen, jetzt könnten wir über Bündnisse sprechen. Der Kardinal hat uns hohe Summen und in Maßen auch Truppen versprochen. Aber wenn wir dieses Bündnis eingehen, müssten wir auf unabsehbare Zeit in Deutschland bleiben und die Schweden sind kriegsmüde.“
Wallenstein nickte nachdenklich.
„Ich habe mir schon gedacht, dass der Kardinal keinen Gefallen an dem Machtzuwachs in Wien hat. Also will Ihr Kanzler das Deutsche Reich verlassen gegen die Zusicherung von Religionsfreiheit?“
„Nicht ganz.“ Arnim beugte sich vor und flüsterte fast, als wolle er von niemandem, auch mir nicht, gehört werden.
„Eure Fürstliche Gnaden geben das Herzogtum Mecklenburg auf, die alten Herzöge werden wiedereingesetzt. Fürstliche Gnaden warten noch einen Moment“, sagte er, da Wallenstein ihn unterbrechen wollte.
„Gegen das Fürstentum Mecklenburg sichert Schweden Böhmen als Ihr Territorium ab und verpflichtet, sich, Fürstliche Gnaden nach Bedarf mit Truppen zu unterstützen. ‚Der Herzog von Friedland sollte sich zum König von Böhmen krönen lassen‘, lässt Oxenstierna Fürstliche Gnaden sagen, ‚wir leisten ihm den Beistand, den er braucht.‘ “
„Der Herr hat immer noch die Linie nicht genannt, hinter die die Schweden sich zurückziehen wollen“, bemerkte Wallenstein jetzt leise, aber scharf.
„Wir werden auf jeden Fall Stralsund behalten“, antwortete Arnim, „und bitten uns einen Ring um Stralsund aus von siebzig Kilometern. Wir werden darüber hinaus die Herzöge von Mecklenburg offiziell mit dem Herzogtum belehnen, so dass dieses Land eigentlich schwedische Provinz bleibt.“
Der Herzog lächelte.
„So, so“, bemerkte er nur, „schwedische Provinz, ich will es glauben.“
Dann schwieg er wieder, diesmal erkannte ich deutlich, dass ein Anfall von Schmerzen ihn quälte.
„Rheidt“, sagte er dann, „der Herr besorge dem Oberstgeneral eine sichere und gute Unterkunft. Arnim, lassen Sie sich einen Tag hier in Gitschin verwöhnen. Morgen Abend bitte ich Sie, finden Sie sich wieder hier ein und ich gebe Ihnen eine Antwort für den Schweden mit.“
7.
Hans Georg von Arnim war in einer der Gästewohnungen sicher und gut und verschwiegen untergebracht und ich saß in meiner Unterkunft und bedachte die Unterhaltung.
Bisher hatte ich den Auftrag, den der Rat der Sieben mir erteilt hatte, zwar ausgeführt, aber nicht wesentlich Einfluss nehmen können. In Kriegszeiten zeigt dieses Zwitterwesen zwischen Engel und Tier, wie viel Tier und wie wenig Engel es ist, ohne dass es von unserer Seite dazu ermuntert werden müsste. Hier aber bot sich ein reiches Tätigkeitsfeld. Der Schwede bot Wallenstein die Königskrone, allerdings um den Preis des Verrates am Kaiser. Ich sah voraus, dass diese Entwicklung den Krieg tatsächlich sehr schnell würde beenden können. Wallenstein war der einzige Feldherr weit und breit. Erhob er sich gegen den Kaiser, war der wehrlos gegen einen frisch gekrönten König von Böhmen namens Albrecht von Wallenstein. Er musste Frieden geben und das war das, was Wallenstein wollte. Er war müde geworden mit der Zeit, geplagt von Ängsten um die Zukunft, die er sich regelmäßig voraussagen ließ und geplagt vor allem auch von der fortschreitenden Gicht, die ihn manchmal fast bewegungsunfähig werden ließ.
War Wallenstein erst König von Böhmen, würden ihn die böhmischen Stände schnell anerkennen. Die Schweden würden ihn unterstützen, er hätte die Gunst von Richelieu in Frankreich und des englischen Königs. Der Kaiser müsste Frieden geben, wenn sein ehemaliger General den Frieden forderte. Ein gewaltiges Werk hätte er vollbracht. Wie sollte er nicht annehmen?
8.
Ich kannte ihn dennoch nicht gut genug.
„Sage der Herr doch dem schwedischen Kanzler, dass ich mir seine Vorschläge überdenken werde“, sagte Wallenstein am nächsten Abend. Sie saßen wieder in seinem Arbeitszimmer, wieder an dem schweren, eichenen Besprechungstisch, an dem sie schon gestern gesprochen hatten. Mir hatte mein Herr einen harten Stuhl an seinem Schreibtisch in der Nähe zugewiesen. „Höre der Herr heute Abend gut zu“, hatte er mir gesagt, „ich will hinterher ein geheimes Protokoll von ihm haben.“
„Aber schon jetzt kann der Herr dem Schweden ausrichten, dass ich ein mecklenburgisches Lehen an die alten Herzöge nicht akzeptieren werde. Ich gebe Mecklenburg auf, ich benötige es nicht. Aber ich gebe es nur auf zugunsten der ältesten Söhne der alten Herzöge, nicht zugunsten der Alten selbst. Die beiden Brüder sind mir zu sehr auf schwedische Interessen bedacht, der Schwede hätte dann einen riesigen Brückenkopf. Er bekommt die Stadt Stralsund, das muss ihm ausreichen.“
„Fürstliche Gnaden, das wird eine bittere Pille sein, die Oxenstierna schlucken muss. Er legt sehr viel Wert gerade auf die Provinz Mecklenburg.“
„Das muss er sehen, wie er die Bedingung akzeptiert“, sagte Wallenstein energisch, „aber bitte, richte der Herr doch dem Schweden auch sehr klar aus, dass ich seine Worte und seinen Friedensvorschlag bedenke, nicht, dass ich ihm zustimme.“
Damit musste sich Arnim zufriedengeben. Noch bis spät in die Nacht hinein versuchte er, eine sicherere Antwort besonders über die Absichten Wallensteins zu erhalten, allein, der General hielt sich bedeckt. Nein, das könne er nicht jetzt entscheiden, nicht heute und morgen und nicht diese Woche. Er werde sich mit Arnim in Verbindung setzen, wenn er wisse, wohin er wolle.
Damit schied Hans Georg von Arnim aus Gitschin.
„Hat der Herr alles gehört, was gesprochen wurde?“, fragte mich der General, als der Besucher weg war.
Ich hatte mir, so gut es gehen wollte, einzelne Notizen gemacht, erschwert dadurch, dass die hohen Herren fast alle Lichter gelöscht und im Halbdunkel verhandelt hatten. Auf dem Schreibtisch, in dessen Nähe ich gesessen hatte, war nur eine einzige Kerze angezündet worden.
„Ich habe alles gehört, Fürstliche Gnaden“, antwortete ich, „das Protokoll werden Sie morgen früh auf dem Schreibtisch finden.“
„Ist der Herr wahnsinnig?“, polterte er, „nichts wird auf den Schreibtisch gelegt, der Herr wird sich morgen um neun bei mir melden und mir das Papier direkt in die Hand geben. Er wird auch keine Kopie schreiben, etwa für das Archiv oder für andere Zwecke, ich hoffe, der Herr hat das verstanden?“
Ich nickte, raffte meine Papiere zusammen und ging unter tiefer Verbeugung rückwärts aus dem Raum.
In meinem kleinen Zimmer angekommen, machte ich sofort Licht und setze mich an die Arbeit. Zuerst schrieb ich das Protokoll, das Wallenstein verlangt hatte und das ich ihm morgen früh in die Hand geben sollte. Dann saß ich da und dachte nach. Hatte nun der General seinen Kaiser verraten oder nicht? Im Grunde hatte er weder in dem Austausch der Boten noch in den Besprechungen gestern und vorgestern sich zu den Vorschlägen des Schweden geäußert, also einen Verrat noch nicht begonnen. Auch hatte der Vorsichtige nur mündliche Botschaften ausgetauscht, kein geschriebenes Papier gab es über die Verhandlungen, nichts, was nachweisbar gewesen wäre.
Andererseits: Allein die Tatsache, dass Wallenstein sich die verräterischen Vorschläge der Schweden angehört hatte, war das nicht schon Verrat am Kaiser? Zwar hatte er sich in der Göllersdorfer Vereinbarung zu seinem zweiten Generalat ausdrücklich ermächtigen lassen, auch diplomatische Verhandlungen mit ausländischen Mächten zu führen, aber der Hof in Wien war misstrauisch gegen den General, immer gewesen. Wenn der Kaiser oder seine Ratgeber von dem Besuch Arnims und den Verhandlungen erfuhren, würden sie Wallenstein mehr als jemals zuvor misstrauen. Der Kaiser müsste ihn absetzen, dafür würden schon der Bayer und die anderen Edlen am Hofe sorgen. Und dann wäre der Friede auf Jahre hinaus unmöglich, weil die Schweden mit dem Kaiser nicht verhandeln wollten.
Aber wie sollte der Kaiser, wie seine Ratgeber von diesen geheimen Verhandlungen erfahren? Arnim würde schweigen, ebenso der schwedische Kanzler und mein Herr, der General. Ich war der einzige außer ihnen, der davon wusste und ein Stümper wäre ich, wenn ich dieses Wissen nicht nutzte, den Frieden zu verhindern. Die Frage war nicht, ob ich meinen Herrn verriet, sondern an wen.
Es verbot sich von selbst, dass ich unvorsichtiger als der General war, natürlich durfte auch von mir nichts Schriftliches existieren. Aber an wen konnte ich mich wenden, wenn ich nicht schrieb? Dass ich an den kaiserlichen Hof reiste, um dort von den Verhandlungen Wallensteins zu berichten, kam nicht in Frage, eine solche Reise hätte ich nicht rechtfertigen können. Also musste ich hier, in Gitschin, jemanden finden, dem ich mich anvertrauen konnte. Ich ging in Gedanken die Menschen in der Umgebung des Herzogs durch:
Die Generale Ihlo und Kinski kamen nicht in Frage, zu treu waren sie dem Herzog, zu oft hatte ich sie über die kaiserliche Politik herziehen hören. Das gleiche galt für Piccolomini den Älteren: Er war ein sehr guter Freund Wallensteins und wäre daher schwer zu überzeugen gewesen. Andererseits war gerade Piccolomini nicht nur meinem Herzog, sondern auch dem Kaiser in Wien treu ergeben.
Und dann waren da die offenen Neider meines Herrn, die Generale Aldringen und Gallas. Sie arbeiteten am Hofe gegen Wallenstein, wo sie nur konnten und wären sicher begeistert sofort nach Wien abgereist, wenn ich sie informiert hätte. Aber würde man ihnen in Wien trauen, würde der Kaiser Wallenstein absetzen nur, weil Gallas und Aldringen, seine Feinde, ihn anklagten? Zu oft schon hatten sie sich über den General beschwert. Nein, überlegte ich, es kam hinzu, dass ich die beiden für sehr beschränkt hielt. Sie mochten für ihre Stellen als Truppenbefehlshaber genügend Verstand haben, aber eine Intrige einfallsreich auszuführen, das würden sie nicht können.
Also Piccolomini.
Hin und her überlegte ich, wog immer wieder die Argumente ab. Sein Sohn galt als zukünftiger Schwiegersohn meines Herrn, und dann hatte Wallenstein den Piccolomini erst kürzlich wegen seiner Verdienste in der Schlacht bei Steinau zum General befördert. Grund genug also für den frischgebackenen General und zukünftigen Schwiegervater, Wallenstein treu zu sein.
Ich musste ihm daher sehr deutlich machen, dass ich, gäbe er meine Information nicht an den Kaiser weiter, andere Wege finden und dann auch seine Verstrickung nennen würde. Nur: Wenn Piccolomini nicht zum Kaiser, sondern zum Herzog von Friedland gehen würde, dann wäre zwar nicht mein Leben gefährdet, ans Leben konnte mir keiner dieser Menschen, aber meine Mission wäre kläglich gescheitert.
9.
Kurz nach dem Besuch Arnims brachen wir auf von Gitschin nach Pilsen, wo Wallenstein den Winter verbringen wollte. Ein riesiger Tross zog durch das Land, nach Südwesten, an Prag vorbei, bis Pilsen, wo der Hof des Herzogs Anfang Dezember ankam und sich einrichtete.
Am Morgen nach der Ankunft war ich entschlossen. Ich wusste, dass Piccolomini Ende der Woche in Pilsen angekommen war, um dem Herzog Bericht zu erstatten.
Schon die Reise war beschwerlich gewesen, der Winter hatte in diesem Jahr sehr früh, schon Mitte November eingesetzt. Wallenstein hatte die Schweden im Oktober trotz der laufenden Verhandlungen noch einmal geschlagen, bei Steinau an der Oder, und den gefürchteten schwedischen Heerführer Heinrich von Thun gefangen genommen, ihn nach kurzer Zeit allerdings zum Entsetzen seiner Generale und des Kaiserhofes wieder freigegeben. Er hatte seinen Vertrauten Oktavio Piccolomini zum Hof geschickt, um Bericht zu erstatten und der war nach kurzer Zeit wieder zurückgekommen.
Am Mittag suchte ich ihn daher in seinem Haus, das er in Pilsen bewohnte, auf.
„Herrn General Piccolomini möchte ich sprechen“, sagte ich seinem Diener nur. Ich war zu bekannt hier, als dass ein Diener mich abweisen würde und so stand ich nach kurzer Zeit vor dem frisch beförderten General.
„Nun, Rheidt“, sprach dieser mich leutselig an, nachdem er das Schriftstück, an dem er arbeitete, mit seiner Unterschrift versehen hatte, „was führt Sie zu mir? Schickt Wallenstein Sie?“
„Nein, Herr General“, antwortete ich langsam, „ich komme in einer sehr persönlichen Angelegenheit, die die Zeit des Herrn General in Anspruch nehmen wird.“
„Na, dann setzen wir uns doch“, sagte er, erhob sich hinter seinem Schreibtisch und führte mich zu dem Tisch, der am Fenster stand. General Oktavio Piccolomini war in der Zeit Mitte der fünfzig, ein korpulenter Herr von etwas lärmendem Wesen, aber freundlich und verständnisvoll, wenn er nicht in der Schlacht war. Um seine Augen hatten sich tiefe Lachfalten gebildet, die darauf hindeuteten, dass er gerne fröhlich war.
Als ich angefangen hatte, war allerdings alle Freundlichkeit aus seinem Gesicht verschwunden.
„Wissen Sie, was Sie da sagen, Rheidt?“, fragte er ernst, fast finster, „Sie kommen hierher und werfen Ihrem Brotherrn Hochverrat vor. Wenn das zutrifft, was Sie sagen, wird er sterben müssen, das ist der normale Gang der Dinge.“
Ich senkte den Blick.
„Ich weiß wohl, dass er in Gefahr ist“, antwortete ich, „ich hatte gedacht, dass Sie eine solche Folge verhindern könnten, wenn Sie zum Kaiser gingen. Sie haben doch Einfluss.“
„Sie wollen also allen Ernstes, dass ich damit zum Kaiser gehe?“, fragte er, und seine Augen bohrten sich in meine, „Sie müssen wissen, dass es dann mit ihm als oberster General vorbei ist im Heer des Kaisers, und damit auch mit Ihrer Stellung als Schreiber.“
Jetzt hatte ich ihn da, wo ich ihn haben wollte. Das war es, als oberster General, als Generalissimus, kam Wallenstein dann nicht mehr in Frage und ich sah hinter der Stirn Piccolominis die Frage aufleuchten, wer denn wohl sein Nachfolger werden würde. Er selbst konnte durchaus ein Anwärter auf die Nachfolge sein.
„Haben Sie den Herzog von Friedland denn darauf angesprochen, dass Sie zu mir kommen würden?“
„Auf keinen Fall!“, rief ich aus, „der General darf nicht wissen, dass ich hier bin, er hat mir ans Herz gelegt, nichts über die Besprechung mit dem Herrn von Arnim verlauten zu lassen. Nein, er darf nicht wissen, dass ich Sie informiert habe.“
„Gut, ich sehe, Sie wollen ihm nichts Böses, sonst wären Sie ja zu seinen Feinden gegangen, nicht zu mir“, sagte der General, „jetzt verlassen Sie mich, ich muss nachdenken, was ich beginnen soll. Sie werden es hören.“ Und damit war ich entlassen.
Den ganzen Tag hörte ich gar nichts. Mein Herr ließ mich nicht rufen, Piccolomini gab mir keine Nachricht, ich saß einsam in dem mir zugewiesenen Zimmer und wartete.
Erst am nächsten Morgen hieß es, der General Piccolomini sei in eiligen Geschäften nach Wien abgereist, trotz des schlechten Wetters und der vom Neuschnee aufgeweichten Wege und Straßen.
10.
Der Winter hatte mit aller Härte eingesetzt. Es gab wenig zu tun in Pilsen, wo wir die kalte Zeit verbrachten. Wenig Besucher kamen und gingen, eingeschneit waren alle Wege. Wallenstein verhielt sich mir gegenüber wie immer, nichts war verändert. Aber so wie keine Boten aus Wien kamen, um meinem Herrn Weisungen des Kaisers zu bringen, so schickte auch der schwedische Kanzler keine Boten, keine Nachrichten. Es war in diesem Winter, als seien wir von der Welt abgeschnitten.
Wallenstein hatte im November vor dem Aufbruch noch einmal seine Generale um sich versammelt. Er hatte das Misstrauen des Kaisers gespürt, vor allem, nachdem er Thun freigelassen hatte. So hatte er die Generale veranlasst, ein Treuepapier zu unterschreiben, in dem sie den Kaiser untertänig baten, ihn, Wallenstein, an der Spitze des Heeres zu lassen. Diese Botschaft war die letzte, die nach Wien abgegangen war.
Mitte Januar taute es plötzlich. Der Schnee wurde grau und schmolz, die Sonne brach durch und wärmte das Land, so dass die Menschen wieder reisen konnten, allerdings war allen bewusst, dass jeden Moment der Frost wieder einsetzen konnte.
Mit dem Tauwetter kamen sie aus Wien:
Oktavio Piccolomini, dann die Generale Johann Graf von Aldringen und Matthias Gallas, der frisch vom Kaiser ernannte Graf, beide wie immer mit scheelen Blicken, Christian Freiherr von Ihlo und Wilhelm Graf Kinski, die schneidigen Reitergenerale, besonders Kinski, schlank wie eine Gerte, nicht übermäßig groß, aber zäh.
Einer nach dem anderen trafen sie ein, die einen von Wallenstein höflich, die anderen mit freundschaftlicher Herzlichkeit empfangen. Der Herzog von Friedland hielt sich im Übrigen zurück in diesen Tagen, kaum verließ er seine Räume, er litt furchtbar unter der Gicht. Fast bewegungsunfähig lag er mehr, als er saß, in seinem Lehnstuhl, diktierte wenig, las wenig und verbrachte ganze Tage im Dunkeln, jeden Kontakt sich verbietend.
Desto mehr trafen sich seine Offiziere. Ihlo und Kinski unterhielten einen Zirkel, dem die meisten Obersten aus Wallensteins Armee angehörten. Zwischen zehn und zwanzig hohe Offiziere trafen sich fast täglich, sei es zu Wein und Spiel, sei es zu ernsthaften Gesprächen. Ihnen schloss sich häufig Piccolomini an, der mich keines Blickes würdigte, mich nicht beachtete. Ich hing an jeder seiner Gebärden: Was hatte er versucht, was erreicht?
An anderer Stelle trafen sich Wallensteins Gegner, Aldringen und Gallas, die ebenfalls einige der nachrangigen Offiziere um sich versammelt hatten. Diplomaten schlossen sich dem zweiten Kreis an, frisch aus Wien angekommen und die neuesten Nachrichten bringend. Bald drangen Neuigkeiten aus diesem Kreis nach außen, Gerüchte.
Der Herzog sei seines Amtes als Generalissimus vom Kaiser enthoben, hieß es, der Kaiser habe eine Anklage gegen ihn wegen Hochverrats erhoben. Auch der Herzog hörte die Gerüchte.
„Unsinn, Rheidt“, knurrte er, wenn ich ihn, scheinbar besorgt, darauf ansprach. „Der Herr wird sehen, das ist alles Unsinn. Nie wird der Kaiser mich absetzen, und schon gar nicht mich des Verrates anklagen. Wo sollte ich den Kaiser verraten haben, der ich doch sein Heerführer bin?“
Aber die Gerüchte verstärkten sich: Nicht nur angeklagt sei der Herzog worden, er sei bereits verurteilt, streuten seine Gegner aus. Der Kaiser habe seinen Tod verfügt, der Vollstrecker sei bereits unterwegs.
Nun endlich rief mich auch Piccolomini.
„Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben mit Ihrer Erzählung“, sagte er mit finsterem Gesicht, als ich vor ihm stand. „Ich bin vom Kaiser abgesandt worden, um Wallenstein die Absetzung von dem Amt des Generalissimus bekannt zu geben.“
Überrascht atmete ich ein.
„Und wer ist sein Nachfolger?“, fragte ich.
„Sie haben wohl gedacht, das würde ich sein?“ Jetzt hellte sich sein Gesicht etwas auf. „Nein, bin ich aber nicht. Der Kaiser hat mich zu seinem Generalfeldmarschall ernannt, aber Generalissimus und Nachfolger Wallensteins wird Großherzog Ferdinand sein, der Sohn des Kaisers. Hören Sie, Rheidt, Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, Ihr Leben zu retten. Halten Sie sich ruhig und halten Sie sich vom Herzog von Friedland fern. Er ist zum Tode verurteilt, seine Umgebung wird mit ihm sterben, also bleiben Sie weg. Der Kaiser hat mich ausdrücklich ermächtigt, Sie zu schonen, weil Sie zu mir gekommen sind. Und jetzt nehmen Sie Urlaub von Ihrem Herrn und verschwinden Sie! Und wehe, der Herzog erfährt von unserer Unterhaltung auch nur einen Ton.“
Ich ging direkt in meine Räume und packte einige Sachen zusammen, da erschien sein Kammerdiener.
„Herr Rheidt, Sie sollen gleich zum Herzog kommen, es gibt zu schreiben“, meldete er.
„Sagen Sie Seiner Fürstlichen Gnaden, dass ich sofort komme“, ließ ich ihn ausrichten, beeilte mich aber keineswegs.
Am Mittag hatte er mich rufen lassen, aber schon eine Stunde später erhielt ich seinen Befehl, ich solle mich bereit machen, Wallenstein und der Hof gingen nach Eger, Aufbruch noch heute Nachmittag.
Er hatte also die Gefahr doch gespürt, aber ich befolgte den Befehl nicht. Heimlich blieb ich in Pilsen und hoffte, dass niemand mich suchen werde, waren sie einmal aufgebrochen.
Am übernächsten Tag kam ein Bote aus Eger:
Sie hatten erst seine Getreuen erschlagen, hieß es, Ihlo, Kinski und Trcka und dann waren sie am Abend in seine Gemächer eingedrungen. Der schwer gichtkranke Mann habe sich nicht gewehrt, hieß es, sie hätten ihn in seinem Zimmer auf seinem Lehnstuhl erschlagen.
Für mich war nichts mehr zu tun. Ich verschwand.