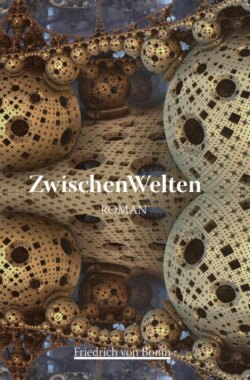Читать книгу ZwischenWelten - Friedrich von Bonin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеZweites Buch:
Wallenstein
1625
1.
Langsam und gemessenen Schrittes ging ich über die große alte Stadtbrücke, die die Moldau überspannte, ich sah nicht die Figuren aus dem Zauberreich, die sie zierten, ich sah nicht das Wasser des Flusses, das unter mir mit stetem Gurgeln dahin strömte und ich achtete nicht auf die Menschen, die mir entgegenkamen. Fest hielt ich das Gesicht auf die andere Seite des Flusses gerichtet, auf die Kleinseite dieser großen Stadt Prag, wo gleich hinter dem Fluss der Palast des Generals Wallenstein lag, des großen Feldherrn Albrecht von Wallenstein, Herzog von Friedland. Zum Generalissimus war er vom Kaiser Ferdinand dem Zweiten in Wien ernannt worden, ein Titel, der allein ihm vorbehalten war.
Der Sommer dieses Jahres 1625 hatte viel Regen gebracht, Überflutungen sogar, aber jetzt strahlte die Sonne seit einer Woche mit großer Kraft, obwohl der September sich seinem Ende näherte. Die Bäume hatten wegen der vielen Niederschläge noch nicht einmal angefangen, ihre Blätter zu färben, dick belaubt und dunkelgrün spendeten sie Schatten, als ich jetzt die Brücke verließ und auf die Allee einbog, die zum Palast des Generalissimus führte. Beeindruckend lang und breit war sie, gerade auf den Haupteingang zulaufend, von riesenhaften Eichen gesäumt, unterbrochen allenfalls von ein paar Buchen und Tannen. Mit meinen dünnen Festtagsschuhen hatte ich Mühe, über das holperige Kopfsteinpflaster zu laufen, widerstand aber der Versuchung, neben der Straße auf dem Gras zu gehen, obwohl mein linker Fuß, der leicht behindert ist, mir erhebliche Schwierigkeiten bereitete. Ich wollte nicht gleich zu Beginn schlecht auffallen, war aber doch erleichtert, als ich hinter mir das laute Hufgeklapper von Pferden hörte, dem das Rollen des von ihnen gezogenen Wagens folgte. Erleichtert trat ich zur Seite auf das Gras und sah mich um. Eine prächtige Kutsche, von vier kohlschwarzen Wallachen gezogen, rollte an mir vorbei, dichte Vorhänge vor den Kutschfenstern verweigerten mir jeden neugierigen Blick auf die Insassen. Ich sah ihr einen Augenblick nach, wie sie über das raue Pflaster dahinglitt, wie die langen starken Federn des Wagens die Unebenheiten ausglichen und wie sie dann in einem schönen Bogen vor dem Haupteingang vorfuhr und hielt. Langsam nahm ich meinen Weg wieder auf und schritt auf das Schloss zu, um die Allee kurz vor dem Haupteingang des Palastes zu verlassen und in einen kleinen Weg nach rechts abzuzweigen, der, wie ich annahm, für die Dienstboten vorgesehen war. Bescheiden hielt ich mich am Rand des Weges, der nicht gepflastert war und ging auf die Nordecke des riesenhaften Gebäudes zu. Tatsächlich, an dieser Seite gab es eine kleine Tür, an die ich vorsichtig klopfte.
„Ja bitte?“ Ein alter Diener in der rotbraunen Livree des Herzogs lugte durch einen kleinen Spalt und sah mich an.
„Was wünschen Sie?“
„Ich heiße Jakob Rheidt und bin zu Seiner Fürstlichen Gnaden um vier Uhr bestellt, um mich als Schreiber zu bewerben.“
„Gut, kommen Sie herein, ich werde Sie dem Kammerdiener melden.“
Mit diesen Worten öffnete er die Tür ganz und ließ mich hinein, um mir gleich dahinter eine schmale Bank zu weisen, auf der ich warten sollte. Hier im Haus, auf dem dunklen Flur, war es angenehm kühl. Ich wusste, ich war zu früh, und richtete mich auf eine längere Wartezeit ein.
2.
Ich gab mich bescheidener als ich mich fühlte. Schließlich war ich vom Rat ausgewählt und abgesandt worden, um als Schreiber des Generals zu wirken.
„Setze sich der Herr und schreibe er, was ich ihm ansage“. Ich hatte nicht sehr lange warten müssen und stand zum ersten Mal vor dem berühmten General Albrecht von Wallenstein. Er war zu dieser Zeit von der Gicht, die ihn in späteren Jahren so plagte, noch nicht allzu sehr befallen, ein nicht großer, sehr vornehmer Herr mit braunen, alles durchdringenden Augen und dunklen Haaren. Sein an sich schon schmales Gesicht wirkte durch den Schnauzbart und den nach unten spitz zulaufendem Kinnbart, der neuerdings sehr in Mode war, noch länger, als es ohnehin schon war. Scharf fasste er mich ins Auge, bevor er mich an den Tisch befahl und mir irgendeinen unbedeutenden Text in die Feder diktierte.
„Der Herr hat eine sehr saubere Schrift“, lobte er mich. Zum ersten Mal hörte ich diese äußerst unpersönliche Anrede, die er auch gegen ihm sehr vertraute Personen gebrauchte.
„Wenn Eure Fürstliche Gnaden mich als Schreiber anstellte, könnte ich Ihre gesamte Korrespondenz führen“, so pries ich mich an, und tatsächlich rief er mich am nächsten Tag zu sich, um mir mitzuteilen, dass ich für ihn arbeiten solle.
Tag für Tag kam ich nun morgens um sechs Uhr pünktlich zu ihm in sein Schloss in Prag, wo er sich in diesem Winter aufhielt. So viel war zu schreiben, dass der General mir einen Monat später befahl, endgültig zu ihm zu übersiedeln, damit ich immer für ihn bereit sei.
Was gab es alles zu tun! Seit dem Frühjahr des Jahres war mein Gebieter als oberster General über das Heer des für die katholische Sache kämpfenden Kaisers eingesetzt und deshalb in lebhafter Korrespondenz mit dem Hof. Auch war er bestrebt, den Überblick über seine reichen Ländereien zu behalten. Zwar hatte er überall Verwalter eingesetzt, die sein Vertrauen genossen und die nach meinem Eindruck ihren Dienst auch vergleichsweise ehrlich verrichteten, aber der Generalissimus war ein pedantischer Wirtschafter, der alles bis in die kleinsten Anschaffungen für die Bediensteten kontrollierte und darüber ausgiebigen Briefwechsel führte, den ich zu erledigen hatte.
Und dann wollte die Armee, die er kurz nach meiner Einstellung aufzubauen begann, verwaltet werden. Auch da gab es zwar die Offiziere, die sich um ihre Bereiche kümmerten. Aber General Wallenstein war auch in militärischen Dingen äußerst penibel, keine Maßnahme durfte ohne Prüfung durch ihn und ohne seine Genehmigung durchgeführt werden.
Langsam arbeitete ich mich in die riesige Korrespondenz ein. Der Krieg, der seit 1618 immer wieder im deutschen Reich aufflammte, war 1625 fast ganz zum Erliegen gekommen. Alle Parteien schienen kriegsmüde, bis auf den Kaiser Ferdinand in Wien, der aber seine Kasse vollkommen verausgabt hatte und deshalb nicht in der Lage war, ein neues Heer aufzustellen. Dennoch wollte er keinen Frieden.
Dem an Bargeld armen, aber kriegslüsternen Kaiser war das Angebot Albrechts von Wallenstein daher hoch willkommen, für den Kaiser und die katholische Sache auf eigene Kosten ein Heer aufzubauen.
„Fünfzigtausend Mann will ich Eurer Majestät rekrutieren“, soll er geprahlt haben und auf die Frage, ob nicht auch zwanzigtausend ausreichend seien, geantwortet haben: „Je größer meine Armee ist, desto leichter schlage ich den Feind. Aber die Soldaten sollen die kaiserliche Schatulle kein Goldstück kosten. Ich bezahle sie allein.“
Das scheint dem Kaiser gefallen zu haben, besonders, dass der General sein Heer in protestantische Länder führen wollte, nicht in katholische, und so gab er nach monatelangen Verhandlungen Wallenstein alle Vollmachten, Soldaten zu werben, Steuern einzutreiben zu ihrer Unterhaltung und Krieg im Namen der katholischen Majestät zu führen. Dazu verlieh er dem Ehrgeizigen den Titel des Generalissimus, um den er gebeten hatte. Eine Armee von vierundzwanzigtausend Soldaten sollte er aufstellen dürfen.
Kurz nachdem ich sein Schreiber wurde, hatte Wallenstein mit dem Aufbau des Heeres begonnen. Als Sammelplatz hatte er die große Ebene fünfzig Kilometer nordwestlich von Prag ausersehen. Von da schwärmten Tausende Werber aus, die junge Männer suchten, die bereit waren, gegen ein Handgeld und das Versprechen eines anständigen und regelmäßig gezahlten Soldes für den Kaiser und den Generalissimus in den Krieg zu ziehen.
Und sie hatten Erfolg, die Werber Wallensteins. Sie waren von bewaffneten Trupps begleitet, deren Schutz sie nötig hatten, führten sie doch eine Menge Goldes bei sich. Jedem, der bereit war, den Fahnen des Generalissimus zu folgen, boten sie einen Monatssold von zwanzig Gulden an, pünktlich am Ende eines Monats zahlbar und ein sofortiges Handgeld von drei Monaten, also sechzig Gulden. Vor allem in den Städten hatten sie Erfolg, in denen sich junge Männer aus den unterschiedlichsten Gründen herumtrieben, Bauernsöhne, deren ältere Brüder den elterlichen Hof geerbt hatten und die in die Stadt geflohen waren auf der Suche nach Lohn und Brot, die sie zu Hause nicht finden konnten. Handwerksburschen ohne Arbeit, ausgespuckt von der vom jahrelangen Krieg zerstörten Wirtschaft und Kriminelle, die froh waren, den polizeilichen Nachforschungen zur Armee entfliehen zu können.
Aber auch auf dem Lande fanden sie bereitwillige junge Männer, die keine Arbeit hatten, weil sie keine fanden oder auch keine haben wollten, unglücklich Verliebte oder auch nur Abenteuerlustige, denen es in den Dörfern zu langweilig wurde. Sie alle nahmen gierig die sechzig Gulden und sammelten sich an den vorgegebenen Plätzen, um zur Armee zu stoßen.
Und da, wo sich freiwillig zu wenig Soldaten fanden, da fingen die Werbertrupps auch die Männer ein, junge und nicht so junge, und hielten sie mit Waffengewalt fest, drückten ihnen ihre sechzig Gulden in die Hand, fesselten sie dann und nahmen sie mit.
Als ich als Schreiber zu Wallenstein kam, hatte er auf diese Weise eine Armee von achtzehntausend Mann zusammengebracht, die im Nordwesten Böhmens auf den Abmarsch warteten.
Ich hatte sehr schnell das Vertrauen des sonst immer Misstrauischen gewonnen.
„Der Herr kennt meine Korrespondenz“, sagte er eines Tages, „lange kann ich die Armee nicht mehr unterhalten. De Witte, mein Bankier, macht immer mehr Schwierigkeiten, ich glaube, er bringt die Summen nicht mehr zustande.“
„Fürstliche Gnaden müssen ihm eben mehr Sicherheiten geben“, erwiderte ich, „Wenn de Witte seine Investoren überzeugen kann, dass er sein Geld von Euren Fürstlichen Gnaden zurückbekommt, wird er auch wieder Kredit nehmen können.“
„Wie das?“ fragte der Fürst und sah mich scharf an.
„Fürstliche Gnaden wird doch bald zu Ihrem Heer abreisen und dann in den Krieg ziehen?“, fragte ich.
„Natürlich, dazu habe ich sie ja ausgehoben, in zwei Monaten werden wir soweit sein.“
„Und wird Fürstliche Gnaden Ihren Soldaten das Plündern erlauben?“
Wieder musterte er mich erstaunt. „Natürlich, so ist es gutes Soldatenrecht.“
„Wenn aber Fürstliche Gnaden Ihren Soldaten das Plündern verbieten und stattdessen Kontributionen aus den Ländern nehmen, die Sie erobern, kommt das der fürstlichen Kasse zugute, nicht dem einzelnen Soldaten. Das fördert die Disziplin und Fürstliche Gnaden kann die Ausgaben des Heeres decken und dazu noch die Soldaten bezahlen.“
Ein Lächeln huschte über das sonst immer ernste Gesicht des Generals.
„Der Herr meint, wir tragen Krieg in die feindlichen Länder, die den Krieg dann bezahlen müssen?“
„Genauso.“
Für diesmal entließ er mich, aber nach einer Woche unterbrach er sein Diktat, sah mich scharf an und sagte:
„Woher kommt der Herr?“
Ich stellte mich unwissend.
„Wieso?“
„Der Herr hat mir davon gesprochen, dass der Krieg den Krieg finanziere. Die Idee ist neu und nicht alltäglich, hat der Herr sich das selbst ausgedacht?“
Ich wich der eigentlichen Frage aus.
„Haben Fürstliche Gnaden den Erfolg bei dem de Witte gehabt?“
„Ich habe mit de Witte gesprochen. Mein Kredit bei ihm ist nun unbegrenzt, weil er von seinen Banken freie Hand bekommen hat. Die Idee des Herrn hat den Geldleuten gut gefallen. Hat der Herr gut gemacht.“
Ich verbeugte mich schweigend. Das Wort „der Krieg finanziert den Krieg“ wurde fortan bei Wallenstein und seinen Generalen zum stehenden Spruch.
Am Ende dieses Sommers war die Werbung beendet, der General hatte vierzehn Regimenter unter seiner Fahne versammelt, dazu fünf aus Böhmen und weitere zehn, die dem General vom Kaiser übergeben worden waren, insgesamt etwas über zwanzigtausend Mann, zu Fuß und zu Pferd.
3.
Den ganzen nächsten Sommer über bis zur Abreise meines Herrn aus Prag hatte ich alle Hände voll zu tun und kaum Zeit, mich um meine Umgebung zu kümmern. Einzig zu dem Kammerdiener des Generals, Jean, einem älteren und würdigen Mann, hatte ich Kontakt. Wir saßen manchmal abends, wenn der Fürst uns nicht brauchte, in seinem kargen Zimmerchen zusammen, das er in dem Palais Wallenstein bewohnte. Er rief mich dann und fragte, ob ich ihm nicht ein bisschen Gesellschaft leisten wolle. Immer nahm er bei diesen Gelegenheiten eine Flasche des Weines aus dem Regal, der von den Gütern unseres Herrn stammte, und wir tranken den schweren weißen Tokaier, immer mäßig.
Jean war aus einer bürgerlichen Prager Familie, die in die Religionswirren geraten und aus der Stadt verbannt worden war. Einzig er, der dritte Sohn, war in Prag geblieben und hatte sich schon in jungen Jahren dem Herzog von Friedland angedient, als der diesen Titel noch gar nicht hatte. Jean hatte den Aufstieg seines Herrn miterlebt, der mit der reichen Heirat begonnen und nun mit seiner Ernennung zum kaiserlichen Oberbefehlshaber seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden hatte.
„Aber einen besseren Herrn kann ich mir nicht vorstellen“; sagte er ruhig und ich betrachtete ihn. Er sah mit seinen weißen Haaren und dem sorgfältig gestutzten Vollbart aus wie der Inbegriff eines Dieners, ein Eindruck, der durch die grauweiß gestreifte Weste und die schwarze Hose noch betont wurde. Viel erzählte er mir von dem Leben in Prag vor dem großen Krieg, der mit dem Sturz kaiserlicher Diplomaten aus der Prager Burg begonnen hatte.
„Aber Krieg war schon vorher“, sagte er mit seinem ruhigen tiefen Bass, „schon bevor wir die unverschämten kaiserlichen Abgeordneten aus dem Fenster geworfen haben, schikanierten uns die Kaiserlichen, wo sie konnten.“
„Uns?“, fragte ich beiläufig.
„Ja, damals gehörte ich zu ihnen, wie alle anständigen Böhmen, schon von meiner Familie her, aber inzwischen bin ich nicht mehr interessiert. Ich habe mich beim General beworben und ihm meine Vergangenheit geschildert. Sie war ihm gleichgültig ebenso wie meine Religion, ich brauchte auch nicht zu konvertieren. Ich glaube, dem General sind Gottesfragen vollkommen egal, er glaubt an nichts als an seinen Erfolg.
Aber so habe ich bei ihm eine Arbeit, die ich gerne tue und bei der mich keiner nach meinem Glauben fragt. Das reicht mir.“
Oft saßen wir zusammen und immer wieder erzählte er mir von seinem Leben. Mir war er als Gesprächspartner lieb, weil er gerne redete und mich nicht nach meiner Vergangenheit fragte.
4.
„Der Herr wird mit mir reisen müssen, wenn er weiter für mich arbeiten will“, eröffnete mir der General im Herbst, „ich reise morgen früh ab und es wäre mir lieb, wenn der Herr mich als mein Schreiber begleiten würde. Auch im Felde wird es viel zu schreiben geben. Der Herr ist doch ungebunden?“
Wieder fasst er mich scharf ins Auge, als wolle er in mein Herz sehen. Ahnte er etwas von mir und meiner Existenz? Wieder wich ich aus.
„Aber werden Eure Fürstliche Gnaden denn die Reise aushalten können?“, fragte ich besorgt.
Eine düstere Wolke zog über sein Gesicht. Seit Anfang der letzten Woche hatte seine Krankheit ihn zu plagen begonnen. Jean hatte mir erzählt, dass sie ihn lähme, er sei dann schlecht gelaunt, könne sich kaum bewegen und schließe sich die meiste Zeit ein. Tatsächlich hatte ich in der letzten Woche wenig zu tun gehabt. Wallenstein war in seinen Gemächern geblieben und hatte niemanden um sich haben wollen als nur Jean und Seni, seinen Diener und den italienischen Leibarzt und Astrologen.
Heute Morgen aber hatte er mich sehr früh rufen lassen und mir eröffnet, dass er zur Armee abreisen und mich mitnehmen wolle.
„Es wird gehen müssen. Der Herr sieht ja, dass ich wieder aufstehen konnte, und die Sterne mögen mir helfen, jetzt werde ich ein, zwei Jahre Ruhe haben von dieser verfluchten Krankheit.“
Tatsächlich, so hatte Jean erzählt, suchte ihn die Lähmung in diesen Abständen heim.
Am nächsten Morgen zogen hunderte Kutschen aus dem Palais Wallenstein und aus der Stadt heraus nach Norden, wo die Regimenter lagerten und der Ankunft ihres Oberbefehlshabers harrten. Ich war mit meinem kleinen Gepäck in der dritten Kutsche untergekommen. Er hatte mich in seiner Nähe, wenn auch nicht in seinem Wagen haben wollen, damit, wie er sagte, er mich jederzeit finden und rufen könne. Wir zogen in Eilmärschen, begleitet von zwei Regimentern Reiterei, die uns an der Stadtgrenze erwarteten und erreichten nach zwei Tagen das riesige Gelände, auf dem Wallensteins Heer lagerte.
Ein ausgedehntes Lager war das, wir brauchten drei Stunden, bis wir die für uns reservierten Unterkünfte erreichten und hatten noch Glück, dass unsere Reiter uns den Weg bahnten. Durch den Tross kämpften wir uns, wo Essstände ihren Gestank nach altem Fett und gebratenem Fleisch verbreiteten, sahen an diesen Ständen reihenweise die Soldaten warten, bis sie ihre Ration kaufen konnten. Unrat lag zu Haufen um diese Stände herum, alle warfen weg, was sie nicht essen konnten oder wollten. Hunde stritten sich unter großem Gejaule um die Reste, Ratten wuselten zwischen ihnen umher, um das zu ergattern, was die Hunde ihnen überließen. Direkt daneben passierten wir die Bordelle, Zelte, vor denen Frauen saßen, Dürre, Fette, Alte, Junge, und immer wieder sahen wir, wie ein Soldat mit einer im Zelt verschwand. Jean, der neben mir im Wagen saß, wandte sich angeekelt ab.
„Ja, Jean“, lachte ich und tat erfahren, „auch das ist der Krieg, er ist nicht besonders appetitlich, schon bevor er angefangen hat, wie?“ Ich lachte, als ich sah, wie er seine Augen schloss und sich in die Wagenecke lehnte. Nach den Huren wurde es soldatischer. Hier saßen zehn Reiter mit ihrem Wachtmeister um ein Feuer herum, sie sangen, ich konnte es hören, zotige Texte oder auch Kriegslieder. Immer weiter rollten wir, manchmal durch einen Pulk Soldaten aufgehalten, die neugierig in die Wagen stierten, um zu sehen, wer da durchs Lager fuhr, sich aber zerstreuten, wenn sie hörten, es sei der Generalissimus selbst, der da anreiste. Jetzt kamen wir an einer Pferdekoppel vorbei, dort herrschte eine unsägliche Unordnung, ich fragte mich, wie ein Reiter hier wohl sein Pferd wiederfinden wollte. Offenbar herrschte aber doch eine gewisse Ordnung, nur den Reitern verständlich, denn plötzlich sah ich, wie zwölf Männer auf den Korral zu gingen und sich zielsicher Tiere herausfingen, sie sattelten und hinausritten. „Bestimmt Wachen, deren Dienst beginnt“, sagte ich zu Jean, der die Augen wieder geöffnet hatte und neugierig durch die Scheiben sah.
„Wenigstens hier, im inneren Lager, scheint einigermaßen Ordnung zu herrschen“, antwortete er.
Und schließlich langten wir im Zentrum des Lagers an. Ein kleines Dorf hatte man aufgebaut, die Unterkunft des Generals war deutlich zu erkennen, sie überragte alle anderen und schien groß genug, um Besprechungen mit Offizieren durchzuführen. Rund herum waren andere Zelte errichtet, offenbar größere für die höheren Offiziere, kleinere für uns, die wir Kammerdiener und Schreiber des Generals waren. Am Rande stand eine kleine Hütte, die man mir später als das Klosett der Offiziere benannte, das wir ebenfalls zu benutzen hatten.
Ich teilte mein Zelt mit dem Kammerdiener und kaum hatten wir es nur besichtigt, kam schon ein Bote.
„Schreiber Rheidt, zum Generalissimus befohlen“, rief er durch den offen stehenden Vorhang und ich konnte noch Jean bitten, auf mein Gepäck zu achten, da führte er mich schon zum General.
„Na, hat der Herr eine gute Reise gehabt?“, fragte er, und ich kannte ihn kaum wieder.
Sein Gesicht, sonst blass, war gerötet, die Augen blitzten, offenbar hatten ihm die Reise und der Anblick seines Heeres gutgetan.
„Ich hoffe, der Herr ist nicht zu durchgeschüttelt, um zu schreiben“, scherzte er, „ich habe den Befehl für den morgigen Tag zu diktieren. Setze sich der Herr und schreibe.“
Und Wallenstein diktierte mir seine Befehle für morgen. Die gesamte Armee hatte sich um sieben Uhr zum Abmarsch bereit zu machen. Es ging nach Norden, ins Deutsche Reich, so befahl er, gegen die Protestanten, gegen die Dänen, und die Soldaten, die ihren Sold von Wallenstein im Unterschied zu den anderen Heerführern, regelmäßig bekommen hatten, jubelten.
5.
Der dänische König Christian führte die protestantischen Waffen mit seiner Armee an, unterstützt von Christian von Braunschweig und dem Grafen von Mansfeld, einem Abenteurer, der mit einem von England und den Generalstaaten unterstützten Heer in die Kämpfe eingegriffen hatte.
Knapp eine Woche nach dem Aufbruch in Nordböhmen vereinte sich unsere Armee mit den Truppen des Grafen Tilly, der unter dem Befehl des bayerischen Kurfürsten Maximilian in Norddeutschland gegen die Protestanten kämpfte.
General Tilly hielt die Weser, während wir uns an der Elbe festgesetzt hatten. Der Stab des dänischen Königs war in Wolfenbüttel, er hatte Festungen in Minden, Northeim und Göttingen und ließ seine Armee bis tief nach Hessen streifen, Nahrung und Beute suchen, plündern, sengen und vergewaltigen. Niemand hielt sich freiwillig mehr in den Dörfern auf, im ganzen Herrschaftsbereich des dänischen Königs waren die Menschen auf der Flucht, hungernd, frierend, zitternd vor Furcht.
Wallenstein hatte sich im späten Herbst westlich der Elbe niedergelassen und seine Truppen, ebenso wie unser Verbündeter Tilly und die feindlichen Protestanten, in das Winterlager geschickt. Er hatte vorher einen Brückenkopf zu dem östlichen Ufer der Elbe gebildet, den er den ganzen Winter hindurch hielt. Es gab nur noch wenige Kampfhandlungen in diesem Jahr, nur Mansfeld beunruhigte immer wieder unsere Truppen östlich der Elbe, immer wieder griff er sie an, zog sich aber sofort wieder zurück. So verging der Winter.
Das änderte sich schlagartig mit der ersten Schneeschmelze des nächsten Jahres. Mansfeld drang nun energisch vor, unseren vorgeschobenen Posten an der Elbe zurückzudrängen, Wallenstein setzte, den Brückenkopf nutzend, so schnell wie möglich über den Strom. Es entwickelte sich eine wütende Schlacht, in der tausende von Soldaten starben. Wallenstein siegte, Mansfeld war geschlagen und auf der Flucht.
„Wir haben einen großartigen Sieg errungen“, musste ich an den Kaiser schreiben, „einen Sieg, von dem sich der Mansfeld auf Jahre hinaus nicht wird erholen können.“
Aus den Antworten des Kaisers wurde deutlich, dass auch andere ihn von der Schlacht unterrichtet hatten.
„Wir können nicht verstehen“, schrieb der Kaiser, „warum man den Mansfeld nicht verfolgt und bis auf den letzten Mann aufgerieben hat. Der Mansfeld hat uns große Ungemach bereitet, es wäre wünschenswert gewesen, ihn zu verfolgen und zu töten.“
Der Kaiser habe leicht reden, brummte Wallenstein, als ich ihm diesen Brief vorlas. Ich war mittlerweile zu seinem Vertrauten geworden. Der Kaiser habe ja für die Armee auch kein Goldstück dazugegeben. Er, Wallenstein, müsse noch sehen, wie er seine Leute ernähre.
Der Fürst hatte mich den Befehl schreiben lassen, es sei seinen Truppen die Plünderung streng verboten, wer dabei entdeckt würde, habe mit seiner Erschießung zu rechnen. Stattdessen forderte er nach seinem Ermessen Steuern ein von den Ländern, durch die er zog. Die Beute der Plünderungen wäre seinen Soldaten zugute gekommen, die Steuern flossen in seine Kasse.
6.
„Der Mansfeld ist östlich der Elbe nach Süden aufgebrochen. Er hat eine neue Armee aufgestellt, sich mit dem Herzog von Weimar verbündet und zieht nun zur Oder, von dort nach Schlesien und nach Mähren und Ungarn, wo er sich mit Gabriel Bethlen vereinigen will, um den Kaiser anzugreifen.“ Das war die Nachricht, die im Juli dieses Jahres meinen Herrn schlaflose Nächte kostete.
Er müsse sofort ebenfalls nach Süden aufbrechen, um den Kaiser und sein Wien zu schützen, sagte er in der Beratung der Generale.
Das könne er nicht, hielten die anderen dagegen, er sei bei Tilly im Wort, den dänischen König bis in sein Land zu verfolgen und ihn dort zu schlagen.
„Was hilft es, wenn wir den dänischen König besiegen und Mansfeld, Weimar und Bethlen erobern Wien?“ Wallenstein war ein ruhiger, vornehmer Herr, aber die Sorge und die Ungewissheit, was richtig sei, machten ihn zornig und aggressiv.
„Und wir werden doch nach Süden marschieren“, vertraute er mir an, der ich ihn schweigend unterstützte. Ich verstand seine Sorge: Wenn die Protestanten nach Süden zogen, bedrohten sie nicht nur Wien und den Kaiser, sondern auch und vor allem das Herzogtum Friedland. Daran wollte Wallenstein sie hindern und sie verfolgen.
Mitte August überschritten wir die Elbe unterhalb des Mündungsgebietes der Elster, Wallenstein hatte Marschbefehl gegeben, und zwar nach Süden, trotz der wütenden Protestschreiben Tillys, Maximilians von Bayern und des Kaisers.
Mansfeld und Weimar waren uns drei Wochen voraus. Wir kamen zehn Tage nach Überschreiten der Elbe an die Oder, auf deren anderer Seite Mansfeld passiert war.
„Der Krieg finanziert den Krieg“, war immer wieder die Maxime des Generalissimus auf die bangen Fragen seiner Generale, wie er denn seine gut zwanzigtausend Mann auf dem Marsch nach Süden, bis nach Mähren und Ungarn ernähren wolle. Und sie bekamen sehr schnell eine Lehrstunde, wie diese Finanzierung lief.
„Ich habe vom Kaiser die Erlaubnis erbeten, fünfzigtausend Mann auszuheben“, erklärte mir Wallenstein, „damit ich zwanzigtausend haben konnte. Mit weniger Truppen wäre ich nicht in der Lage, sie zu finanzieren. Aus eigenen Mitteln hätte ich das für zwei Monate gekonnt, mit der Hilfe des Bankiers de Witte ein Jahr, danach wäre die Armee aufgelöst worden. Aber der Herr hatte Recht, zwanzigtausend Mann sind eine Macht, die in der Lage ist, Kontributionen einzutreiben. Der Krieg finanziert eben den Krieg, wie der Herr gesagt hat.“
Wo immer wir auf unserem Marsch auf ein Dorf oder eine Stadt trafen, sandte Wallenstein eine Abordnung voraus, die als Steuer entweder die gesamte Jahresernte forderte oder den entsprechenden Betrag in Geld, damit er seine Truppen ernähren und ausrüsten konnte. In den meisten Fällen öffneten die ängstlichen Bürger ihre Scheunen und Schatzkammern und gaben, was er verlangte. In einigen Städten allerdings regte sich Widerstand.
„Wir werden ihm weder unsere Ernte noch unsere Schätze ausliefern“; ließen sie antworten.
Mit kaltem Blick wählte der General dann eine Truppe aus und ermächtigte sie, die Stadt zu überfallen, einzunehmen und zu plündern. Nur den fünften Teil dessen, was sie raubten, brauchten sie beim Heere abzuliefern, den Rest dürften sie behalten. Die Teilnahme an solchen Aufträgen war sehr beliebt, konnten die Soldaten doch ihre eigenen Säckel füllen.
Wir, die wir danach durch die überfallenen Städte zogen, sahen, dass sie nicht nur geplündert hatten. Sie hatten gemordet, vergewaltigt, gefoltert und wir konnten die Folgen ansehen. Leichen lagen auf den Straßen und Wegen, grässlich verstümmelt, hier und da lebten die Menschen noch, waren aber so gefoltert worden, dass sicher war, sie würden den Tag nicht überleben. Niemand kam auf die Idee, ihnen den Gnadenstoß zu geben.
7.
Ich war schon fast zwei Jahre Schreiber Wallensteins, als ich bei ihm zum ersten Mal seinen Bankier traf, den er „Hans de Witte von Lilienthal“ nannte. Sie führten geheimnisvolle Unterredungen, die ich zwar von da ab protokollieren, über die ich aber zu niemandem sprechen durfte.
Hans von Witte war Bankier mit weitreichenden Verbindungen von Prag in die großen Hauptstädte, nach Wien natürlich, nach Paris, London, Madrid, Rom und sogar in die frisch begründeten Kolonien. Reich war er, unermesslich reich, er bewohnte das prächtigste Palais in der ganzen Stadt Prag und kam, wenn er meinen Herrn besuchte, in einer Kutsche, die von vier der edelsten Pferde gezogen wurde, die ich je gesehen habe.
„Können wir nicht wieder das Konsortium begründen, das Münzen prägen darf?“, fragte bei einer solchen Konferenz Witte den Generalissimus.
„Nein, das werden wir beim Kaiser nicht noch einmal durchsetzen. Aber warum will der Herr das Recht zur Münzprägung wieder zurückhaben?“
„Eure Fürstlichen Gnaden haben wieder zwei Millionen Gulden für das kommende Jahr angefordert. Ich kann diese Summe zwar als Kredit bei den großen Bankhäusern Europas besorgen, aber Eure Fürstlichen Gnaden mögen bedenken, dass auch mein Kredit nicht unerschöpflich ist. Und da wäre es gut, wieder Silbermünzen zu prägen.“
De Witte und Wallenstein hatten in den vergangenen Jahren das Recht zur Prägung vom Kaiser in Wien für eine gewisse Zeit erhalten. Aus einem halben Pfund Silber waren von alters her neunzehn Silbergulden geprägt worden, was seit jeher dazu geführt hatte, dass der Ausgeber der Münzen die Wertdifferenz zwischen einem halben Pfund Silber und neunzehn Gulden als Gewinn einstreichen konnte. Kaum hatten allerdings mein Herr und der Bankier de Witt das Prägerecht, verminderten sie den Silbergehalt. Aus der gleichen Menge Silber prägten sie zuerst 27 Münzen, dann 39 und schließlich 47 Gulden und steigerten damit ihren Gewinn in das Unermessliche. Gleichzeitig überschwemmten sie Böhmen und Österreich mit immer mehr Münzen, sie kauften alles Silber ein, dessen sie habhaft werden konnten. Die folgende Inflation stürzte Böhmen und Österreich in eine dramatische Hungerkrise, weil die armen Leute die Brotpreise nicht mehr bezahlen konnten.
Mit den Gewinnen finanzierte Wallenstein die Bildung seiner Armee vor und verlangte von dem Bankier die Kreditierung weiterer Mittel mit dem Versprechen, sie zurückzuzahlen, sobald er mächtig genug sei, die Kontributionen einzutreiben.
„Nein“, erwiderte Wallenstein auf die Frage de Wittes, „der Kaiser wird die Münze nicht noch einmal verpachten, nicht einmal für sehr viel Geld. Zu hoch waren unsere Gewinne und der Kaiser oder seine Räte haben das erfahren. Nein, der Herr wird Geld aus Kredit schöpfen müssen, wenn die Armee des Kaisers nicht zerfallen soll.“
„Aber, Fürstliche Gnaden, wann werde ich die Kredite zurückzahlen können?“
„Der Herr beunruhige sich nicht, wir werden in Kürze marschieren, die Kontributionen werden fließen und der Herr wird sehen, alles wird auf Heller und Pfennig zurückgezahlt werden. Der Krieg finanziert den Krieg“
Besorgt wischte sich Hans de Witte die Stirn mit einem riesigen Seidentuch, das er immer bei sich trug. Er war wie immer sehr blass, aber heute schien er von Sorgen besonders gequält zu sein. Ich verstand ihn. Dem Vernehmen nach hatte er aus dem Münzgeschäft einunddreißig Millionen Gulden erlöst, aber das war vor sechs Jahren gewesen, 1623. Inzwischen hatte er diese Summe sicher an Wallenstein als Kredit gegeben, wie viel er zurückerhalten hatte, wusste ich nicht.
Aber eines war mir klar: Je länger der Krieg dauerte, desto schwerer war es, die Maxime, er finanziere sich selbst, aufrecht zu erhalten. Nichts mehr war aus dem ausgebluteten Land herauszuholen, viele Dörfer, durch die unser Heer zog, waren zwei,- drei- oder viermal geplündert worden. Für unser Heer war da nichts mehr, was der General hätte einziehen können.
Und so blieb der Generalissimus seinem Bankier eine große Summe schuldig, eine Summe, die sich jährlich steigerte, weil mein Herr immer mehr und mehr Geld verlangte. De Witte wurde immer blasser, immer dünner, immer drängender verlangte er die Rückzahlung.
Er müsse inzwischen für neue Kredite, die die alten verlängerten, Wucherzinsen zahlen, wenn Wallenstein ihm nicht größere Summen zurückzahlte, könne er, de Witte, das nicht überleben.
Wallenstein blieb hart. Er konnte kein Geld auftreiben, den Kaiser fragte niemand, jeder wusste von dem schlechten Zustand der kaiserlichen Kasse. Aber allen unsicheren Finanzierungen zum Trotz: Noch stand das Heer des Generalissimus.
8.
„Sie sollen zum General kommen, und zwar sofort.“ Wie immer korrekt gekleidet, stand Jean, die schwach leuchtende Laterne in der Hand, neben meinem Lager in der kleinen Kammer, die uns zugewiesen war in dem Dorf, in dem wir logierten. Mitternacht musste vorbei sein, ich hatte schon fest geschlafen. Die Kerze in der Lampe beleuchtete das Gesicht des Dieners von unten und gab ihm flackernd einen unheimlichen Schein. Die gerade Nase wurde durch den Schatten verlängert, die Wangen bekamen einen hageren Eindruck, das im Licht fahle Gesicht ließ an einen Totenkopf erinnern.
„Was will er denn?“, fragte ich, indem ich mich erhob und den ersten Schrecken überwand.
„Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, er ist mit Seni in der Astronomenkammer. Sie haben den ganzen Abend die Sterne betrachtet und nun hat er mich gerufen und verlangt, ich solle Sie bringen.“
Schnell kleidete ich mich in meine bescheidene schwarze Schreiberkluft und folgte dem Diener durch die nur schwach erleuchteten Gänge nach oben, wo unmittelbar unter dem Dach das von dem Gesinde „Astronomenkammer“ genannte Giebelzimmer lag, in dem Wallenstein mit seinem Astronomen und Leibarzt Seni seine Studien betrieb, wie man sich erzählte.
Kurz klopfte Jean an die Tür und öffnete sie nach einem herrisch gerufenen „Herein“, um mich in die Kammer zu schicken. Hinter mir schloss sich die Tür.
Das Zimmer war nur schwach erleuchtet, von zwei einfachen Kerzen, die an den gegenüberliegenden Wänden hingen, wie ich bei einem schnellen Rundblick bemerkte. Mitten im Zimmer stand ein Tisch mit einer schwarzen Decke, darauf stand eine einfache Karaffe, gefüllt mit einer durchsichtigen Flüssigkeit, und drei Gläsern. Mir gegenüber erkannte ich meinen General, neben ihm den schon damals berüchtigten und leise gefürchteten italienischen Leibarzt und Astronomen, Giovanni Battista Seni.
Ich hatte ihn bisher nur einmal kurz gesehen, er war mir im Gefolge des Generalissimus aufgefallen. Er war damals vielleicht eben über dreißig Jahre alt, klein, sehnig, hager war er, mit einem scharf geschnittenen Gesicht, aus dem fast waagerecht eine schmale Nase wuchs, mit dünnen, fast zu roten Lippen und eng zusammenstehenden, schwarzen Augen.
Beide sahen mir entgegen.
„Der Herr trete näher“, lud mich mein Herr mit hohler Stimme ein, „ich habe den Herrn gebeten, weil er vielleicht mit uns die astronomische Wissenschaft betreiben möchte.“
Die Aufforderung kam für mich vollkommen überraschend.
„Wieso meinen Ihre Fürstlichen Gnaden, dass ich etwas davon verstünde?“, fragte ich vorsichtig zurück.
„Die Fürstliche Gnade weiß das nicht“. Seni hatte eine scharfe, schnarrende und dabei überraschend hohe Stimme, „aber wir waren der Meinung, dass Herr Rheidt uns vielleicht bei dem Studium der Zukunft beistehen könnte.“
„Beim Studium der Zukunft?“, fragte ich gedehnt, indem ich fieberhaft nachdachte, „haben wir nicht alle an der Last der Gegenwart genug zu tragen, als dass wir uns auch noch mit der Zukunft beschweren sollten?“
„Wer die Zukunft hat, beherrscht die Gegenwart“, flüsterte jetzt Wallenstein, so leise, dass ich die sonst so gebietende Stimme fast nicht wiedererkannte, „nur wer die Zukunft weiß, kann heute die richtigen Entscheidungen treffen.“
„Fürstliche Gnaden haben vollständig Recht“, versetzte ich, „aber niemand kann die Zukunft wissen, es sei denn, er könne sie selbst erschaffen.“
Der General richtete sich hoch auf.
„Nun gut, Seni, nun gut, Rheidt, reihen wir uns um den Tisch, geben wir uns die Hände, versammelt um dieses Kristallwasser, und erschaffen unsere Zukunft.“
Seni zündete eine Kerze an, die neben der Karaffe stand und löschte die anderen.
Wallenstein ging an den Tisch, setzte sich auf einen der Stühle und bedeutete uns, ihm zu folgen. Wir saßen im Kreis und verbanden uns, indem wir die Hände nahmen. Die des Generals war schlank, sehr kräftig, und zu meiner Überraschung etwas schwielig, die des italienischen Arztes kühl, trocken und knochig.
Wir alle senkten den Blick auf die Karaffe, nur ich schielte unter den Wimpern hoch. Eine unheimliche Gesellschaft waren wir, Senis und Wallensteins Gesichter nur von der Kerze erleuchtet, fremdartig verzog das Licht die Züge und warf gespenstische, riesige Schatten von den Oberkörpern und den Köpfen an die Wand.
Dann konzentrierte ich mich auf die Hände, die ich gefasst hielt.
Viele Menschen glauben, sie könnten über ihre Hände Kraft vermitteln und empfangen, ich kann das nicht beurteilen. Bei uns bedarf es für den Kraftschluss nicht einmal der Berührung der Hände, ein einfacher Körperkontakt reicht für uns aus, um Kraft zu spüren oder zu übertragen. Und mit dieser Wahrnehmungsfähigkeit spürte ich hier, in dieser Kammer und zu dieser unheimlichen Stunde, nach kurzer Zeit, dass Seni ein Scharlatan war. Nichts, aber auch gar nichts floss durch seine Hand zu mir, keine Kraft, kein Bewusstsein, nicht einmal besonders starke Gefühle empfing ich von ihm. Alle Stärke, alle Empfindungen, die in diesem Kreis waren, kamen von Wallenstein, dem General, nachdem ich meine Kraft gebremst hielt.
Widersprüchliche Signale waren es, die der General ausströmte. Ich fühlte den unbändigen Willen, Erfolg zu haben, Krieg zu führen, Menschen zu befehlen, zu beherrschen. Ein dunkler, aggressiver Strom fuhr durch meinen Körper, ungehindert weiter zu Seni und von ihm zu Wallenstein. Fordernd war er, der Strom, voller Begierde, die Zukunft zu wissen und mit diesem Wissen alle zu beherrschen, seine Soldaten, seine Generale und selbst den Kaiser.
Und dann waren da noch andere Seiten, kaum zu spüren, schwach ausgeprägt, aber doch deutlich: ein Familienvater, der mit zärtlicher Sorge an seiner Frau hing, an seiner Tochter, ein Gutsherr, der nichts weiter wollte, als seine Länder bestellen und seinen Frieden haben. Sehr unausgeprägt und sehr im Hintergrund, diese Seite, aber da.
Jetzt stöhnte er auf.
„Zukunft“, murmelte er, „werde ich siegen? Was wird die Zukunft bringen?“
Und als hätte er mit diesen Worten einen Bann gebrochen, sah er auf, sah Seni auf, blickten wir uns an. Langsam lösten sich unsere Hände, auf einmal entspannt, sah mich Wallenstein an.
„Was denkt der Herr? Lässt sich so Zukunft voraussagen?“
Ich sah an ihm vorbei auf den riesigen Schatten, den seine Gestalt warf.
„Nein, Fürstliche Gnaden, die Zukunft kann niemand auf der Erde wissen.“
„Wir werden sehen, der Herr hat ungewöhnliche Kräfte. Wir werden uns wiedersehen.“
Damit verabschiedete uns der General.
___________________________