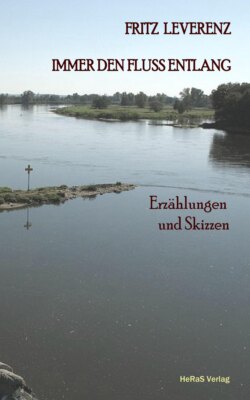Читать книгу Immer den Fluss entlang - Fritz Leverenz - Страница 7
5 Das Naheliegende und das Schreiben
ОглавлениеAm Wochenende fahre ich mit der S-Bahn raus in den Garten, um in Ruhe zu schreiben, bevor die Familie folgt. Doch ich komme wenig zum Schreiben - für zwei Vormittagsstunden am Freitag, und das ist keine zufriedenstellende Zeitspanne für ernsthaftes Arbeiten, da gerät man leicht ins Schludern.
Die meiste Zeit des Tages habe ich mich um naheliegende Dinge zu kümmern, um Arbeiten, die getan werden müssen, die nicht warten können (bis sie sich eventuell zu größerer Unordnung anreichern).
Selbstverständlich muss auch das Schreiben getan werden; um es eleganter zu formulieren: es muss auch geschrieben werden, auch meine Erzählungen können nicht ewig warten, sich stauen in meinem Gedächtnis, bis sie übereinander stürzen, wie alte Kisten und sich gegenseitig bis zur Unkenntlichkeit zerdrücken; doch die naheliegenden Tätigkeiten bilden den Rahmen, das Gerüst des Tages: Haus, Garten, Wohnung, Essen und Trinken, deshalb liegen sie näher. Das Hemd liegt nun einmal näher als der Rock. Die Menschen, die sich um das Naheliegende kümmern, sind ebenso bedeutsam, wie die, die schreibend mit den Gedanken spielen – und beide runden nun einmal das Leben ab.
Die Erzählungen, und das, was zu sagen ich mir vorgenommen habe, wohnen in mir. Sie flüstern mir zu, bedrängen mich, und ich muss sie beschwichtigen, vertrösten auf die Zeit nach den Arbeiten an dem Naheliegenden, die ich tun muss. Dabei weiß ich, nichts liegt mir näher, als das, was ich zu schreiben habe. Es bringt mich in beste Stimmung, lässt mich bei mir selbst sein, mich kraftvoll fühlen. Doch es ernährt mich nicht, kleidet mich nicht und gibt meinem Körper keine Unterkunft.
Im Garten zu ebener Erde, spüre ich, dass mir vieles näher liegt als in meiner Wohnung in der sechsten Etage. Logisch, das liegt doch nahe, könnte man sagen.
Beispielsweise muss ich die bereits zu kräftige Traubenkirsche stutzen, absägen, die vom ungenutzten Nachbargrundstück herüberragt und unseren Schneeballbüschen und jungen Zirbelkiefern das Licht nimmt; ich muss den morschen Pfosten auswechseln, an dem das Gartentor hängt, muss den neuen Pfosten teeren und einbuddeln; muss also sägen, buddeln, schrauben, ehe das Tor wieder fest hängt; muss den morschen Pfosten zum Holzplatz legen. Dort, neben dem Hauklotz und dem Sägebock sammelt sich das Brennholz. Ich säge es mit der Kettensäge, da mir für das andere Ende meiner Schrotsäge eine kräftige zweite Hand fehlt.
Indessen ist die Hausfrau eingetroffen, und auch sie widmet sich dem Naheliegenden (für sie gibt es vorrangig das Naheliegende – das Fernliegende – wie mein Schreiben, ist ihr suspekt und nur naheliegend, wenn sie ein Buch liest, den Fernseher einschaltet, ins Theater oder in die Oper geht). Sie schneidet sich mit einer Gartenschere – der jahrzehntealten – durch die Jasmin- und Forsythiensträucher, harkt Laub, verkündet Unmut über das silbrige Pappellaub von Bäumen aus dem Nachbargarten (ein silbriges Blatt glänzte am Morgen auf der Türschwelle), fegt die Plattenwege.
Und am Nachmittag fahren wir mit den Rädern zum Baumarkt, der im Briefkasten ein Rabattkärtchen hinterlassen hatte. Wir kaufen neue Besen, Kissen für die Gartenstühle, sehen uns Holzzäune und Kaminöfen an.
Naheliegend ist auch, dass ich meine Mutter in der Havelstraße besuche. Dieses Haus, in dem sie noch immer wohnt, seit wir Mitte der Fünfzigerjahre aus dem Stolper Weg hergezogen waren, eignete sich mit seinen jetzigen und ehemaligen Bewohnern, an die ich mich noch gut erinnere, für eine Chronik. Es wäre interessant, diese fünfzig vergangenen Jahre nachzuzeichnen. Eine Chronik der Menschen der verschiedenen Häuser und Straßen, in denen wir wohnten.
Die Wohnungstür ist angelehnt. Ich komme durch den Keller, und meine Mutter hörte vom Hof her durch das offene Wohnzimmerfenster meine Fahrradbremse quietschen. Beim Eintreten höre ich sie reden und das Klackern und Schnarren des Kartenmischers, der mit einer Kurbel gedreht wird und die Spielkarten über- und durcheinanderklackert. Ihre neunzigjährige Freundin Johanna sitzt ihr im Sessel gegenüber. Sie spielen Canasta. Johanna hat ihre Operation an der rechten Hand offenbar gut überstanden, die Fäden sind gezogen und nur ein Pflaster am Daumen erinnert an die Wunde.
Sie begrüßen mich, wie sie mich wohl schon als Schulkind begrüßten, freudig und mit mütterlicher Sorge: „Möchtest du etwas essen?“, wobei sie nur für einen kurzen Moment wagen, ihren wachsamen Blick vom für sie jetzt Naheliegenden, dem Tisch mit den Karten zu heben. „Nein, danke. Lasst euch nicht stören.“
Neben meiner Mutter auf der Couch sitzt die schwarzweiße Katze Mausi mit einem schwarzen Flohband um den Hals. An der Ecke des Tisches liegt ein Notizheft mit dem Punktestand der beiden Spielerinnen und ein Kugelschreiber, daneben steht ein Gläschen mit dickem Korken angefüllt mit Münzen und kleinen Geldscheinen. Die Verliererin der Tagesrunde muss einzahlen – für ein gemeinsames Essen „beim Chinesen“ am Ende des Jahres.
Ich schaue gern zu, bin zu Hause, sitze am Tisch. Und wie immer, wenn ich herkomme, schiebt sich die Frage in meine Gedanken: Wie lange noch?
2002