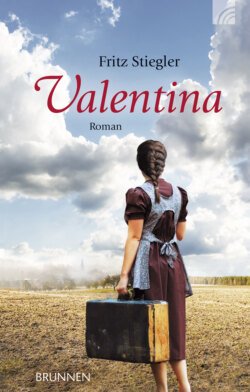Читать книгу Valentina - Fritz Stiegler - Страница 7
„LASST SIE TANZEN!“
Оглавление1. SEPTEMBER 1944
Das Licht der aufgehenden Sonne verdrängte die Dämmerung. Der wolkenlose Himmel verkündete einen schönen Tag, obwohl böiger Wind die Kiefern auf der steilen Anhöhe gegenüber hin und her wogen ließ. Er strömte herunter ins Tal, verteilte den Rauch des mächtigen Feuers über das gesamte Gelände des Arbeitserziehungslagers Langenzenn, fuhr hinein in die Baracken, die Wachhäuschen, die Unterkünfte für die Wärter. Beißender Qualm kroch in jeden Winkel, jede Ritze.
Mit jeder Ladung Stroh, die die Häftlinge aus den Unterkünften schafften und ins Feuer kippten, schoss eine weitere zischende Rauchsäule in die Höhe. Glühende Halme und Asche verteilten sich in der Luft. Wie ein Schleier lag der durchdringende Geruch menschlicher Exkremente über dem Lager.
Die Sorge, Fleckfieber könnte sich erneut ausbreiten, hatte die Lagerleitung veranlasst, die Einstreu in den Männerbaracken verbrennen zu lassen. Aufgeregte Aufseher überwachten das Geschehen, während sich das heimische Wachpersonal in die Mannschaftsunterkunft zurückgezogen hatte. Die Angst, sich selbst anzustecken, beunruhigte die Posten. Ausnahmsweise durften die Häftlinge in ihren Behausungen bleiben.
Auch in der Frauenbaracke warteten die Sträflinge hustend und mit tränenden Augen auf den Pfiff zum Appell. Reglos erduldeten sie den Rauch. Die Gefangenen verharrten in der Stille, gespannt auf das, was sie erwartete.
Nur die beiden Schwalben, seit einer Woche mit der Reparatur ihres Nestes über der Eingangstüre beschäftigt, interessierten sich nicht für den Rauch. Unentwegt sammelten sie auf den umliegenden Äckern Reste von Stroh und Heu, tauchten sie in eine der Pfützen neben dem hohen Stacheldrahtzaun und klebten die braune Masse Stück für Stück an den hervorstehenden Balken des Barackendachs. Baustein für Baustein wuchs das Nest zu einem wabenförmigen Kunstwerk heran. Es war bereits der zweite Versuch.
Nastasia, die kräftige ukrainische Aufseherin mit der tiefen Stimme, dem sonnengegerbten Gesicht und den lockigen schwarzen Haaren, hatte das unfertige Geflecht schon einmal mit dem Gummiknüppel abgeschlagen, als sie merkte, dass sich die Frauen an dem Treiben der emsigen Tiere erfreuten. Nach zwei gezielten Schlägen lag es zerbrochen am Boden, nur ein wenig zerfranstes Gewebe blieb am morschen Holz kleben. Die Schwalben aber begannen ihr Werk von Neuem.
Einige Häftlinge beobachteten die Vögel schon seit Längerem. Spätabends, wenn sie erschöpft von der Arbeit zurückkamen, freuten sie sich über das Schwalbenpärchen, über ihren unermüdlichen Eifer. Sie berieten untereinander, ob das Nest je fertig sein würde, und sie sorgten sich, ob die Tiere genug Material fänden oder ob die Pfützen wohl in der Sonne vertrockneten.
Der Rauch hatte sich verzogen. Lagerkommandant Bär, ein breitschultriger, stämmiger Untersturmführer, öffnete die Tür seiner Stube. Gähnend machte er mit seinen blank geputzten Stiefeln einen Schritt hinaus auf die schmale Veranda, kratzte sich am Kinn und strich mit der anderen Hand über die streng zur Seite gekämmten schwarzen Haare.
Tiefe Furchen durchzogen seine Stirn. Bär schien unzufrieden und missmutig. Unentschlossen verweilte er an der Schwelle und ließ seinen Blick schweifen.
Alles war ruhig. Zwei Posten mit angeleinten Hunden liefen den hohen Zaun entlang, der den Innenbereich, die Häftlingsbaracken, Appellplätze, Latrinen und Sanitärräume von dem Außenlager, dem Mannschaftsheim, der Verwaltung und den neu errichteten Werkstätten trennte.
Der Kommandant sah durch die offene Tür auf die Wanduhr über seinem mahagonifarbenen Schreibtisch. Sechs Uhr in der Früh.
Einige Male atmete er tief durch, dann stopfte er das gerippte Unterhemd in die Hose und fummelte den am Boden schleifenden Hosenträger an den Knopf. Hemd und Uniformjacke hingen zerknittert über der Stuhllehne. Auf dem Tisch stand eine offene Cognacflasche, eine leere lag am Boden. Bär wankte ein wenig, als er zurück in den kleinen Raum ging. Er stützte sich auf der Stuhllehne ab und gähnte erneut.
Die riesige schwarze Dogge neben dem Kanonenofen stand auf und schmiegte sich mit eingezogenem Stummelschwanz zwischen Bärs Beine. „Brav, Fritz“, lobte sie der Kommandant. „Brauchst dich nicht fürchten, ist kein Jud im Raum.“
Bär streichelte den Hund am Hals, dann schnappte er sich die fast ausgetrunkene Flasche und schüttete den Rest auf einen Zug in sich hinein. Prustend warf er sie in die Ecke, wo sie mit einem lauten Knall zerbarst und die Scherben in alle Richtungen sprangen. Ängstlich legte der Hund die Ohren an und winselte.
Der Kommandant ging einen Schritt zur Seite, zog mit dem linken Fuß auf und versetzte dem Tier einen kräftigen Tritt in die Flanke. Jaulend verkroch sich die Dogge unter den Schreibtisch, die Augen auf Bär fixiert, der zornig brüllte: „Feiger Köter, sollst keine Angst haben. Ein deutscher Hund hat keine Angst, verstanden!“ Bär sah dem Tier eine Weile drohend in die Augen, dann setzte er sich auf den Stuhl, verschränkte die Arme auf dem Tisch und legte die Stirn in die Hände.
Es klopfte. Der stellvertretende Lagerkommandant stand an der kurzen Bohlentreppe und schlug die Hacken zusammen. Den hageren Körper durchgestreckt, riss er den Arm hoch. Seine Kappe hatte er tief in die Stirn gezogen. Das rötliche Gesicht war eingerahmt von borstigen Koteletten. Seine Uniformjacke hing, zugeknöpft bis zum Hals, wie ein nasser Sack an der schmalen Brust.
„Heil Hitler“, grüßte Kriminalsekretär Mägerlein mit belegter Stimme.
Bär ging einige Schritte auf ihn zu und holte tief Luft: „Heil Hitler! Was ist los, warum dauert das so lange?“
Achselzuckend schwieg der Stellvertreter, die Augen auf die zerbrochene Flasche gerichtet.
„Ist bereits sechs nach, was ist los, Mann, warum rührt sich nichts?“
„Das Fleckfieber, Untersturmführer. Die Leute haben das Stroh verbrannt.“
„Ach so“, murmelte Bär erstaunt. „Das heißt aber noch lange nicht, dass das faule Pack liegen bleiben darf. Antreten, lasst sie tanzen! Was ist? Na los!“
Mägerlein überlegte: „Muss das sein? In den Innenbereich? Die Drecksarbeit erledigen doch sonst die Kapos?“
„Kriminalsekretär“, sagte Bär, „auch die Kapos brauchen hin und wieder einen Tritt in den Arsch.“
Mägerlein zupfte an der Kotelette. „Aber die Fabrik …“
„Fabrik, Fabrik, wenn ich das schon hör!“, brauste Bär auf. „Sieh dir dieses Pack an. Ostarbeiter, Untermenschen. Das sind Ratten. Die sind keinen Pfifferling wert. Mensch, Kriminalsekretär. Wir sind ein Arbeitserziehungslager, ein A – E – L.“ Jeden einzelnen Buchstaben wiederholte der Kommandant laut und deutlich. „Das Vaterland gebietet uns, diese Schmarotzer zu erziehen … als Hilfsarbeiter für das Tausendjährige Reich … ihnen Zucht und Ordnung beizubringen. Es ist uns eine Ehre, unsere Pflicht.“
Mägerlein hörte ihm eine Weile geduldig zu, dann wagte er zu widersprechen: „Erziehen? Die sollen was Sinnvolles tun. Die Fabrikbesitzer klagen, dass die Leut nichts leisten und nur gescheit arbeiten, wenn die Aufseher mit der Peitsche danebenstehen und auf sie einschlagen.“
„Mägerlein“, der Kommandant klopfte dem Stellvertreter kameradschaftlich auf die Schulter. „Gerade deswegen müssen wir sie erziehen. Weißt, die vom Osten sind grundsätzlich faul. Die brauchen das, die wollen ‚tanzen‘, und dann geht die Arbeit wie von selbst, wie geschmiert geht sie dann.“
Der Stellvertreter verzog keine Miene und setzte seinen Fuß auf die oberste Stufe. „Wie lange sollen sie tanzen?“, fragte er, ohne sich umzudrehen.
Bär grinste. „Bis sie’s können, Mägerlein, bis sie’s können.“ Dann schloss er die Tür.
Schweigend stieg der Kriminalsekretär die Treppe hinab und kramte die schwarze Trillerpfeife aus der Hosentasche.
Kommandant Bär legte gemächlich den Uniformrock an und korrigierte seine Haltung. Entspannt blickte er in den Blechspiegel, der über der weißen Waschschüssel hing. Er lächelte und schien zufrieden mit sich und dem, was um ihn herum passierte.
Im Innenbereich scharte Mägerlein die Hundeführer und Kapos um sich. Seine Ansprache war kurz. „Heil Hitler!“, befahl er. „Lasst sie tanzen vor der Mahlzeit, damit sie Appetit kriegen. Danach an die Arbeit.“
Routiniert folgten die Aufseher der Anweisung. Sie schwärmten in die dreigeteilten Lagerblöcke und wunderten sich, dass sich ihnen der stellvertretende Lagerkommandant und die deutschen Hundeführer anschlossen.
Den fünfzig weiblichen Gefangenen, die in der westlichen Baracke eingepfercht waren, wurden die Hundeführer Wagner und Weber als Aufsicht zugeteilt, unterstützt von Nastasia und zwei weiteren Ostarbeiterinnen, die der Kommandant getreu seinem Leitspruch als Kapos ausgewählt hatte: „Es ist viel leichter, schlechte Menschen zu finden, als gute. In meinem Betrieb brauche ich die schlechtesten und härtesten für diese Aufgabe.“
Als die ersten Sonnenstrahlen über das flache Dach der Männerbaracke blitzten, blendeten sie die aufgereihten Häftlinge. Reglos standen die Frauen vor ihren Peinigern und warteten auf ein Zeichen. Es war nie vorhersehbar, was folgte. Es gab keine Regeln.
Lagerkommandant Bär erschien unerwartet am Tor und ging mit der Dogge an der Leine über den Platz zu den Hundeführern, gefolgt von Mägerlein, der sich unweit von Bär postierte. Mit einem schwarzen zugeknöpften Ledermantel, der weit über die Knie reichte und die Uniform verdeckte, platzierte sich Bär reglos mit am Rücken verschränkten Händen vor den erstarrten Gefangenen, die mit zerrissener, notdürftig geflickter Kleidung vor ihm standen, die Augen auf den Boden gerichtet.
Der Kommandant ging zwei Schritte vor, schlug die Hacken zusammen und streckte den rechten Arm von sich. „Heil Hitler.“ Unverzüglich erwiderte die Wachmannschaft den Gruß, ebenso die Sträflinge.
Mit dem Oberkörper leicht nach vorn gebeugt, begann der Kommandant, die Reihe zu inspizieren. Schritt für Schritt ging er von Frau zu Frau, hielt an, ging weiter und blickte einer nach der anderen ins Gesicht. Keine wagte aufzusehen.
Vor einer zierlichen Ukrainerin blieb er stehen. Sie trug eine geflickte graue Strickjacke, zugeknöpft bis zum Hals, über einem schmutzigen Rock. Die bis zu den Knien reichenden braunen Wollstrümpfe steckten in tadellosen Halbschuhen. Sie wirkte trotz ihrer kurz geschnittenen, dunklen Haare nicht so verwahrlost wie die anderen. Die junge Frau rührte sich keinen Zentimeter, als der Kommandant vor ihr verweilte. Verkrampft blickte sie auf den Boden. Nur sein rasselnder Atem war zu hören, wenn ihm die Luft aus den Nasenflügeln strömte.
Plötzlich sah sie auf. Neugierig wie ein kleines Kind blickte sie ihm in die Augen und ließ nicht mehr los.
Bär räusperte sich. Die Frau sah zur Seite, doch er kam immer näher. Sie spürte seinen Atem auf ihrer Haut. Der Dunst aus Schnaps und verbrauchter Luft schwappte ihr entgegen. Steif stand sie vor ihm und rührte sich nicht.
Bär trat zwei Schritte zurück, nahm seine Hand aus der Hosentasche, richtete die Schirmmütze und sagte mit dröhnender Stimme: „Arbeiterinnen! Freut euch. Ihr habt die Ehre, unserem deutschen Vaterland zu dienen. Erst durch Müh und Arbeit für das Reich bekommt euer Leben einen Sinn, seid dankbar dafür.“
Eine kleine Geste reichte. Nastasia und die beiden anderen Aufseherinnen zogen ihre Knüppel aus den Schlaufen und trieben die Frauen zu einem Kreis. Nastasia gab das Kommando: „Laufen! Halt! Liegestütze, damit ihr wach werdet! Und nun Kniebeugen und wieder laufen! Schneller! Noch schneller! Halt! Und zwanzig Liegestütze und spurten!“
Die ersten wankten. Peitschen knallten.
„Los, schneller! Noch schneller! Halt! Und jetzt rückwärts und schneller!“ Einige Frauen begannen zu stolpern und rissen die anderen mit sich.
Bär grinste und scherzte mit Wagner und Weber, deren Hunde die aufkeimende Unruhe spürten und knurrten.
Eine ältere Frau sackte wie eine Puppe auf die Knie. Den Kopf zwischen die angewinkelten Beine gepresst, hielt sie die Hände schützend über ihren Nacken und murmelte leise ein Gebet.
„Soll ich ihr helfen?“, fragte Weber belustigt.
Bär sah ihn fragend an. „Wenn du willst.“
Weber bückte sich zu seinem Hund und öffnete die Leine. „Komm, hilf ihr, fass!“ Der Köter rannte los und verbiss sich im Bein der am Boden kauernden Frau. Mit einem Stofffetzen im Maul rannte er zurück zu seinem Herrn und legte ihn zu seinen Füßen. Die Leine schnappte wieder zu, während sich die Frau aufrichtete. Mit gekrümmtem Rücken reihte sie sich ein in den Kreis und humpelte den anderen hinterher.
Mägerlein schlenderte nachdenklich zu Bär, dabei sprach er langsam und leise, ohne ihn anzusehen: „Die Gefangenen werden das nicht aushalten, Untersturmführer.“
Bärs Lächeln gefror, mit seinem Stiefel kratzte er im staubigen Lehmboden. „Wenn sie’s nicht aushalten“, meinte er trocken, „kommen andere, ganz einfach. Gibt genug, Mägerlein.“
Der Stellvertreter zupfte verlegen an seiner rechten Kotelette. „Aber die Fabrik … und ein Teil soll auf die Felder …“
„Kriminalsekretär!“, belehrte ihn Bär. „Das sind Minderwertige, Untermenschen. Mensch, Mägerlein, ich wiederhole mich, die haben Glück, dass sie dem Tausendjährigen Reich dienen dürfen.“
Der zweite Kommandant schwieg und starrte nachdenklich zu Weber hinüber. Der Köter lag artig bei seinem Herrn.
Bär hob den gestreckten Zeigefinger. „Es reicht!“, brüllte er. „Sie sollen schließlich noch was arbeiten.“
Lässig, die Hände in den Hosentaschen vergraben, ging der Kommandant an den geschundenen Frauen vorbei dem Ausgang zu. Erst nachdem er den Innenbereich durch den von einer Torhüterin bewachten Eingang verlassen hatte und hinter der Tür seiner Stube neben dem Wachhäuschen verschwunden war, befahl Mägerlein: „Jetzt fresst euer Zeug. Dann gehts in die Fabrik. Und schafft endlich die Köter weg.“
Wagner fragte: „Sollen wir den Weibern noch eine Lektion erteilen? Sie haben noch eine halbe Stunde bis zur Arbeit.“
„Nein“, entgegnete ihm Mägerlein mit fester Stimme. „Das mach ich schon selber. Schaut lieber, ob die drüben ihr Stroh sauber verbrannt haben.“
„Heil Hitler.“ Mit festem Schritt marschierten Wagner und Weber mit ihren Hunden zum Ausgang. Sie waren fast gleich groß, blond, breitschultrig, Mitte dreißig. Beide mit glänzenden Schaftstiefeln, aufgeplusterten Hosen, eng geschnittenen Uniformjacken und weit in die Stirn gezogenen Schirmmützen.
Mägerlein sah ihnen nach. „Könnten Zwillinge sein. Passen gut zusammen, die zwei Drecksäcke.“ Er verließ den inneren Sicherheitsbereich und ging zum Mannschaftsheim.
„Simon und Steigleder zu mir.“
Mit kurzen, schnellen Schritten kam Simon aus der Hütte. Korrekt schlug der glatzköpfige schmächtige Mann die Hacken zusammen und wartete auf Anweisung. Die kleinen Augen blickten unruhig zu Mägerlein. Die Nickelbrille verlieh ihm das Aussehen eines strengen Schulmeisters mit seiner stets gepflegten Uniform und blitzblanken Stiefeln, während diejenigen von Steigleder, dem Hünen, der sich neben Simon postierte, braune Dreckspritzer zeigten.
Steigleder war Bauer und bewirtschaftete einen kleinen Hof. Der Ortsgruppenführer hatte ihm den Posten im Lager verschafft, nachdem Steigleder einige Jahre an der Front gekämpft hatte. Bis zu einer schweren Verletzung. Dorthin zurückkehren? Lieber hätte er sich erschossen.
„Steigleder!“, raunzte ihn Mägerlein an, nachdem er den Mann eingehend gemustert hatte. „Dein Hosenstall …“ Steigleder drehte sich zum Wachhäuschen, er hatte nicht begriffen. „Steigleder!“, wiederholte der Stellvertreter. Ungeduldig deutete er auf den klaffenden Schlitz an Steigleders Hose, aus dem ein Zipfel seines Hemdes hing. „Was sollen die Weiber denken, so wie du herumläufst?“
Verlegen schob der Posten das Hemd durch den Spalt, schloss umständlich die Knöpfe und wartete auf Anweisung. Die Röte in seinem Gesicht hielt sich hartnäckig.
Mägerlein sah zu den Frauen. Ungeduldig ging er einige Schritte auf und ab.
„Wir haben nicht viel Zeit, in der Fabrik warten sie schon. Steigleder! Zwanzig Mann kommen zum Ziegelverladen. Fünf Leute braucht die Gerberei.“
„Welche?“
Mägerlein schnaubte. „Such dir welche aus, die nicht gleich das Kotzen anfangen. Die Aufseherinnen dazu, die können gleich mithelfen. Sind auch nichts Besseres. Und du, Simon.“ Sichtlich genervt nahm der Stellvertreter die Mütze ab und streifte mit den Händen durch die lichten Haare. „Weißt, wo Gonnersdorf liegt?“
Simon nickte: „War schon öfter in Cadolzburg, da kommt man durch.“
„Sechs Weiber werden gebraucht“, befahl Mägerlein. „Geschickte Hände zur Kartoffelernte.“
„Mit dem Lastwagen?“
„Ihr lauft. Müssen sparsam umgehen mit dem Sprit.“
Simon brummte leise und hob die Hand wie ein Schuljunge. „Wie heißen die Leute im Dorf?“
„Froschauer, glaub ich, die findest schon. Sonst noch was?“
Simon schüttelte den Kopf. „Ich weiß schon, wo ich hinmuss“, dann stellte er seinen Karabiner auf den Boden.
Eine Aufseherin führte die ausgewählten Erntehelferinnen durch das Tor. In Zweierreihen stellten sie sich vor Simon auf.
Neben der jungen Ukrainerin stand vorn eine Frau mit einem hellblauen Kopftuch. Das ausgemergelte Gesicht war gerötet, der hervortretende Kiefer ständig in Bewegung, ihre Zähne knirschten.
Die braunen Augen der großen, älteren Frau in der zweiten Reihe steckten in tiefen Höhlen, scharfe Falten zogen sich über die Stirn. Die dünnen Arme hingen schlaff herab. Sie war schon länger als die üblichen zwei Monate im Lager. Unter dem zerrissenen Kittel trug sie einen dreckigen Rock, darunter eine viel zu weite, nur noch aus Fetzen bestehende Stoffhose. Eine klaffende Wunde an der Wade blutete, ihr Strumpf war schon rot gefärbt.
Ein Fuß der Frau neben ihr war nur mit Stofffetzen umwickelt, die Enden mit Knoten fest verzurrt. Ihr braunes Kopftuch hatte sie um den anderen Fuß geschlungen, damit sie nicht barfuß laufen musste.
Neben einem Mädchen mit jungenhaftem Gesicht hielt sich ein älteres Mütterchen in gebückter Haltung gerade noch auf den Beinen. Ihre hellwachen blauen Augen waren ständig in Bewegung, doch sie wirkte erschöpft, die Beine zitterten, und je mehr sie es zu unterdrücken suchte, desto schlimmer wurde es. Unter keinen Umständen wollte sie im Lager bleiben.
Simon schüttelte den Kopf, er schämte sich. Was sollten die Leute denken, wenn er mit diesen zerlumpten Gestalten daherkam?
Die Frauen mühten sich, das vorgegebene Tempo einzuhalten, das ihnen Simon mit beherzten Schritten vorgab. Erst als der Posten merkte, dass die Alte nicht mithalten konnte, zügelte er seine Geschwindigkeit. Ärgerlich presste er die Lippen aufeinander, seine buschigen Augenbrauen zogen sich zusammen, aber er sagte nichts.
Zügig erreichten sie den Außenbereich. Das junge Mädchen drehte sich um. Neugierig musterte die Fünfzehnjährige die Umrisse. Deutlich erkannte sie drei Baracken, getrennt durch große Appellplätze, umschlossen von einem hohen Zaun. Dahinter konnte sie die Unterkunft für das Wachpersonal und die Kommandantenstube sehen, neben der Küche mit den drei Rauchrohren. Hinter der Frauenbaracke stand eine wuchtige Trafostation und an allen vier Seiten hinter dem niedrigen Stacheldrahtzaun erkannte sie die überdachten Wachtürme, die aussahen wie mächtige Hochsitze. Weit außerhalb standen einzelne Häuser im Rohbau, sogenannte Behelfsheime für die Vorgesetzten, und noch weiter weg erhob sich die große Backsteinfabrik mit ihren riesigen, Rauch speienden Schloten.
Der Abstand zwischen den Frauen hatte sich vergrößert. Simon drehte sich um und sah die Heranwachsende, die wie im Traum in die Tongrube hinüberstarrte.
Der viel zu große blaue Arbeitskittel reichte ihr fast bis zu den Knöcheln. Schuhe besaß sie keine. Die dicken Strümpfe waren mit Erde verklebt und zerlöchert. Es war egal, von welcher Seite sie angezogen wurden.
„Schau bloß, dass du herkommst, sonst schieß ich!“, brüllte Simon, das Gewehr im Anschlag.
Mit erhobenen Händen, schreiend und flehend kam die Kleine gerannt und kniete sich vor ihm hin. Ihre Lippen zitterten. Simon trat einen Schritt zurück und legte das Gewehr über die Schulter. „Passt schon, Kind, kannst ja nichts dafür, bist ja noch so jung.“
Schweigend marschierten sie weiter durch eine ausgeschwemmte Hohlgasse, deren mit hohem Gras bewachsene Böschung in eine dichte Hecke überging.
Die nachfolgenden Äcker waren klein und verwinkelt. Umgeknickte Stoppeln ragten aus der nackten Erde. Die Gräser am Wegrand trugen an der sonnenabgewandten Seite noch immer frischen Tau, während die abgemähten Wiesen im Waldschatten, mit zahlreichen Spinnennetzen überzogen, beim Licht der ersten Sonnenstrahlen in allen erdenklichen Farben glitzerten.
Nach kurzer Zeit erreichten sie einen Kiefernwald, am Rand von einzelnen Eichen unterbrochen, deren weit ausladende Äste fast den Boden berührten. Vögel zwitscherten, heruntergefallene Nadeln machten den Pfad angenehm weich, eine Wohltat für die in der Lehmgrube geschundenen Füße.
Der Waldweg endete wiederum an einer dichten Hecke. Eine weiträumig offene Landschaft mit Wiesen und größeren Äckern lag vor ihnen. Zahlreiche mit Feldsteinen befestigte Wege kreuzten sich und führten, gesäumt von niedrigen Gehölzen, zu den verschiedenen Grundstücken. Weit im Süden erkannten sie einen bewaldeten Höhenrücken.
Zwischen mächtigen Baumkronen ragten nun steile Dächer immer weiter hervor, je näher die Gruppe an den von Pappeln und Erlen gesäumten Wiesengrund kam.
Die Alte musste niesen. Schon eine Weile zog sie ihren Schleim kräftig nach oben und mühte sich vergeblich, dieses Geräusch zu unterdrücken: „Hatschi.“
„Nastrowje“, sagte Simon und drehte sich grinsend um.
Als die Leute das Dorf erreichten, kamen sie an einer Mühle vorbei und überquerten auf einer alten Sandsteinbrücke den Bach.
Stattliche Höfe mit breiten Toren und hohen Steinpforten reihten sich auf beiden Seiten der geschotterten Straße aneinander. Hunde an langen Ketten bellten und bewachten die Haustüren. Sandsteingiebel, zierliche Gauben auf den steilen Dächern, verwittertes Fachwerk an Scheunen und Ställen kamen zum Vorschein. An allen freien Plätzen standen Bäume. Apfelbäume, Birnbäume, Nussbäume, große Linden und Eichen mitten in den Höfen und Gärten. Ein schönes, ein reiches, ein freundliches Dorf. Die Gefangenen staunten.
Ansonsten wirkte der Ort wie ausgestorben, die Menschen schafften noch in den Ställen oder holten Grünfutter für die Kühe. Nur eine Bäuerin in bestem Alter wartete am Anwesen unterhalb des Milchhauses. Sie trug ein weißes Kopftuch über ihrem dunklen Schopf. Das am Hals aufgeknöpfte Kleid gewährte einen tiefen Einblick in ihre Oberweite. Die nagelneue dunkelblaue Schürze reichte fast bis zum Boden. Nur ihre ausgetretenen Gummistiefel zeugten von der harten Arbeit. Neben ihr stand schweigend die Altsitzerin, eine hagere Frau, die bald wieder im Haus verschwand.
„So, Froschauerin. Wir sind da. Hast lange warten müssen?“, fragte Simon.
„Ich bin doch so froh, dass ihr kommt.“ Die Bäuerin schlug die Hände zusammen. „Mein Mann ist in Russland, der eine Sohn ist schon vor drei Jahrn in Frankreich gfalln, der andere ist bei der Hitlerjugend droben in der Burg und der Knecht taugt eh nicht mehr für die schwere Arbeit. Und unsere Kartoffeln …“
Simon hatte verstanden. „Wo ist denn dein Acker, und hast auch genug Werkzeug?“
„Na freilich, von der Nachbarin hab ich noch einige Körb, und Säcke habn wir selber genug. Ach je“, seufzte sie, „es ist ja alles so schlimm.“ Dann hetzte sie über den Hof am Misthaufen vorbei in die Scheune, die an den kleinen Kuhstall angebaut war, und zog einen alten Leiterwagen heraus, voll beladen mit leeren Säcken und einem Dutzend Weidenkörben.
Wie gebannt lauschten die Zwangsarbeiterinnen dem Gespräch. Ihre Augen richteten sich immer wieder zur Schwarzhaarigen, der Einzigen unter ihnen, die etwas verstand von dem, was die zwei redeten.
Die Ukrainerin jedoch blieb stumm, neugierig musterte sie den Hof. Der Kuhstall grenzte unmittelbar an das Sandsteinhaus mit seinen zahlreichen Sprossenfenstern, vergitterte Öffnungen unterbrachen die großen Quader, am Wetterbrett unter der Dachrinne hingen etliche Schwalbennester. Schrilles Gezwitscher der Jungvögel, die ihre Hälse streckten und begierig auf Nahrung warteten. Schwalbeneltern, die elegant auf den Nesträndern landeten und ihre Jungen mit Nahrung versorgten. Friedliches Treiben mitten im Krieg.
Das Stalltor war weit offen, der Raum dahinter prall gefüllt mit Grünfutter. Kühe konnte sie nicht erkennen, nur das Rasseln der Ketten verriet ihre Anwesenheit. An der Ecke duckte sich der Schweinestall neben die Scheune. Durch die Gittertür grunzte ein fettes Prachtexemplar. Ein Holzzaun mit verwitterten Brettern grenzte den Hof zur Straße hin ab.
Von Weitem näherte sich ein Geräusch. „Dock dock dock …“ Ein grau lackierter Traktor mit großen Reifen und gestutzten Kotflügeln tuckerte den Dorfberg herunter, einen gummibereiften Wagen am Zugmaul ziehend. Auf dem blechernen Sitz saß der Bauer, einen Strohhut auf dem Kopf. Auf dem Futterhaufen im Hänger lagen zwei Frauen mit Rechen und Gabeln in den Händen. Eine dicke mit kräftigen Oberarmen und eine dürre mit zerzausten roten Haaren, die im Fahrtwind durcheinanderwirbelten.
Ohne Regung fuhren die Leute an der Gruppe vorbei und bogen gegenüber in den schmalen, mit Granitsteinen gepflasterten Hof ein. Lautstarkes Brüllen von Kühen, Ochsen und Kälbern drang aus dem Gebäude hinter dem Haus. Es hörte erst auf, als der Bauer den Motor abstellte.
Der Arbeitstrupp folgte nun der Bäuerin, die mit ihrem Leiterwagen den Dorfberg hinaufeilte. Am Ende der Steigung stand das Wirtshaus, verdeckt von einer uralten Kastanie, deren Äste bis weit in den Hof reichten. Ein großes Schild hing über der Eingangstür: Zur grünen Au.
Simon konnte kaum mithalten. Die Alte aus der Gruppe verlor nach kurzer Zeit den Anschluss und humpelte verzweifelt hinterher. Simon ließ die Bäuerin laufen und wartete.
Einen halben Kilometer nach der Ortschaft bog die Frau in einen holprigen, ungepflegten Weg ein. Im Schatten einer Eiche vor ihrem Feld, auf drei Seiten von Kiefernwald umgeben, blieb sie stehen. Die Arme in die Hüfte gestemmt, wartete die Froschauerin ungeduldig auf die Helferinnen.
Der alte Knecht mühte sich bereits auf dem Acker. Mithilfe eines abgemagerten Ochsen als Zugtier förderte er mit dem Kartoffelroder die begehrten Knollen aus der Erde. Knirschend durchschnitt die breite Schar das Erdreich und beförderte die braune Masse zu einem rotierenden Rechen, der Kartoffeln und Erde trennte und zur Seite schleuderte. Wie Steine im Flussbett lagen sie nun weit verstreut auf dem Acker. Große und kleine Kartoffeln, runzlige, verfaulte, schorfige, giftgrüne und reife, zwischen verdorrtem Kraut und unzähligen Erdklumpen.
Mit kurzen Schritten lief der Knecht hinter der Maschine her. Seine blaue Schürze reichte bis zu den Knien und verdeckte die Manchesterhose, deren weit geschnittener Bund, von strammen Hosenträgern bis zum Nabel hinaufgezogen, am mageren Körper baumelte. Der rundliche Kopf wirkte auf den schmalen Schultern und dem sehnigen Hals wie aufgesetzt, als hätte er ein eigenes Gewinde und ließe sich beliebig oft im Kreis drehen.
Aufmerksam war der grauhaarige Mann darauf bedacht, vorn den Ochsen und den Roder, seitlich die Kartoffeln und zugleich den Weg nicht aus den Augen zu lassen, außerdem aber nach feindlichen Tieffliegern Ausschau zu halten, die jetzt auch hier immer öfter ihre Bahnen zogen. Unablässig schimpfte er mit dem braunweiß gescheckten Zugochsen, der mehr auf den Beeten als zwischen den Reihen herumtrampelte.
„Krüppel, damischer!“, fluchte er mit schriller, dünner Stimme. „Schau dassd richtig läufst. Gradaus, du Depp, ja bist denn bsoffn?“ Immer wieder drohte er mit dem Ochsenziemer, schlug aber nie zu. Bei der Rast am Vorgewende hatte der Ochse Schaum vor dem Maul und auch dem Knecht lief ein dünnes Rinnsal aus dem Mund, so sehr hatten sich beide aufgeregt.
„Die Leut sind gleich da“, rief ihm die Bäuerin zu, doch längst hatte er die Gruppe am Weg erblickt. Geschickt wendete der alte Mann das Gespann und setzte es in der nächsten Reihe wieder ein. Mit hochrotem Kopf schwang er die Zügel und redete zu dem Tier: „Was willst denn mit denen, die sind ja noch dürrer wie du, hopp, weiter, du Krüppel, du damischer.“
Kaum waren die Frauen angekommen, drückte die Bäuerin jeder einen Korb in die Hand. Sie deutete bestimmt auf die Kartoffeln zwischen dürrem Kraut und aufgeworfener Erde. Die Zwangsarbeiterinnen verstanden. Mit großem Eifer machten sie sich an die Arbeit. Eine Knolle nach der anderen flog in den Korb.
„Halt, halt!“, rief die Bäuerin aufgeregt. „Nicht gut, nicht gut machen.“
Die Frauen blickten sie unsicher an, während Simon nur mit den Achseln zuckte. Dann bückte sie sich selbst und stellte zwei Körbe vor sich hin. „Dieser Korb“, erklärte sie umständlich, „große Kartoffel.“ Mit den Händen formte sie eine Kugel, mit dem Zeigefinger deutete sie auf ihren Mund. „Kloß machen, gut essen“, dabei rieb sie sich mit der Hand über den fülligen Bauch.
„Anderer Korb, Äbiernbobbäli – kleine Kartoffel.“ Sie deutete auf eine kleine Knolle am Boden, hielt sich schließlich beide Hände mit gespreizten Fingern an die Ohren und grunzte laut. „Äbiernbobbäli für Schwein, ja?“
Willig begannen die Frauen aufs Neue, gebückt, die Beine durchgestreckt, wie die Bäuerin es vormachte. Sie sammelten emsig die Knollen und warfen die großen in den einen Korb, die kleinen in den anderen. Der Rücken schmerzte mit der Zeit, die Beine fingen an zu zittern und vor den Augen tanzten bald schwarze Flecken. Erschöpft sanken zuerst die Älteren auf die Knie, später ließen bei den anderen die Kraft nach, nur das Mädchen hielt etwas länger durch, dann gab es ebenfalls auf.
Die Frauen mühten sich, so gut sie noch konnten, doch der Boden war rau und klumpig. Halb kniend, halb sitzend schoben sie sich vorwärts. Viele Kartoffeln waren von loser Erde bedeckt und mussten mit bloßen Händen ausgegraben werden.
Wie ein Luchs achtete die Bäuerin darauf, dass auch die kleinsten Knollen aufgelesen wurden, immer wieder kontrollierte sie das abgeerntete Feld. Im Grunde ging es ihr zu langsam, trotzdem war sie zufrieden. Viele langsame Hände schafften mehr als wenige flinke. Keine einzige Zurechtweisung kam ihr über die Lippen. Der erbärmliche Zustand der Frauen blieb ihr nicht verborgen und wenn sie nicht viel kosteten, rentierten sie sich allemal.
Geschickt leerte die Bäuerin die vollen Körbe in die mitgebrachten Säcke, die sie mit einer festen Schnur verschloss und sorgfältig in einer Reihe abstellte.
Simon kauerte unterdessen auf einem alten Hochsitz am Waldrand. Jäger hatten ihn vor langer Zeit zwischen zwei Kiefern aufgestellt, das Holz war morsch und verfault, einige Sprossen, die zum Sitzbock hinaufführten, fehlten. Doch jähe Müdigkeit und der Gedanke, bequem zu sitzen und die Gruppe von oben zu beobachten, waren stärker gewesen als seine Vorsicht.
Das Gewehr lag auf seinen angewinkelten Beinen, immer wieder fielen ihm die Augen zu. Erschrocken strich er sich mit den Fingern über die Stirn. Die Vorstellung, eine der Zwangsarbeiterinnen könnte versuchen zu fliehen, bereitete ihm trotz der wohligen Wärme eine Gänsehaut. Freilich war es unmenschlich, was sie im Lager ertragen mussten, dachte Simon, aber eine Flucht würde er niemals dulden, er würde sofort schießen, dessen war er sich sicher. Schließlich hatten die Weiber was ausgefressen, sonst wären sie ja nicht hier, oder?
Die Uniformjacke wurde dem Posten zu warm, doch er traute sich nicht, sie auszuziehen. Was sollten die Frauen denken, wenn er hemdsärmelig auf sie aufpasste. Steigleder kam ihm in den Sinn. Der hätte sich schon längst das Hemd runtergerissen und die Hose womöglich auch noch. Aber Steigleder hatte keinen Sinn für Ordnung, er war doch nur ein stinkender Bauer.
Weit entfernt schlug die Kirchenglocke in Rossendorf das zehnte Mal. Eine kräftige Frau eilte in Gonnersdorf über die Straße, direkt auf den Hof der alten Froschauerin zu, als diese das hölzerne Tor von außen verschließen wollte. „Guten Morgen, Nachbarin, hast es recht notwendig, gell?“
Erschrocken drehte sich die Alte um. Ihre spärlich gewachsenen Augenbrauen hoben sich, als sie die redselige Marie Heubeck erblickte, die in einem knielangen, rot-weiß gepunkteten Kleid und einer braunen Schürze über die Straße kam. Sie trippelte leicht und drehte auffällig die Füße nach innen. Die große Brust schwang beim Gehen und die Arme halfen dem fülligen Körper, schneller vorwärtszukommen. Das weiße Kopftuch war weit nach hinten gebunden, die rundliche Stirn von der Sonne gegerbt, ihre braunen Augen glänzten vor Aufregung.
„Ich hab schon gsehn, dass ihr Helfer habt“, rief sie. „Aber die Weiberleut können ja vor Elend nicht mal grad stehn!“
„Aber arbeitn sollns gut können“, verteidigte sich die Alte. „Das hat der Bürgermeister gmeint, als er sie uns vermittelt hat. Weißt, die sind vom Lager aus Langenzenn.“
Marie runzelte die Stirn. „Was, in Langenzenn gibts ein Lager? Das hör ich zum ersten Mal. Die sind ja halb verhungert.“
„Ich weiß schon“, sagte die Alte mit aufgerissenen Augen. „Aber der Posten hat zu meiner Frieda gsagt: ‚Zu essn braucht ihr nix machn, die habn im Lager genug. Außerdem ist es verbotn‘, hat er gsagt. Aber man kann doch nicht den ganzen Tag arbeitn und nix essn!“
„Da hast recht“, sagte die Nachbarin. „Das wär eine Sünd, wenn die nix kriegn tätn, und alles, was den Bonzen einfällt, muss man sich nicht gfalln lassn.“
Die Sorgenfalten der alten Froschauerin wurden noch tiefer, umständlich versuchte sie, sich am Rücken zu kratzen, kam aber nur bis zum Hals. Dann lehnte sie sich an die Steinsäule, an der das Tor befestigt war, und rieb sich an ihr. „Aber ich weiß gar nicht, wie ich das Mittagessen fertigbringen soll, und das Laufen geht doch auch nimmer so gut!“, jammerte sie. Erwartungsvoll sah sie die Nachbarin an. Schließlich war das Verhältnis zu den Heubecks so gut wie zu keinem anderen im Dorf.
„Ich helf dir doch gern“, beruhigte sie die Heubeckin. „Und ich fahrs dir dann auch hinaus. Ists recht?“
Schlag zwölf Uhr erreichte Marie den Kartoffelacker. Das alte Leiterwägelchen mit den Speichenrädern und den Sprossenwänden war voll beladen mit dampfenden Töpfen, emaillierten Kannen und blechernen Tellern. Hastig breitete sie eine Decke im Schatten der Eiche aus und stellte die dampfenden Klöße, das aufgeschnittene Brot, dazu zwei Dutzend gekochte Eier und einen großen Krug mit Pfefferminztee auf den Boden. Dann winkte sie der Bäuerin und den Zwangsarbeiterinnen, die sich unschlüssig erhoben und der Froschauerin folgten.
Der Ochse graste bereits gierig am Wegrand. Die ausgehängten Leinen hinter sich herziehend, machte er keine Anstalten fortzulaufen, zu sehr folgte er dem Knecht aufs Wort. Der aber genierte sich und setzte sich neben dem Tier ins Gras, weit weg von den anderen. Später brachte ihm die Froschauerin das Essen.
Schweigend stellten sich die Sträflinge in einer Reihe auf und rührten sich nicht. „Essen!“ Die Bäuerin deutete immerfort auf ihren Mund und dann auf die Klöße: „Du essen.“
Erst als sie mit der flachen Hand auf ihren Bauch tätschelte, kniete sich das Mädchen auf die Decke, nahm den Teller in die Hand, den ihr die Heubeckin reichte, und fasste mit dem Schöpflöffel einen Kloß. Sie nahm sich eine Scheibe Brot, eine Kartoffel und ein Ei und versuchte, den Kloß zu zerteilen, bis sie ihn schließlich in die Hand nahm und davon abbiss wie von einem Stück Kuchen. Das Besteck beachtete sie nicht. Die anderen machten es ihr nach und schlangen das Essen hinunter, die wachsamen Augen immer wieder auf den Posten gerichtet, der unbeweglich am Hochstand hockte.
Die Bäuerin schüttelte ungläubig den Kopf. In kurzer Zeit hatten die Frauen fast alles verzehrt. Sie lief hinüber zum Hochsitz und fragte den Posten, ob er auch Hunger habe.
Barsch antwortete Simon: „Vesper hab ich selber dabei, aber was zu trinken kannst mir bringen, Bäuerin. Die Bagaasch braucht ihr nicht mästen wie die Säue, die sollen was arbeiten“, entgegnete er schroff. „Ich hab sie nicht zum Fressen rübergebracht. Um sechs ist Feierabend, dassd es weißt, Bäuerin.“ Simon holte noch einmal tief Luft und streckte seinen Oberkörper durch. „Was ihr heut schafft, das habt ihr. Morgen habens eine andere Arbeit, also bring was zu trinken.“
Die Heubeckin aber hatte das verletzte Bein der alten Frau entdeckt. Immer wieder dachte sie an das blutdurchtränkte, von Erde verkrustete Tuch, mit dem es notdürftig umwickelt war. Das schmerzverzerrte Gesicht der Älteren, die ausgezehrten Leiber all der anderen, dürr wie Vogelscheuchen, ausgemergelt, bis auf die hübsche Dunkelhaarige. All das brachte sie zum Nachdenken.
Sie nahm die Kanne mit dem letzten Rest Tee und marschierte entschlossen zu Simon, der bereits vom Sitz herabgeklettert war. Gereizt nahm er die Kanne und schüttelte sie hin und her. „Da ist ja fast nichts mehr drin.“
Die Heubeckin stemmte die Hände in die Hüfte. Ihr Ton klang scharf, ihre Augen blickten Simon furchtlos an. „Ich hab bloß mal fragn wolln, ob die Leut bei euch nix zum Essen kriegn. Die schaun ja aus wie das Elend selber.“
„Kümmer dich um deinen eignen Dreck, Frau.“ Simon war ungehalten. „Du kannst gleich mitkommen, wenn du willst. Tät es dir aber nicht raten.“
„Ich hab zu Haus genug Arbeit“, konterte sie energisch. „Dem Herrgott gfällt es bestimmt nicht, so wie die beieinander sind“, meinte sie hartnäckig, „und die eine braucht einen Doktor, der Haxen schaut ja schlimm aus.“
Simon rang um Fassung. „Wenn du jetzt nicht dein Maul hältst auf der Stell“, drohte er, „werd ich Meldung machen. Dann wirst schon schaun.“
Sie drehte sich um, griff an der Eiche nach der Deichsel des Leiterwägelchens und zog es den holprigen Weg entlang hinter sich her. Ihre Nächstenliebe ließ sie sich nicht verbieten, ihr Maul jedoch, so wie es ihr der Posten geraten hatte, wollte sie halten …
Nachmittags ging den Frauen die Arbeit nur schwer von der Hand. Mit ungewohnt vollem Magen, von Blähungen behindert, entkräftet, mit schmerzendem Rücken und geschundenen Knien füllten sie die Körbe nur langsam. Immer öfter bückte sich die Froschauerin selbst und half beim Einsammeln.
Was sollte sie klagen! Sah sie doch, wie sehr sich die Frauen mühten, wie sehr sie unter der Last des Korbes stöhnten, den sie vor sich herschoben, oder der Last des Körpers, der auf den kantigen Erdklumpen irgendwie vorwärtskommen musste. Andererseits sah sie den großen Acker, die vielen Kartoffeln, die bereitlagen, die vielen Reihen, die der Knecht noch roden wollte – und sie sah das Wenige, was in Säcke gefüllt, aufgereiht am Acker stand.
Zu ihrer Überraschung kam Marie Heubeck kurze Zeit später auf dem Fahrrad keuchend und prustend den Feldweg entlanggeradelt. Mit einer Hand hielt sie den Lenker, in der anderen einen Korb. Zielstrebig marschierte sie über die Furchen zu der Frau mit der verletzten Wade. Den Posten am Waldrand, der einige Schritte auf das Feld zuging und drohend das Gewehr in den Händen hielt, würdigte sie keines Blickes.
Verunsichert wehrte sich die Verletzte: „Njet, njet.“ Immer wieder schaute sie ängstlich zum Wald.
„Brauchst keine Angst habn“, sprach die Nachbarin leise mit derselben sanften Stimme, mit der sie ihre erschrockenen Kühe beruhigte, wenn sie es nötig hatten. „Ich will dir doch bloß helfn.“
Schließlich gab die Frau nach, setzte sich auf den Boden und streckte stöhnend das kranke Bein aus.
Die Heubeckin erschrak, als sie den verklebten Stofffetzen von der Wade gelöst hatte. Altes, zerrissenes Fleisch klaffte ihr entgegen, braunrotes Wundwasser tropfte auf den Boden. Weniger tiefe Kratzer gingen nahtlos über in die gesunde Haut. Sie schüttelte immer wieder den Kopf, während sie die Wunde mit einem Lappen reinigte.
Die Frau zischte leise und biss die Zähne zusammen, als Marie vorsichtig hochprozentigen Klaren auf das verletzte Fleisch tupfte. „Gleich habn wirs.“ Sie wusste genau, wie sehr der Schnaps auf einer offenen Wunde brannte. Dann umwickelte sie das Bein mit einem weißen Leinentuch.
„Grad, als wenn du es glernt hättst. Bist schon eine gute Haut, Marie“, lobte die Froschauerin.
„Passt schon.“ Kurz angebunden ergriff Marie die Hand der kranken Frau und half ihr auf die Beine. Die Zwangsarbeiterin verzog keine Miene, nur einen kurzen Moment sah sie der Deutschen in die Augen, kaum verständlich murmelte sie: „Balschoje spassiba, spassiba.“
Vom Posten unbemerkt zog Marie im Vorbeigehen ein altes Paar Kinderschuhe aus dem Korb und ließ es neben dem jungen Mädchen auf den Boden fallen. Dann eilte sie über die Beete zu ihrem Fahrrad und fuhr zurück zum Hof.
An der Einfahrt zur Straße ins Dorf kam ihr die alte Froschauerin entgegen. „Danke Marie, für die Hilf“, rief sie ihr von Weitem zu. Die Heubeckin nickte nur kurz, schon war sie hinter der Hecke verschwunden, die die geschotterte Straße bis ins Dorf begleitete.
Wiederholt zog Simon seine Uhr aus der Tasche, ungehalten ging er auf und ab und starrte auf das Feld, das nicht einmal zur Hälfte abgeerntet war. Die Sonne war längst hinter den hohen Kiefern verschwunden, es begann schon zu dämmern.
Entschlossen ging er zur Bäuerin und hielt ihr seine Uhr unter die Nase. „So, Frau, jetzt ist Schluss.“
Die Froschauerin sah ihn entsetzt an. „Aber …“
„Nix aber, wir müssen noch zurück. Für heut reichts.“ Er steckte zwei Finger in den Mund und pfiff. Die Frauen gehorchten wie Hunde. Aufgereiht standen sie vor ihm und warteten auf das Kommando.
„Dankschön“, rief ihnen die Froschauerin hinterher, nachdem sich der Posten mit einem strammen „Heil Hitler“ verabschiedet hatte.
Der Knecht zog den Abend über mit dem alten Ochsen noch seine Runden und rodete einige Reihen für den morgigen Tag. Immer wieder hörte man seine Stimme: „Krüppel, damischer, schau dassd weiterkommst, hopp, Krüppel, du damischer …“
Schweigend marschierten die Zwangsarbeiterinnen den Dorfberg hinab. Am Milchhäuschen in der Dorfmitte stand eine Handvoll Kinder, die den kleinen Trupp beäugte, als käme er aus einer anderen Welt.
Überall in den Ställen arbeiteten wieder die Leute, Kühe brüllten, Schweine grunzten, ein Traktor tuckerte im Hinterhof und das Wasser plätscherte im kleinen Bach, als sie die Brücke überquerten.
Die Sonne war längst untergegangen. Gespenstisch reckten sich die Kronen der alten Eichen in den Himmel, ab und zu schrie ein Käuzchen, als sie den weichen Waldweg zurückgingen. Sonst war es still, nur das gequälte Atmen der Frauen störte die Idylle.
Kurz vor dem Städtchen hörten sie lautes Hundegebell, schrille Stimmen, Kommandos und jämmerliches Geschrei. Immer wieder ertönten die Trillerpfeifen.
Den Frauen klopfte das Herz, ihre Blicke verrieten nichts als Sorgen und Angst.
„Halt!“ Simon stoppte. „Kurze Pause, ihr könnt euch hinsetzen.“
Die Frauen kauerten sich aneinander, einige fröstelten leicht, nur das Mädchen schien ein wenig zu lächeln, immer wieder strich sie mit den Händen über das weiche Leder ihrer Schuhe.
Der halbe Mond stieg langsam im Osten auf. Die Dämmerung war nun vollständig in Dunkelheit übergegangen, nur ein flacher Streifen am Horizont war noch übrig vom vergangenen Tag.
Hastig stand Simon auf, klopfte sich den Hosenboden ab und ging langsam weiter, die Frauen folgten ihm.
Am Haupttor meldete er sich beim Posten. Eine Aufseherin eilte aus der Wachbaracke und führte den Arbeitstrupp über den menschenleeren Hof zur Unterkunft. Verbrauchte Luft strömte den Frauen entgegen. Der Geruch von Schweiß und anderen Hinterlassenschaften quälte die Nasen. Kein Wort war zu hören, nur lautes Atmen, verzweifeltes Stöhnen und hartnäckiger Husten.