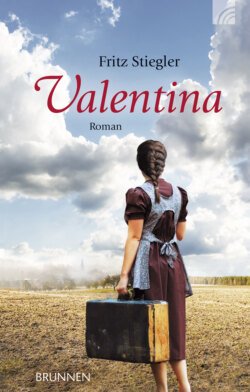Читать книгу Valentina - Fritz Stiegler - Страница 9
EINE STADT IN DER UKRAINE
ОглавлениеAuf dem Heuboden war es finster, als Valentina sich durch die schmale Öffnung zwängte. Im Lager hatten sie von der Schweiz erzählt, dort gab es keine Nazis. Man würde sie aufnehmen und nach dem Krieg nach Hause schicken. Träume. Valentina schüttelte den Kopf, hier bekam sie reichlich zu essen, nur dem Bauern traute sie nicht.
Die Umrisse im riesigen Heuboden waren nur schemenhaft zu erkennen. Alles verfloss zu einer Einheit aus Bauwerk und Finsternis, zu einem drohenden Gebilde, das ihr Angst machte. Hastig schlüpfte sie zurück. Ihr Versteck beschränkte sich auf die paar Quadratmeter, auf denen sie nun seit einigen Stunden hauste. Stunden, die ihr wie eine halbe Ewigkeit vorkamen.
Ungeschickt stieß sie an die Milchkanne und schüttete mit ihr den ganzen Korb um. Der Inhalt verteilte sich im losen Heu, das sie nun hastig durchwühlte. Die Kanne war fast ausgelaufen, Wurst und Brot kamen Valentina zwischen die Finger, ein Messer. Vorsichtig strich sie über die Schneide, sie war stumpf, ein Teil des Holzgriffes schien abgebrochen.
Umständlich tastete sie sich an der Wand entlang. Sie spürte den Backstein, den sie mittags schon entdeckt hatte. Er ließ sich ohne Widerstand herausziehen. Ein schwacher Lichtstrahl drang durch den Schlitz und vermischte sich mit der Dunkelheit. Umrisse der Balken zeichneten sich ab.
Mit dem Messer lockerte Valentina weitere Backsteine und zog sie aus dem Verbund. Vorsichtig steckte sie ihren Kopf durch die vergrößerte Öffnung. Geblendet von ungewohnter Helligkeit blinzelte sie. Eine gespenstische Mixtur von Blau und Schwarz, durchtränkt von einzelnen Nebelschwaden, verteilte sich über die Landschaft. Vollmond. Valentina erinnerte sich, er hatte ihr gestern den Weg gewiesen. Bald würde er über das riesige Scheunendach wandern und die Landschaft, die vielen Bäume, den schönen Lindenbaum hinter der Scheune mit seinem Licht verzaubern.
Valentina schöpfte Hoffnung. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte sie sich geborgen, doch wusste sie genau, es war nur für einen kostbaren Moment. Sie wagte kaum, an den nächsten Morgen zu denken. Trotz Erschöpfung und Müdigkeit konnte sie nicht einschlafen.
Immer wieder blickte Valentina durch die Lücke. Sie dachte an daheim, an ihr Elternhaus, an die Stube, die sie mit ihrer Schwester teilte. An die Stadt, in deren Nähe sie bis zum Sommer 1943 gelebt hatte – Dnjepropetrowsk in der Ukraine …
Kleine baufällige, oft notdürftig reparierte Häuschen aus Holz mit Strohdächern standen eng nebeneinander an der langen, im Sommer staubigen, im Winter knöcheltief morastigen Straße. An die Rückseiten der Häuser schmiegten sich verschachtelte Ställe für ein paar Kühe und Ziegen, durch eine Tür mit dem Wohnraum verbunden wegen der Kälte in den strengen Wintern. Die Hühner, Enten und Gänse lebten meist auf der Straße, badeten im feinen Sand und verschmutzten mit ihren Hinterlassenschaften die Wege. Mit wettergrauen Brettern eingezäunt, fanden sich zur Straßenseite hin Gärtchen für Gemüse und Würzkräuter.
Etwas außerhalb bestellte jede Familie ein winziges Stück Land, das ihnen zur Selbstversorgung überlassen wurde. Die Menschen beugten sich der russischen Regierung, sie gebrauchten die offiziell verordnete Sprache und gehorchten den Kontrollorganen. Zu Hause aber, wenn keiner aufpasste, pflegten sie ihre ukrainischen Wurzeln.
Anfangs hofften die Menschen, dass sich durch die deutschen Besatzer ihre Situation verbessern würde. Viele Männer schlossen sich freiwillig der Wlassow-Armee an, einer russischen Truppe unter deutschem Kommando. Doch schon bald begriff die Bevölkerung, was die Deutschen im Schilde führten.
Soldaten kamen mit Krad und Kübelwagen, mit Panzern und Lastern. Soldaten mit Hakenkreuzen an Ärmeln und Mützen vertrieben die Hühner, Enten und Gänse von der Fahrbahn und hüllten die Ortschaft in Staub. In der Ortsmitte hissten sie ihre rote Reichskriegsfahne mit dem Hakenkreuz. Die Einwohner trieben sie mit Gewehren zusammen. Die Jungen und Kräftigen, die Arbeitsfähigen mit flinken Händen, die Gesunden suchten sich die Besatzer aus, um sie mit Lastern in die große Stadt zu transportieren.
Valentina ließen sie keine Zeit, sich von der Familie zu verabschieden. Auf einen Pritschenwagen gepackt, zwischen fünfzig jungen Leuten, meist Frauen, und einigen Kindern, sah sie ihren Vater das letzte Mal, als er dem Laster hinterherrannte, bis sie ihn aus den Augen verlor.
Dicht gedrängt mit Bündeln oder Körben in der Hand standen, saßen oder lagen die Menschen in Dnjepropetrowsk in einer stickigen Halle und warteten. Grimmige Soldaten mit Gewehren im Anschlag bewachten die Eingänge. Ab und zu fielen Schüsse. Flüchtende wurden erschossen. Am Abend schafften die Deutschen große Kannen mit Malzkaffee herein. Panik kam auf. Geschrei. Wieder krachten Schüsse. Vom Gebälk an der Decke prasselten Holzfasern herunter. Die Leute drückten und schoben, Kaffeekannen stürzten um. Die braune Brühe verteilte sich am Boden. Durstige sammelten Reste mit der hohlen Hand auf oder schlürften den Kaffee von den Brettern. Andere hatten Kleider und Nahrung mitnehmen dürfen, die sie großzügig mit denen teilten, die nichts mehr besaßen. Nun trugen Soldaten Wannen ins Gebäude und füllten sie mit Wasser.
Ein Stück Brot und eine Kartoffel erhielten die Menschen erst am Morgen, bevor die Soldaten sie sortierten wie Vieh, sie auf Laster luden und zum Bahnhof karrten. Dort wartete bereits ein Güterzug. Aufgeregte Soldaten sicherten die Transportwege und trieben die Menschen in die Waggons. Zusammengepfercht wie Rinder, fortgerissen von den Familien, waren alle im Ungewissen darüber, was mit ihnen geschah. Auch dann noch, als die Lok schwarze Wolken durch den Schlot presste und der Zug sich nach Westen in Bewegung setzte.
Valentina kannte nur eine Nachbarin und zwei junge Frauen, die mit ihr in die Schule gingen. Es war schwierig, zu ihnen zu gelangen. Die Menschen standen so dicht zusammen, dass sie kaum umfallen konnten. Ihre Notdurft mussten sie an Ort und Stelle verrichten. Der Gestank nahm zu. Die zwei Meter hohen Seitenwände waren nach oben offen. Ein auf der Bordwand sitzender Soldat bewachte den Waggon mit einem Gewehr in der Hand.
Der Durst wurde immer schlimmer. An den wenigen Bahnhöfen spritzten Männer mit Schläuchen über die Wände. Verzweifelt lechzten die Menschen nach Wasser. Valentina dachte an den Winter, an Frost und Kälte, an die offenen Wagen.
Ein Mädchen mit langen schwarzen Zöpfen weinte, ständig rieb es sich die Lider. Valentina arbeitete sich in seine Nähe vor, legte den Arm um die schmalen Schultern und zog das Kind an ihren Körper. „Wo ist deine Mama?“
Die Kleine sah Valentina verstört an. Die braunen Augen waren rot unterlaufen, immer wieder fing sie an zu schluchzen.
„Wie heißt du denn?“
„Sonja.“
„Deine Mama finden wir ganz bestimmt. Und so lange bleibst du bei mir.“ Sonja beruhigte sich nach und nach, sie wich nicht mehr von Valentinas Seite.
Unaufhaltsam rollte der Zug durch Wälder und Täler, durch weite Landschaften, Städte und Dörfer. An saftigen Wiesen, grasenden Kühen vorbei ratterten die Waggons über die Gleise, während Bauern auf den Feldern arbeiteten und Kühe voll beladene Heuwagen über holprige Wege zogen. Truppen, Panzer, Laster mit Soldaten auf der Ladefläche, Kübelwagen, Kradfahrer kreuzten den Weg der Eisenbahn, aber die Menschen in den Waggons sahen nur den Himmel, die Sterne in der Nacht und die grauen Bretter, die sie einhüllten wie Schafe im Pferch.
Drei Tage waren sie unterwegs, als der Zug in einem kleinen Bahnhof stoppte.
„Neumarkt/Oberpfalz“, schrie ein Bahnhofswärter durch das Megafon. Die Wand über der Tür zur Empfangshalle war mit großen fremdartigen Buchstaben bemalt. Neben der Tür hing eine rote Fahne mit einem schwarzen Hakenkreuz auf einem weißen runden Kreis. Sie waren in Deutschland.
Posten trieben die Menschen aus den Waggons und ließen sie antreten. Stundenlang wurde abgezählt und notiert. Schließlich setzte sich der lange Zug in Bewegung, durch das Städtchen an Fachwerkhäusern vorbei erreichten sie nach einer Dreiviertelstunde ein eingezäuntes Lager. Zwischen den Baumkronen waren Wachtürme zu erkennen.
Posten mit Hunden kontrollierten den Haupteingang. Die Leute mussten ihre Personalien angeben und bekamen eine Nummer. Später schleusten Aufseher die Menschen in geflieste Räume, um sie zu desinfizieren und zu entlausen. Nackt, nach Männern und Frauen getrennt, warteten sie dort auf ihre Kleider und wurden schließlich auf verschiedene Baracken verteilt.
Mit Gewalt zogen Posten das Kind von Valentina weg, das sich verzweifelt an ihren Arm krallte und nach Leibeskräften schrie. Schnell schafften sie Sonja in einen Nebenraum. Valentina sah das Mädchen nie wieder.
Schon nach kurzer Zeit gab es Verwendung für die Leute. Valentina schickten sie nach Nürnberg und boten sie am Arbeitsamt feil wie eine Sklavin.
Ein kräftiger, untersetzter Mann in Straßenkleidung stand am Schalter des Nürnberger Arbeitsamtes. Er diskutierte mit der Sekretärin. Seine riesigen Hände wanderten unruhig in den Hosentaschen umher, die sie nur kurz verließen, um den breiten Hut zu richten und ein Dokument zu unterschreiben. Ständig waren sie in Bewegung, ebenso die kleinen rundlichen Augen, die unauffällig die Frauen auf der Holzbank musterten, bevor sie an Valentina hängen blieben.
Die Frau wusste, sie konnte sich nicht wehren.
Der Mann kam langsam auf sie zu. Der breite Mund mit den fleischigen Lippen versuchte zu lächeln. Die Hände verschwanden wieder in den Hosentaschen. Seine Stimme klang warm, er redete langsam und deutlich. „Grüß Gott, kannst mit mir mitkommen.“ Valentina verstand nicht. Träge schlenderte er zum Ausgang, drehte sich wieder um und winkte ihr zu. Ergeben stand Valentina auf und ging ihm hinterher, folgsam wie ein Hündchen.
Alles war fremd. Die Stadt, die gepflasterte Straße, die wenigen Autos, die über das Kopfsteinpflaster rollten. Die Menschen, die hektisch ihre alltäglichen Pflichten verrichteten. Die hohen Sandsteinhäuser mit den unzähligen Sprossenfenstern, die wie Monumente in die Höhe ragten. Die roten, spitzen Dächer und die markanten Erker, die aus der Dachhaut ragten wie Nasen. Nur die Fahnen erkannte sie wieder. Die Fahnen mit den Hakenkreuzen, die überall aus den Fenstern hingen und sich nach dem Wind richteten.
Valentina zitterte vor Angst, als sie dem Mann in einen von hohen Mauern umgebenen Hinterhof folgte und er sie durch eine quietschende Tür in einen spärlich beleuchteten Raum mit winzigen Sprossenfenstern führte. Eine Werkstatt.
An der Wand hingen fein sortiert verschiedene Hämmer und Zangen. Ein großer Amboss stand in der Mitte, daneben zwei kleine Ambosse mit aufgesetzten Dreifüßen, die Hirschgeweihen ähnelten. Ein großes Regal an der Fensterseite war voll geschichtet mit Schuhen.
Noch nie hatte Valentina so viele Schuhe gesehen. Große und kleine, Kinderschuhe, Arbeitsschuhe, Soldatenstiefel, elegante Pumps, Straßenschuhe in allen Variationen. Neben dem Kanonenofen, dessen Rohr durch die Backsteinwand in den Hof ragte, stand ein bequemer Stuhl mit einer gepolsterten Lehne und einem kleinen Kissen auf der Sitzfläche.
Der Mann deutete auf das Regal: „Ist meine Werkstatt.“ Valentina nickte höflich. Die Angst schwand. Sie folgte ihm weiter durch den Nebeneingang eine steile Treppe hoch, die in einen schmalen dunklen Flur mündete.
Der Mann nahm die Hand aus der Hosentasche, leise klopfte er an die Tür. „Marga, sind da.“
Eine zierliche Frau mit hochgesteckten, weißen Haaren lag auf dem Sofa. Ein Krückstock lehnte an einem kleinen runden Tisch, der nah ans Sofa geschoben war. Die Frau richtete sich auf und musterte Valentina eine Weile. „Ich denk, die passt, Hans“, meinte sie schließlich. „Kanns auch ein wenig Deutsch?“
Er schüttelte den Kopf.
Enttäuscht blickte sie auf ihren Fuß. „Weißt“, sprach sie zu Valentina. „Der ist gebrochen. Die Treppe bin ich runtergesegelt“, meinte sie. „Weißt, hab nicht aufgepasst und dann wars geschehn. Halbes Jahr, meint der Doktor. Ganzes halbes Jahr und jetzt stehn wir da.“
„Ach ja“, seufzte ihr Mann und zog ein rundes Stoffstück aus der Tasche. „Den Fetzen hat mir die Frau vom Arbeitsamt mitgegeben.“
Marga fiel ihm ins Wort. „Hab ich schon gehört. Muss aufs Kleid. Ist Pflicht. Ist ein Ostarbeiterzeichen, das tragen alle von dort.“
Mühsam stützte sich die Frau auf ihren Stock, dann zeigte sie Valentina die Küche und einen kleinen fensterlosen Raum mit einem schlichten Bett, mit Schrank und Stuhl. Auf dem Schrank stand eine grün-rote Eisenbahn mit einem mächtigen Schlot und einem Kessel.
„Hier kannst schlafen. Haben nicht mehr Platz“, stöhnte die Frau. „Ist schon schlimm genug, der Krieg, und jetzt auch noch das.“
Zurück in der Stube, kramte sie Papier aus der Kommode und begann zu malen, dazu erklärte sie langsam und deutlich jede Handlung, jeden Arbeitsgang. Sie malte den Küchenschrank auf das Papier und das zugehörige Geschirr. Sie malte, wann es Zeit war zu kochen, zu putzen, zu waschen. Jedes Gerät zeichnete sie, jede Bürste, jeden Eimer, jede Kanne, jeden Faden, jede Nadel, jeden Gebrauchsgegenstand in der Küche. Im Schlafzimmer die Bettdecke, den Nachttopf, die wenigen Vorräte in der Speisekammer, Kartoffeln, ein wenig Mehl, einen halben Laib Brot, ein paar Eier. Bald fand sich alles auf losen Blättern, mit Bleistift gezeichnet, sorgsam aneinandergereiht und abgeheftet in einem grauen Ringbuch.
Im Lauf der Zeit wurden die Zettel durch Worte ersetzt. Marga erklärte der jungen Zwangsarbeiterin einzelne Wörter und schließlich zusammenhängende Sätze. Valentina lernte schnell, ihr Sprachschatz wurde üppiger, die Zeichnungen weniger, bis sie endlich im Schrank verschwanden.
Margas Bein heilte. Sobald sie halbwegs laufen konnte, ging sie zweimal die Woche mit einem geflochtenen Weidenkorb früh aus dem Haus und kehrte spätabends zurück. An den anderen Tagen erledigte sie ihren Haushalt selbst. Valentina schickte sie in die Werkstatt. Eigentlich hätten sie die Arbeitskraft nur für wenige Monate gebraucht, doch Valentina war den beiden ans Herz gewachsen, sie behandelten sie wie eine Tochter. Der Mann zeigte ihr, wie man Schuhe reparierte, der Frau war sie ein willkommener Gesprächspartner. Denn so wenig er sich mit seinen Schuhen unterhielt, so wenig redete Hans mit seiner Frau. Und wenn sie sich etwas zu sagen hatten, dann redete nur sie.
Manchmal brachten Leute ihre Schuhe und holten sie wieder ab. Valentina fiel auf, dass zunehmend Parteimitglieder in der Werkstatt verkehrten, normale Menschen kamen immer seltener, und wenn, dann bezahlten sie ihre Reparatur in Naturalien, mit Schmuck oder mit Kohlen und Holz. Und sie bemerkte, dass die Mahlzeiten, wenn Marga erst abends zurückkehrte, üppiger ausfielen. Dann gab es Eier, ab und zu Milch, gelegentlich sogar frisches Brot. Im Herbst lagen öfter Äpfel auf dem Tisch. Die anderen Tage glichen einander. Kartoffeln, hartes Brot, Suppe und wenig Fleisch.
Marga achtete auf gerechte Portionen. Jeder Schöpflöffel war gleich voll, jede Kartoffel in etwa gleich groß, sogar das Brot teilte sie akkurat auf.
Valentina beklagte sich nicht, sie wurde satt. Trotzdem hätte sie schon etwas mehr vertragen.
Die Fliegerangriffe wurden häufiger und intensiver. Halbe Nächte verbrachte das Ehepaar im Luftschutzkeller. Valentina ließen sie zurück in der Werkstatt. Zwangsarbeiter hatten keinen Zutritt zu den Schutzräumen. Die Einschläge rückten näher, das Elend wurde mit jedem Alarm größer.
Mehrmals täglich kontrollierte der Schuhmacher den Briefkasten am Gehsteig. Bei jedem Wetter, egal ob sich die Schuhe stapelten oder Kunden warteten. Eine innere Uhr trieb ihn den schmalen Weg vor zur Straße. Wenn er von der blechernen Röhre zurückkam, dauerte es eine Weile, bis seine Blicke wieder unbefangen in der Werkstatt umherwanderten, hin zu Valentina, um sie bei der Arbeit zu beobachten.
Bemerkte er einen falschen Stich, eine Sohle, die zu weit nach vorn stand, die unsauber abgeschliffen war, dann wies er sie zurecht, aber er schimpfte nicht. Vielmehr zeigte er Valentina Kniffe und Tricks, denn Schuhe reparieren war seine Passion, und es hatte den Anschein, als gäbe es für ihn nur Schuhe und Stille.
Der Herbst im Jahr 1943 ging vorüber. Es folgten Kälte, rationierte Kohlen und spärliche Lebensmittelzuteilungen. Der Propagandanachrichten überdrüssig geworden, begannen die Leute zu murren. Wohl wagte keiner, den Parolen der Oberen zu widersprechen, aber so manche Fahne an den Hausfassaden verschwand und man hörte hier und da wieder ein „Grüß Gott“.
Valentina hatte Heimweh. Sie vermisste ihre Eltern, ihre Geschwister. Sie vermisste ihre Heimat, das Grün hinter den Gärten und sie vermisste die von Hühnern, Gänsen und Enten gescharrten Löcher auf der Straße. Ihre Zeit verbrachte sie in einer dunklen, kühlen Werkstatt, in einem dunklen Hinterhof, eingerahmt von dunklen hohen Hauswänden. Der Ort, an dem sie sich befand, war so dunkel wie die Zeit, in der sie lebte.
Abends, wenn sie nach dem Essen zusammen mit Marga strickte oder kaputte Strümpfe stopfte, musste Valentina oft von ihrer Heimat erzählen, von diesem unbekannten Land im Osten, von wo im Winter der nadelspitze, bitterkalte Wind kam, der im Sommer jede Regenwolke vertrieb.
Marga wollte so vieles erfahren und Valentina wunderte sich darüber. Bis sie sich traute nachzuhaken: „Warum du immer fragen nach meinem Land?“
Marga lächelte zuerst, dann presste sie ihre schmalen Lippen zusammen und kämpfte mit den Tränen. „Weißt, Valentina, unser Rudolf ist dort drüben schon zwei Jahr. Bei Stalingrad. Ist das weit weg von dir?“
Valentina zuckte mit den Schultern. „Ich denke, ist weit weg. Ganz weit weg. Weißt, Russland großes Land.“
„Ein dreiviertel Jahr hat er nicht mehr gschriebn. Und mit jedem Tag, wo wir nichts hörn von ihm, wird mein Mann stiller und trauriger. Und der Hans hat doch früher so gern gredet …“ Für einen Moment glänzten Margas Augen, bis sie zu schluchzen begann. „Jeden Tag schaut er in den Briefkasten, nie ist was drin vom Rudolf. Und von Stalingrad hört man auch nichts Gscheits, oder?“
Ratlos blickte Valentina auf ihr Strickzeug und nahm den Faden wieder auf. Marga strickte ebenso. Eine Weile machten die Nadeln, die sich klimpernd durch die Maschen bohrten, das einzige Geräusch im Raum.
An einem der nächsten Abende fragte Valentina nach der grün-roten Eisenbahn: „Lokomotiv – Rudolf gehören?“
Marga nickte: „Die Lok war sein Lieblingsspielzeug. Einmal im Jahr, am Heiligen Abend, haben wir den Kessel mit Spiritus aufgefüllt und ihn dann angezündet. Was glaubst“, Margas Gesicht begann zu strahlen, „wie sich unser Rudolf gefreut hat, wenn der Dampf in kleinen Wölkchen aus dem Schlot kam. Und der Hans erst! Den ganzen Abend haben sie an ihr gebastelt, gedreht und probiert. Ach ja“, seufzte die weißhaarige Frau. „Das warn halt noch Zeiten. Weißt“, jetzt flüsterte sie fast, „die hat mein Hans ganz billig gekauft, als sie dem Jud im Spielzeugladen ein paar Straßen weiter kurz vor dem Krieg die Scheiben eingeschlagen haben. Für ein paar Pfennig habens damals dem sein Zeug verscherbelt und dann hast ihn und seine Familie nie mehr gesehen. Und jetzt steht die Lok auf dem Schrank und verstaubt.“
Alle vier Wochen musste sich Valentina im Arbeitsamt melden. Bisher hatte sie der Schuhmacher begleitet, im Dezember ging sie zum ersten Mal allein. In der Schlange vor dem Schalter sprach sie ein groß gewachsener, gut aussehender Landsmann mit dunklen Haaren, einem auffälligen Leberfleck auf der Wange und einer verbogenen Nickelbrille mit kleinen runden Gläsern an. „Kommst aus der Ukraine?“
„Woher weißt?“, Valentina starrte ihn erstaunt an.
„Dein Dokument.“ Der Mann deutete auf ihr Papier. „Ich heiß Julian, Julian Siwko aus Simferopol.“
Valentina zuckte mit der Schulter. Der junge Mann lächelte. Nur die obere Zahnreihe kam zum Vorschein, die untere verdeckten seine Lippen. Oben fehlte ein Schneidezahn, einige Zähne waren schwarz. „Kennst nicht? Krim kennst, oder?“
Valentina nickte. „Kommst vom Meer?“
„Nicht ganz“, meinte er, „aber war schon mal dort. Mit dem Fahrrad.“
Eine schrille Stimme ermahnte die beiden: „Nicht schlafen, weitergehen!“
Valentina bekam ihren Stempel. Dann verloren sie einander im Gewühl.
Marga blieb nun drei Tage in der Woche weg. Abends richteten sie die Kleidung und Marga zählte und ordnete mehrmals die Lebensmittelkarten, ohne dass es mehr wurden. Dabei redeten sie nur das Notwendigste. Immer seltener kamen Kunden, oft saß der Schuhmacher auf seinem Stuhl, eingewickelt in eine dicke Decke, und starrte durch das trübe Fensterchen, dabei faltete er die Hände, legte sie auf den Bauch und drehte stundenlang die Daumen im Kreis, bis er wieder aufstand, um den Briefkasten zu kontrollieren. Er bemerkte kaum die Sonne an diesen Vorweihnachtstagen 1943. Die hohen Hauswände ringsum ließen wenig Licht in seine kalte Werkstatt und ihn verlangte auch nicht danach.
Am Heiligen Abend nachts um halb drei heulten die Sirenen. Bis zum frühen Morgen saßen die beiden Alten wieder im Luftschutzkeller. Marga ging nicht mehr zurück in die Wohnung. Sie zog ihren dicken Wintermantel über. Mit einem alten Lederkoffer unterm Arm hastete sie die Straße entlang und verschwand rasch hinter den Häuserblöcken.
Stunden vorher, als im Hinterhof längst die Finsternis mit der Düsternis getauscht hatte, war Marga in die Werkstatt gestürmt. „Ihr dürft erst rauf, wenn ich euch ruf.“ Schon verschwand sie im Treppenhaus. Unter ihrem Mantel versteckte sie einen sperrigen Gegenstand. Geschickt entging sie den neugierigen Blicken Valentinas und des Schuhmachermeisters.
Die Glocken der Dreieinigkeitskirche läuteten zum achten Mal, da erschien Marga strahlend an der Tür. Ihre weißen Haare leuchteten im fahlen Licht der Glühbirne, die an einem losen Kabel an der Decke baumelte. Von der braunen Strickweste war nur der unterste Knopf zugeknöpft. Die weiße Bluse mit den feinen Spitzen an der Halskrause hatte Valentina noch nie an ihr gesehen. Mit weit geöffneten Augen stand die Frau des Schuhmachers auf der vorletzten Stufe. Valentina und ihr Mann waren gut beraten, ihr sofort zu folgen, denn die Erwartung und die Freude, die sie ausstrahlte, waren so zerbrechlich wie Glas.
Heimeliges Licht erhellte die Stube, als Marga die beiden in den Raum geleitete. Ein Fichtenbäumchen steckte in einem klobigen gusseisernen Ständer. Die mit Wäscheklammern an buschigen Zweigen befestigten Kerzen dufteten nach Wachs. Silbernes Lametta, sparsam auf die Äste verteilt, glänzte im zarten Schein. Drei Kugeln mit Schafen, Esel, Josef, Maria und dem Jesuskind in der Krippe bemalt, drehten sich langsam um die eigene Achse.
Marga begann zu singen, hoch, viel zu hoch: „Stille Nacht …“ Ihr Mann setzte langsam ein. Erst bewegte er nur die Lippen, dann brummte er mit krächzender Stimme wie der Sprecher aus dem Volksempfänger.
Valentina kannte die Melodie. Sie summte den Text in ihrer Sprache. Marga war ergriffen von dem Lied, und mochte ihr Mann auch den richtigen Ton verfehlen, es kam ihr vor wie Engelsgesang. Marga geleitete die beiden auf ihre Plätze, holte ein Tablett aus der Küche und deckte den Tisch. Valentina, die ihr helfen wollte, drückte sie sanft zurück auf den Stuhl. Marga strahlte, als sie den roten Presssack in dünne Scheiben schnitt und einen Kübel mit dampfendem Sauerkraut danebenstellte. Pfefferminztee aus einem verzierten Porzellankrug schenkte sie in gleichfarbige Tassen. Ihrem Mann reichte sie das Brot und ein langes Küchenmesser: „Da, Hans, das kannst besser als ich.“ Der Schuhmacher drückte den Laib auf den Bauch und hobelte einige Scheiben ab. Den letzten Rest, das Gnötzla, legte er auf seinen Teller. Schließlich vergaßen sie ihre Sorgen, sie redeten, sie freuten sich und aßen mehr, als sie vertrugen. Übrig blieben nur Schwarten.
Kurz nachdem der Schuhmacher ins Bett gegangen war, zog Marga ein kleines Päckchen aus der Tasche und streckte es Valentina entgegen: „Da, weil du so ein anständiges Mädel bist und weil ich dich so gern hab.“ Als sie das Zeitungspapier löste, hielt Valentina eine kleine Figur in der Hand. Ein Männchen, aus gedörrten Zwetschgen zusammengesetzt, mit Augen aus Streichholzspitzen und einer Haselnussnase steckte in einer aufgeplusterten Bundhose und einer wunderschönen Trachtenjacke.
„So einen lustigen Burschen wünsch ich dir“, meinte Marga. „Ist ein Zwetschgenmännla, was ganz Besonderes.“
Valentina war verblüfft. Damit hatte sie nicht gerechnet. „Hast selbst gemacht?“
Marga nickte. Ihre Bescheidenheit verbot ihr zu lächeln. „Hab ich doch gern gmacht, Valentina.“
Marga löschte fast alle Lichter, dann ging Valentina in ihre Kammer. Im Kerzenschein saß sie auf dem Stuhl und betrachtete die Figur. Der junge Mann vom Arbeitsamt kam ihr in den Sinn. Eine Nickelbrille würde dem Zwetschgenmännla gut stehen, dachte sie sich. Sie wollte es neben die Lokomotive stellen. Valentina erschrak. Der Platz war leer. Sie suchte im Schrank, unter dem Bett. Nichts. Valentinas Herz schlug bis zum Hals. Aufgeregt lief sie in die Küche.
Marga saß im Halbdunkel und grübelte. „Hab mir schon gedacht, dassd noch mal kommst. Findest die Eisenbahn nicht, gell?“
Valentina nickte.
„Setz dich“, meinte die Frau. „Weißt, es ist vielleicht gscheiter, wenns nicht mehr da ist. Ach, Valentina“, meinte sie voll Trauer. „Ich mag nicht mehr beten. Ich denk, der Herrgott will, dass unser Rudolf nicht mehr zurückkommt. Und dann denk ich mir … vielleicht kommt er nicht zurück, weil ich nimmer beten mag.“
Valentina wusste nichts darauf zu sagen.
Marga starrte vor sich hin. Schließlich legte sie ihre Hand auf Valentinas Arm. Die junge Frau zuckte. Margas Hand war kalt. Auch im Raum war es kalt, aber es war eine andere Kälte, eine strengere, die ihr entgegenströmte. Valentina zog ihren Arm zurück und rieb sich die Augen.
„Lokomotiv aber nicht kaputt?“
Die Schuhmacherin lächelte gequält. „Eigentlich schon. Wir haben sie vorhin aufgegessen.“
Valentina begriff nicht.
„Weißt, ich hab heut den ganzen Tag suchen müssen, bis ein Bauer sie brauchen konnt. Bei einigen probier ichs gar nimmer. Die geben nur was her, wenn du ihnen Schmuck oder so was gibst. Aber wer hat heut noch Schmuck? Unsere Kunden haben doch alle selber nichts mehr, und die paar Parteibonzen zahlen eh nichts. Da müssen wir froh sein, dass sie dich bei uns lassen. Ach, der verdammte Krieg. Morgen steh ich bestimmt wieder den halben Tag beim Metzger für ein paar dünne Scheiben Fleisch.“ Missmutig kramte sie einige Lebensmittelkarten aus der Schublade und versuchte, sie zu entziffern: „Zweihundert Gramm Fett pro Woche … Was willst mit zweihundert Gramm Fett. Das kannst dir an den Hintern schmieren. Wegen zweihundert Gramm Fett stehst den halben Tag in der Schlange und darfst dich noch dumm anreden lassen. Der vermaledeite Krieg.“
Valentina stand auf und ging an die Tür. Leise sprach sie, ihre Stimme versagte fast: „Danke euch, danke für alles.“ Dann ging sie schlafen.
Im Februar bäumte sich der Winter noch einmal auf. Die Kälte setzte den Menschen zu. Heizmaterial war nun kaum noch zu bekommen. Nur wenige hatten Gelegenheit, in den umliegenden Kiefernwäldern Reisig und dürre Äste aufzulesen für eine kurze, schnelle Wärme. Wie leer gefegt waren die kargen Böden im Reichswald. Die meisten froren in ihren Wohnungen, Kranke und Schwache erlagen dem Frost. Die Ausgebombten, die nirgends anders unterkamen, hausten in Ruinen und fast täglich kamen neue hinzu. Die Fliegerangriffe wurden stärker. Sogar bei Tageslicht heulten die Sirenen. Die Front bröckelte.