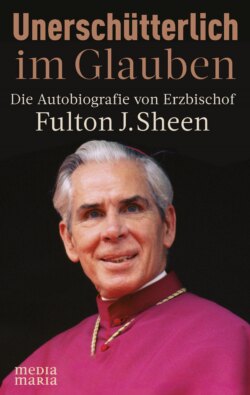Читать книгу Unerschütterlich im Glauben - Fulton J. Sheen - Страница 12
5. Lehrtätigkeit und Vorträge
ОглавлениеMehr als 25 Jahre lang war ich als Lehrender tätig. Diese Laufbahn begann nicht erst, als ich an die Theologische Fakultät der Katholischen Universität von Amerika berufen wurde, sondern bereits in England, als ich gebeten wurde, am Priesterseminar der Erzdiözese Westminster, dem St. Edmund’s College in Ware, Theologie zu lehren. Gleichzeitig arbeitete ich für meine Zulassung als außerordentlicher Professor an der Katholischen Universität Löwen. Ich sollte meine Lehrtätigkeit im Fach Dogmatik beginnen, obwohl mein Fachgebiet die Philosophie war. Obwohl ich viele Vorlesungen in Theologie an der Katholischen Universität Löwen und später am Angelicum und an der Gregoriana in Rom belegt hatte, war ich doch im wahrsten Sinne des Wortes ein Anfänger.
Einer meiner Freunde und ein hochgeschätzter Kollege von mir war der Priester Ronald Knox, der zum katholischen Glauben konvertiert und dessen Vater der anglikanische Erzbischof von Birmingham war. Er war ein Oxford-Absolvent und lehrte Heilige Schrift und Griechisch am Seminar. Später übersetzte er die gesamte Bibel aus dem Hebräischen und Griechischen ins Englische. Ein weiterer Kollege war Dr. Messenger, der mit mir in Löwen studiert hatte und in einem Frauenkloster ungefähr drei Kilometer vom Seminar entfernt lebte.
Jeden Tag verfasste Ronald Knox für seine Studenten ein lateinisches Gedicht, das die Ereignisse des Vortags thematisierte. Ein Zwischenfall, der ihm reiches Potenzial bot, war die Explosion der »Starlight«-Anlage im Seminar. Es handelte sich dabei um eine Art Leuchtgas, das in den geräumigen Toiletten gelagert wurde. Starlight-Gas pflegte in unsere Butter und unser Brot einzudringen, sodass wir es ständig zu uns nahmen. Von allen Nächten, an denen die Starlight-Anlage in einem englischen Priesterseminar in die Luft gehen sollte, wurde von den Starlight-Göttern die Nacht zum St.-Patrick’s-Tag gewählt. Wir hörten in der Nacht die Explosion. Als wir am St.-Patrick’s-Tag aus dem Fenster sahen, entdeckten wir, dass der Rasen des Seminars mit Toilettenschüsseln übersät war. Knox verfasste darüber ein brillantes Gedicht, doch der letzte Vers ärgerte Dr. Messenger besonders: Fragorem nuntius audivit (»Der Bote [im Englischen ›messenger‹] hörte die Explosion«).
Ich steckte viel Arbeit in die Vorbereitung der Vorlesungen, die ich für die Studenten im vierten Jahr hielt. An jenem Tag sollte die Vorlesung mit dem Titel »Theandrische Handlungen« stattfinden. Eine theandrische Handlung ist eine Handlung, in welcher sowohl die göttliche als auch die menschliche Natur unseres Herrn beteiligt ist. Ein Beispiel wäre, dass er Staub nahm, ihn mit Speichel vermischte, ihn auf die Augen des Blinden auftrug und diesen so heilte. Allerdings wird kein theologisches Thema dieser Art den Studenten so klar vermittelt, denn das Geschäft eines Professors besteht darin, die einfachen, gewöhnlichen Dinge des Lebens kompliziert darzustellen!
Ich verbrachte Stunden mit der Lektüre von Bonaventura, Thomas von Aquin, Suárez, Billot und anderen Theologen. Als ich den Seminarraum betrat, hätte ich eine theandrische Handlung nicht einmal dann erkannt, wenn sie sich vor meinen Augen abgespielt hätte, so verwirrend fand ich das Thema – trotzdem hielt ich eine Stunde lang eine Vorlesung. Beim Verlassen des Seminarraums hörte ich, wie ein Diakon zu einem anderen sagte: »Also Dr. Sheen ist ein ganz außerordentlicher Dozent, ganz außerordentlich.« Ich fragte ihn: »Was habe ich denn gesagt?« Und in tadellosem britischem Akzent gab er kurz zurück: »Ich weiß nicht recht.« Und ich antwortete: »Ich auch nicht.« An jenem Tag erfuhr ich, dass man manchmal, wenn man verwirrt ist, fälschlicherweise für gelehrt gehalten wird.
Fünf Jahre später traf ich einen ehemaligen Studenten des St. Edmund’s College, der jetzt als Priester in der Diözese Manchester tätig war. Er erkundigte sich danach, was ich jetzt mache. Als ich ihm sagte, dass ich jetzt an der Katholischen Universität von Amerika in Washington lehre, dachte er kurz nach und sagte: »Ich hoffe, dass Sie jetzt ein besserer Lehrer sind als damals.« Aber vielleicht kann zu meinen Gunsten gesagt werden, dass ich mein didaktisches Potenzial erst an den Engländern ausprobierte, bevor ich es bei meinen amerikanischen Landsleuten einsetzte.
Als ich die Bedingungen für den Grad des außerordentlichen Professors von Löwen erfüllt hatte, stattete ich Kardinal Mercier einen Besuch ab. »Eminenz, Sie waren immer ein brillanter Lehrer. Könnten Sie mir bitte einige Ratschläge zum Thema Lehrtätigkeit geben?« – »Zwei Ratschläge gebe ich Ihnen: Bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bleiben Sie informiert darüber, was die moderne Welt beschäftigt. Lesen Sie ihre Dichtung, ihre Geschichtsschreibung, ihre Literatur. Behalten Sie Architektur und Kunst im Auge. Hören Sie ihre Musik und erleben Sie ihre Aufführungen im Theater. Und dann versenken Sie sich tief in den heiligen Thomas und in die Weisheit der Alten – so werden Sie dazu in der Lage sein, ihre Irrtümer zu widerlegen. Der zweite Rat: Zerreißen Sie Ihre Aufzeichnungen am Ende jedes Jahres. Nichts zerstört das intellektuelle Wachstum eines Lehrenden so sehr wie das Aufbewahren seiner Notizen und die Wiederholung desselben Kurses im folgenden Jahr.«
Ich versuchte, den weisen Ratschlägen des Kardinals zu folgen. Zusätzlich zu dem Bemühen, auf dem Laufenden zu bleiben, was das zeitgenössische Denken betraf, nahm ich mir auch vor, nie dasselbe Seminar zweimal abzuhalten. Als ich an der Philosophischen Fakultät zu lehren begann, unterrichtete ich Natürliche Theologie. Dabei stellte ich fest, dass ich einige Aufzeichnungen wieder verwendete, die ich schon einmal benutzt hatte, und mich deshalb intellektuell nicht weiterentwickelte. Daraufhin beschloss ich, jedes Jahr einen anderen Kurs zu geben, der aber immer einen Bezug haben sollte zur Natürlichen Theologie und zur Existenz und Natur Gottes. Die Kurse variierten also im Laufe der Jahre. Es gab einen Kurs über Geschichtsphilosophie, im nächsten Jahr einen über die Philosophie des Marxismus, dann über Religionsphilosophie, Wissenschaftsphilosophie und so weiter. Und sie alle wurden gehalten im Licht des Denkens des heiligen Thomas von Aquin.
Um mich auf diese neuen Themen vorzubereiten – ich war noch nicht wirklich bewandert darin –, begab ich mich jedes Jahr im Sommer nach London und verbrachte die zweite Junihälfte, die Monate Juli und August sowie den ersten Teil des Septembers damit zu lesen und mich für den bevorstehenden Kurs im kommenden Jahr vorzubereiten. Morgens, abends und an den Wochenenden hatte ich jeweils meinen Einsatz als Hilfspfarrer in der St.-Patrick’s-Kirche am Soho Square. Zusätzlich zu dieser zurückgezogenen Vorbereitung im Britischen Museum wendete ich auch wenigstens sechs Stunden zusätzlich für die Vorbereitung jeder einzelnen Vorlesung auf. Es ist leicht möglich, dass sich ein Professor ohne konstante Anregungen und weiteres Studium in einen staubtrockenen Intellektuellen verwandelt.
Ein perfektes Beispiel für einen Philosophen, der stecken blieb, ist Immanuel Kant. Nie verließ er die Stadt Königsberg. Er erzählte jedes Jahr, und zwar immer am selben Tag, denselben Witz. Dieser lautete: »Warum gibt es im Himmel keine Frauen?« Kants Antwort war: »In der Heiligen Schrift steht, im Himmel sei eine Stille von einer halben Stunde gewesen.« Kant unternahm jeden Tag denselben Spaziergang mit einer Pünktlichkeit, dass die Hausfrauen von Königsberg ihre Uhren danach stellen konnten. An einem Tag fiel der Spaziergang aus, und zwar als eines von Rousseaus Werken erschien, das Kants Einstellung stark veränderte und dazu führte, dass er sich der praktischen Vernunft zuwandte. Aber das ist ein anderes Thema.
Um auf die frühen Jahre des Lehrens zurückzukommen: Nach dem Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 1928, in dem es viel Fanatismus gegen die katholische Kirche gab, beschlossen die Bischöfe, dass an der Katholischen Universität von Amerika ein Studienfach für Apologetik eingeführt werden sollte. Ich wurde vom Rektor, Bischof Corrigan, gebeten, einen Lehrplan für diese Kurse zu entwerfen. Ich legte den Plan in Form einer Pyramide an: Im unteren Teil befanden sich Themen wie Journalismus, Medien, Kommunikation, Religionspsychologie und weiter oben die mehr theologischen Themen, die sich auf die Verteidigung der Kirche bezogen. Der Rektor war zufrieden mit dem Plan und bat mich, hierfür Professoren zu suchen. Mir wurde die Erlaubnis gewährt, europäische Professoren auszuwählen. Ich fragte nach: »Habe ich die Befugnis, ihnen zu sagen, dass sie eingestellt sind?« – »Ja, wenn Sie Männer finden, die Sie für qualifiziert halten.« – »Wie hoch wird ihr Gehalt sein?« Und es wurde ein Betrag festgesetzt. Ich reiste nach Europa und fand rund zehn qualifizierte Professoren aus England, Frankreich und Deutschland – sie alle sprachen Englisch – als künftigen Lehrkörper für das neue Studienfach Apologetik.
Ich telegrafierte dem Rektor, berichtete ihm von den Professoren, die ich ausgesucht hatte, und bat ihn, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen und sie zu bitten, die Professuren anzunehmen. Bis August hatten sie noch nichts vom Rektor gehört und selbst im September noch nichts. Nun wurde ich mit Telegrammen von diesen Professoren überschwemmt: »Was ist aus dem Vorschlag geworden? Sollen wir an die Universität kommen?« Mir wurde bewusst, dass der Rektor nichts unternommen hatte, um sie einzustellen. Deshalb sandte ich ein Telegramm an alle Professoren und teilte ihnen mit, dass ich meine Kompetenzen überschritten hätte und sie deshalb um Verzeihung bitte.
Im Jahr darauf bestellte der Rektor mich wiederum ein und sagte: »Ich möchte, dass Sie die Leitung für das neue Studienfach Apologetik übernehmen.« Ich lehnte höflich ab – mir war klar, dass er den Zwischenfall des Vorjahres bereits vergessen hatte. Ein Studienfach mit einem Lehrstuhl für Apologetik kam nie zustande.
Viele Jahre lang war der Dekan der Philosophischen Fakultät Pater Ignatius Smith, ein Dominikaner, der nicht nur ein fantastischer Lehrer war, sondern auch ein berühmter Prediger. Mein Seminar fand immer nachmittags um vier Uhr statt. Bevor ich den Seminarraum betrat, der direkt neben dem von Dr. Smith lag, ging ich zu ihm und besuchte ihn für zehn Minuten. Er verließ mit mir den Raum und erzählte mir auf dem Weg zu meinem Seminarraum eine lustige Geschichte – sodass ich lachend dort ankam. Meine Verbindung mit Dr. Smith, die jahrelang währte, war eine der glücklichsten meines Lebens.
Einmal wurde ich von einer Fachschaft eingeladen, Teil der Prüfungskommission zu sein und die Seminaristen zum Abschluss des S. T. B. (Sacrae Theologiae Baccalaureus) zu prüfen. Da ich mich auf die Schnelle nicht an die Daten der frühen Konzile und anderer Details dieser Art erinnern konnte, musste ich anders vorgehen. Den ersten Studenten, der hereinkam, fragte ich: »Würden Sie zugestehen, dass als Folge der Ursünde eine Störung im Universum eintrat: Die Tiere wurden wild, Disteln wuchsen, und der Mensch musste sein Brot im Schweiße seines Angesichts verdienen?« – »Ja«, war seine Antwort. »Wenn Sie also einräumen, dass es zu einer allgemeinen Störung der Natur als Folge der Erbsünde kam – warum ist Gott dann Mensch geworden? Warum haben wir keinen Pantheismus anstelle einer Menschwerdung Gottes? Warum hat Gott sich nicht in die gesamte Natur eingelassen, die sich gegen ihn aufgelehnt hatte?« Die anderen Professoren protestierten, weil die Frage unfair sei, und man bat mich, den Prüfungsausschuss zu verlassen. Meine Verteidigung lautete: »Ich wollte lediglich herausfinden, ob der Student denken kann.« Die Antwort, die ich von ihm erhofft hatte, war: Da die niedere Natur durch den Menschen gefallen war, war es angemessen, dass die gesamte niedere Natur auch durch den Menschen mit Gott versöhnt werden sollte. Deshalb kam es zur Menschwerdung Gottes und nicht zum Pantheismus.
Zu lehren begeisterte mich. Ich liebte es, weil es so viel mit der Weitergabe des göttlichen Wortes zu tun hatte. Häufig kam mir an der Universität der Gedanke: »Warum haben wir Dozenten einen Kündigungsschutz, Fußballtrainer jedoch nicht?« In den Hörsälen und Seminarräumen kann es Mittelmäßigkeit geben. Ein Fußballtrainer, der keine Mannschaft zusammenstellen und trainieren kann, die gewinnt, kann gehen. Alte Generäle werden allmählich vergessen – schlechte Lehrer und Dozenten werden jedoch einfach weitergereicht. Lehren besteht häufig darin, dass ein Inhalt aus den Aufzeichnungen des Lehrers in die Aufzeichnungen des Studenten hinüberwechselt, ohne dass er mit dem Verstand von auch nur einem der beiden in Berührung gekommen wäre.
Ich fühlte mich den Studenten gegenüber zutiefst moralisch verpflichtet. Deshalb verbrachte ich so viel Zeit mit der Vorbereitung jeder Vorlesung. In einem Zeitalter sozialer Gerechtigkeit gerät ein Umstand leicht aus dem Blick: die moralische Pflicht der Professoren, ihren Studenten für die Studiengebühr, die sie bezahlen, einen angemessenen Gegenwert zu liefern. Das bezieht sich nicht nur auf die Lehrmethode, sondern auch auf den Inhalt. Ein Lehrer, der selbst nichts mehr lernt, ist kein Lehrer. Lehren ist eine der erhabensten Berufungen auf Erden, denn letztlich besteht der Sinn und Zweck aller Bildung in der Erkenntnis der Wahrheit und der Liebe zu ihr.
Einige Praktiken, die nach meiner Beobachtung für den Lehrbetrieb wichtig sind, lauten wie folgt: Meine erste Regel war: Nie hinsetzen. Im Sitzen entfacht man kein Feuer. Wenn die Studenten für das einstehen sollten, was ich ihnen vermittelte, dann sollte ich auch für sie stehen bleiben.
Ich habe Tausende Vorlesungen und Vorträge gehalten, aber kaum einmal habe ich einen schriftlich niedergeschrieben – weder für Studenten noch für ein größeres Publikum. Weder im Hörsaal noch im Seminarraum oder von der Kanzel las ich von Notizen ab, wobei ich immer daran denken muss, was eine alte irische Frau über einen Bischof gesagt hatte, der seine Rede ablas: »Um Himmels willen, wenn er selbst sich nicht daran erinnern kann, wie kann er das von uns erwarten?«
Würde man eine Umfrage unter Zuhörern anstellen, die Rednern zuhören, die ihre Rede ablesen, dann würde wohl entdeckt, dass die meisten an etwas anderes denken. G. K. Chesterton bemerkte nach einem Besuch in Amerika: »Meine letzte amerikanische Reise bestand darin, Menschen, die mir nie irgendetwas angetan hatten, nicht weniger als neunzig Vorträge aufzudrängen.« Auch ich stellte fest: Selbst wenn ich Vorträge ohne Skript hielt, begannen Frauen – sobald ich sagte »Abschließend lässt sich festhalten« – ihre Schuhe anzuziehen. Jedenfalls war die Vortragstätigkeit eine gute Vorbereitung für Rundfunk und Fernsehen.
Wenn ich Vorlesungen oder Vorträge vorbereitete, recherchierte ich zuerst zum betreffenden Thema. Dann ordnete ich das Recherchierte, indem ich, wenn möglich, mich auf einige klare Punkte konzentrierte. Der nächste Schritt bestand darin, mir dieses Material so sehr anzueignen, dass ich es den Studenten oder dem Publikum leicht vermitteln konnte. Das geschah durch einen Lernprozess, der wie folgt beschrieben werden könnte: Ich lernte den Vortrag von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Ich eignete mir den Vortrag nicht dadurch an, dass ich meine Notizen über die Recherche durchlas. Ich schrieb aus der Erinnerung das nieder, was ich davon im Gedächtnis behalten hatte. Dann glich ich dies mit den Notizen meiner Recherche ab, um festzustellen, wie gut ich mir die Punkte angeeignet hatte. Das Papier, auf welchem ich vorab die Vorlesung oder den Vortrag zusammengefasst hatte, wurde zerrissen. Ein neuer Entwurf nach dem anderen wurde aufgesetzt und vernichtet. Ich wiederholte diesen Prozess immer wieder, um nicht zuzulassen, dass auch nur das winzigste Stückchen Papier meinen lebendigen Geist an die Kandare nahm.
So wie eine Mutter nicht das Kind ihres Schoßes vergessen kann, so kann auch ein Sprecher das Kind seines Geistes nicht vergessen. Warum sollte ein lebendiger Geist sich Forschungsoder Recherchenotizen unterwerfen? Was ist – abgesehen nur von ihrer Genauigkeit – so heilig an Aufzeichnungen? Der Geist kann ja diese Genauigkeit in sich aufnehmen. Wie häufig ich mir diese Punkte aufschrieb oder sogar mir selbst vortrug, hing von der Schwierigkeit des Themas oder von meinem Gedächtnis ab. Schließlich gelangte ich dann zu dem Punkt, an dem mir das Material wirklich zu eigen war. Es war wie verdaute Nahrung, nicht Nahrung aus dem Supermarktregal. Deshalb habe ich für einen Vortrag, eine Vorlesung oder eine Predigt nie Notizen benutzt.
Es war weniger wahrscheinlich, dass ich eine Sache vergaß, wenn ich diese Methode anwandte. Allerdings erinnere ich mich, dass ich einmal die Bühne für eine Fernsehaufzeichnung betrat und meine Ansprache komplett vergessen hatte. Ich machte ein paar spaßige Bemerkungen über das Vergessen und versuchte währenddessen, mich an das Thema meines Vortrags zu erinnern. Schließlich war es dann wieder da.
Ein tragischer Gedächtnisaussetzer ereignete sich beim Eucharistischen Kongress in Dublin. Wenn es je einen Augenblick in meinem Leben gab, an dem ich alles richtig machen wollte, dann beim Eucharistischen Kongress: weil er in Dublin stattfand, weil es ein Eucharistischer Kongress war und weil meine Großeltern mütterlicherseits nicht aus Bessarabien kamen. Wie üblich sprach ich ohne Aufzeichnungen, und ich war von meinem Thema so erfüllt, dass ich Gedanken benutzte, die in meinem Geist aufblitzten. Ein solcher Blitz, der mir in jenem Augenblick spontan brillant vorkam, war: »Irland hat nie einen anderen König anerkannt als Christus und keine andere Königin als Maria.« Das Publikum brach in nicht enden wollenden Applaus aus. In diesem Augenblick hatte ich eigentlich die Absicht gehabt, ein Gedicht von Joseph Mary Plunkett vorzutragen, ein Gedicht, das ich so gut kannte wie das »Gegrüßet seist du, Maria«:
Ich sah sein Blut auf der Rose,
und in den Sternen den Glanz seiner Augen.
Während ich das Gedicht vortrug, dachte ich nicht an die Worte. Ich gab mir vielmehr selbst innerlich ein paar Ohrfeigen. Ich sagte immer wieder zu mir: Egal wie brillant du eine Bemerkung findest, vermeide alles, was einen politischen Anstrich hat. Das hier ist ein Eucharistischer Kongress! Ich ohrfeigte mich innerlich so kräftig, dass mir, als ich beim neunten Vers des Gedichts anlangte, dieser nicht mehr einfiel. Ich sagte zum Publikum: »Tut mir leid, ich habe das Gedicht vergessen.« Tausende und Abertausende irischer Kinnladen klappten vor Enttäuschung herunter, und wenn eine irische Kinnlade herunterklappt, kracht es. Dann schoss mir eine Zeile von Patrick Henry durch den Kopf. Nicht jene, welche die meisten kennen. Patrick Henry sagte im Laufe seines Lebens auch: »Wenn Sie bei einer Rede Schwierigkeiten haben, dann stürzen Sie sich in die Mitte eines Satzes und vertrauen auf den allmächtigen Gott, dass er Sie zum anderen Satzende bringt.«
Ich fing also einen Satz an: »Ich bin froh, dass ich es vergessen habe. Wenn ich je gewünscht hätte, etwas zu vergessen …« Ich wusste nicht, was ich jetzt sagen sollte, deshalb begann ich noch einmal von vorne: »Wenn ich je darum gebetet hätte, irgendetwas zu vergessen, dann hätte ich darum gebetet, diese Zeilen von Joseph Mary Plunkett zu vergessen. Ich glaube, diese Vergesslichkeit ist von schöner Symbolik, denn wenn man auf dem Amboss von Irlands Erde steht, dann sollte man fähig sein, die Funken seiner eigenen Dichtung zu hämmern und zu schmieden und nicht einmal von einer so edlen Seele wie Joseph Mary Plunkett abhängig sein.« Als ich die Rede beendet hatte, scharten sich einige Bischöfe um mich und sagten: »Das war ein sehr guter Redetrick, als Sie die Vergesslichkeit vorgegeben haben.« Es war kein Trick. Ich hatte den Vers wirklich vergessen.
Die Erfahrung hat mich gelehrt: Wenn es in einem Hörsaal oder einem Vortragssaal unruhig wird, dann tut der Redner gut daran, auf gar keinen Fall seine Stimme zu erheben, um besser gehört zu werden. Der beste Trick besteht darin, die Stimme zu senken und fast flüsternd zu sprechen. Die Reaktion des Publikums wird dann sein: »Oh, ich verpasse etwas«, und sie widmen ihm wieder ihre Aufmerksamkeit, die kurzzeitig nachgelassen hatte.
Bei Vorträgen – und hier beziehe ich mich auf Reden außerhalb der Seminarräume – in großen Hörsälen, Kongresszentren und in großen Hallen – habe ich die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, sich nie sofort auf das Thema zu stürzen. Die Zuhörer mögen es, wenn sie zunächst einen Blick auf Sie werfen können. Ein wenig Humor am Anfang ist eine gute Einleitung, und am besten wirkt es, wenn der Sprecher sich über sich selbst lustig macht.
Ich habe außerdem die Erfahrung gemacht, dass Menschen es nicht mögen, wenn sie sich dem Vortragenden gegenüber unterlegen fühlen. Eine Geschichte, in welcher der Redner sich kleinmacht, verleiht ihnen ein Gefühl der Gleichheit. So wie ich einen Vortrag mit einer humorvollen Bemerkung beginne, so werden ein- oder zweimal im Laufe des Vortrages humorvolle Ergänzungen eingestreut, um die Stimmung zu heben, die Anspannung zu lösen und dem Publikum Gelegenheit zur Erholung zu geben. Es geht hier nicht um eine humorvolle Geschichte als Selbstzweck, sondern sie sollte sich im Zusammenhang mit dem Vortrag ergeben. Ich erinnere mich an ein Beispiel, als ich über ein bestimmtes Buch sprach, das mit dem zur Diskussion stehenden Thema zusammenhing. Zwei junge Frauen unterhielten sich über Verabredungen mit jungen Männern. Die eine junge Frau sagte, dass sie nie von einem jungen Mann eingeladen würde, während die andere an jedem Abend eine Verabredung treffen konnte. Die zweite erklärte: »Das Problem bei dir ist, dass du nichts liest. Die Männer sind sehr intelligent. Sie sprechen gern über Philosophie, Literatur, Geschichte und Naturwissenschaften. Fang an, Bücher zu lesen! Wenn du mit ihnen ins Gespräch kommst, hast du Stoff zur Verfügung, für den du sie interessieren kannst.« Nach wochenlangem Studium hatte die junge Frau dann endlich eine Verabredung, und als sie sich mit einem jungen Mann zu Tisch setzte, sagte sie: »War das nicht furchtbar, was mit Marie-Antoinette geschehen ist?«
Oft ist die Länge der Zeit, die man mit Reden zugebracht hat, eine Zielscheibe des Humors. Folgender Zwischenfall hat sich wirklich zugetragen. Bei einer Atlantiküberquerung – vor den Tagen, in denen es Flugzeuge gab – kam ein Steward zu mir und fragte: »Sind Sie der Priester, der letztes Jahr am Missionssonntag in der St.-Patrick’s-Kathedrale gepredigt hat?« – »Ja.« – »Ich habe jede Minute dieser eineinhalb Stunden genossen.« – »Guter Mann, ich habe sicher noch nie in meinem Leben eineinhalb Stunden gepredigt.« – Darauf antwortete er: »Mir kam es aber so lang vor.«
Nach meiner Ansicht muss das Ende einer Ansprache stark, inspirierend und erhebend sein – und ich verwende dafür fast so viel Zeit wie auf viele andere Punkte im Vortrag. Bei Schauspielern gibt es den Spruch: »Es ist leicht, die Bühne zu betreten, aber es ist schwer, sie wieder zu verlassen.« Wahrscheinlich sind die besten Redner jene, über die das Publikum am Ende sagt: »Ich wünschte, er hätte länger gesprochen.«
Ein Gebiet, das während meiner späteren Jahre viel Zeit in Anspruch nahm, waren Vorträge an Universitäten. Ich wurde mehrere Hundert Mal von weltlichen Universitäten eingeladen, sehr viel häufiger als von katholischen Universitäten. Dabei habe ich festgestellt, dass einige religiöse Menschen oft lieber weltlich wären, aber andererseits auch weltliche Menschen lieber religiös sein wollten. Bei meinen Universitätsvorträgen wurde mir bewusst, dass die Anwesenden umso begeisterter reagierten, je religiöser das Thema war. In Los Angeles traf ich an der Universität von Kalifornien mit dreißig bis vierzig Studenten zum Abendessen zusammen. Während der ersten halben Stunde äußerten sie sich abfällig und beleidigend.
Als Straßenprediger in Alabama, 1930er-Jahre (Fulton J. Sheen Archiv).
Ich beachtete ihre Beleidigungen überhaupt nicht, sondern überging ihre Bemerkungen mit einer kleinen, leichthin gesagten Überlegung. Nach einer halben Stunde hatten sie sich dann beruhigt und verhielten sich völlig normal. Ganz offensichtlich mussten sie einfach eine bestimmte Rolle spielen – eine Rolle, von der sie annahmen, sie sei für diese Phase des Studentenlebens angemessen.
Bei der Jugend in diesem Land gibt es eine beträchtliche Opferbereitschaft. Sicher nicht das geringste Problem besteht darin, dass die Älteren die Jungen nicht herausfordern. Die jungen Menschen rebellieren gegen die bürgerliche Moral ihrer Eltern, die an den amerikanischen Lebensstil glaubten, bei dem unter Wohlstand materieller Erfolg verstanden wurde. Allerdings hatten ihre Eltern sich nie gefragt, wie sie sich in ihrem Leben verhalten sollten, nachdem sich ihre Lebensbedingungen verbessert hatten. In gewissem Maße war Religion ein Bestandteil dieser bürgerlichen Moral. Sie vermittelte keine echten religiösen Erkenntnisse über den Sinn des Lebens, sondern vielmehr psychologische und soziologische Ansichten, um die Religion dem bequemen bürgerlichen Leben anzupassen.
An einer der von mir besuchten staatlichen Universitäten gab es ein Problem. Der Rektor der Universität holte mich am Flughafen ab und erzählte mir, dass die Studenten am Tag zuvor zwei Gebäude niedergebrannt hätten. Er sagte: »Ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie den Vortrag nicht halten müssen, denn ich befürchte, dass es zu einem unangenehmen Zwischenfall kommen könnte. Ich habe zwar Mitglieder des Kuratoriums gebeten, bei Ihnen auf der Bühne zu sitzen, aber sie können Sie nicht schützen.«
Ich sagte ihm, dass ich den Vortrag halten werde. Das Thema, für das ich mich ursprünglich entschieden hatte, habe ich vergessen. Da es jedoch Unruhen an der Universität gab, beschloss ich, über ein anderes Thema zu sprechen. Rund zehntausend Studenten erschienen, und ich sprach ungefähr eine Stunde lang über Keuschheit und Sittsamkeit, und zwar in einer Weise, dass die Studenten es verstehen konnten. Am Ende des Vortrags standen sie auf, klatschten und jubelten und kamen auf die Bühne, um mit mir zu sprechen.
Der Rektor der Universität sagte hinterher zu mir: »Ich bin seit zwanzig Jahren hier, aber so etwas habe ich noch nie erlebt.« – »Was ist so anders?«, fragte ich ihn. »Nun ja«, erwiderte er, »andere Redner kommen und ergreifen Partei – Schwarz gegen Weiß, Gelb gegen Grün, Blau gegen Rosa – oder sie erzählen den Studenten, dass ihre Eltern und die Universitätsleitung falschliegen.« Er sagte: »Sie hingegen haben sie herausgefordert, und zwar mit etwas, das sie noch nie zuvor gehört haben. Und sie suchen doch nach einer Herausforderung!«
Wie ich bereits sagte – je religiöser das Thema der Rede ist und je stärker sie sich auf die Kreuzigung unseres Herrn bezieht, je mehr sie unseren modernen Heiden das unbekannte Element des Sich-selbst-Opferns nahebringt, desto empfänglicher sind sie. Es mangelt dem Herrn nie an potenziell Bekehrbaren in allen Altersstufen. Das Problem ist eher die Aktivierung dieses Potenzials, und das hängt weitgehend von uns ab. Wie lange der gute Gott mir noch erlauben wird, auf diese Weise zu wirken, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich versuchen werde einzutreten, solange er die Türen öffnet, und ich werde jene Türen wählen, die mir ein Maximum an spirituellen Möglichkeiten bieten. Ich bitte ihn täglich, mir meine körperliche Stärke und geistige Wendigkeit zu erhalten, um sein Evangelium predigen und sein Kreuz und seine Auferstehung verkündigen zu können. Ich bin so froh, dass ich dies tun kann, dass ich manchmal Folgendes glaube: Wenn ich zu unserem guten Gott in den Himmel kommen werde, dann werde ich ein paar Tage ausruhen und ihn dann bitten, dass ich wieder auf die Erde zurückkehren und noch ein bisschen weiterarbeiten darf.