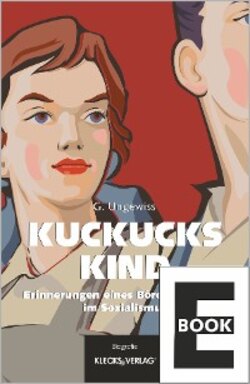Читать книгу Ein Kuckuckskind - G. Ungewiss - Страница 5
MOTIV
ОглавлениеDieses Buch entstand aus einer Einsamkeit heraus. Allein, zu Hause, vergessen von sogenannten Freunden. Gefangen im tiefen Loch einer Depression, in dem der Abstand zu den Mitmenschen immer größer zu werden schien. Kein Antrieb. Der Wunsch auf zwischenmenschliche Kontakte war verloren gegangen. Zu anstrengend. Das Gefühl der Ablehnung hielt sich beharrlich. Der Tag war schwer zu ertragen. Ich wollte nicht aufstehen. Nicht rausgehen und mir womöglich noch sagen lassen, dass der Tag schön sei. Ich sah das nicht. Ich sah ES nicht. Das Schöne. Alles war grau, trotz Sonnenschein.
Die Worte dröhnen wie Gebrüll in meinen Ohren. Nein! Ich will niemanden hören, niemanden sehen. Es ist zu anstrengend. Mir fehlt die Kraft. Es ist schwer, sich ständig erklären zu müssen. Missverstanden zu werden. ›Draußen‹, im Abseits zu sein.
Niemand hört mehr zu. Immer nur höre ich: »Die schon wieder, mit ihrem Selbstmitleid!«
Selbst-mit-leid? Was soll das überhaupt sein? Ja, ich leide, aber was ich nicht will, ist Mitleid. Und >Selbst< schon gar nicht. Mir selbst gegenüber bin ich nicht so rücksichtsvoll und verständnisvoll. Mir fehlt der Wegweiser aus der Dunkelheit. Das schmerzt, als würde man den Daumen in die offene Wunde legen. Niemand muss mit mir mitleiden.
Verständnis wäre gut. Aber woher soll das kommen, wenn ich niemandem sage, was mich bewegt? Und selbst wenn ich wüsste, was mich bewegt, wer würde das hören wollen? Wem will und vor allem wem kann ich mich denn anvertrauen … ohne, dass es gleich die Runde macht und ›alle‹ mit dem Finger auf mich zeigen ... Und warum sollte ich jemanden mit meinen Gedanken, Sorgen und Gefühlen belasten. Hat irgendwer es verdient, dass ich ihn oder sie auch noch runterziehe? Nein. Ich will nicht zur Last, zur Belastung werden. Also, schweige ich und lächele. Aber meine Seele weint. Ich brauche jemanden, dem es gelingt, die grauen Wolken, die mich erdrücken, beiseite zu schieben, damit ich die Sonne wieder sehen kann.
Und warum dürfen Menschen das überhaupt – Andersdenkende und anders Fühlende verurteilen? Woher nimmt ein Fremder das Recht, über sein Gegenüber zu richten? Ist er auch nur ein kleines Stück des Weges mit mir gegangen, um mitreden zu können? Dieses Verurteilen anderer macht mich so wütend. Hat nicht jeder Dreck vor der Tür? Auch ich – obwohl, das meiste ist nicht einmal mein Dreck. Der wird halt nur zu meinem gemacht. Oder bin ich es selbst, die den Schmutz anderer zu meinem eigenen macht?
Was ist los mit mir? Warum so viele Fragen? Warum die Zweifel? Macht sich nicht jeder Mensch solche Gedanken? Nehme ich mir nicht selbst zu viel Recht auf Gerechtigkeit heraus? Bin ich es, die ungerecht ist? Sind es die anderen? Mit welchem Recht dürfen sie urteilen – nein, verurteilen? Oder verurteile ich zu Unrecht? Die Welt ist aus den Fugen geraten. So scheint es, wenn die Gefühle nicht mehr mit den Gedanken Schritt halten können. Es macht mir Angst. Ich bekomme Bauch- und Kopfweh. Mir wird schwindelig.
Warum wird der Abstand zu meinen Nachbarn und Bekannten gehalten und ist die Liebe zu den Tieren größer als zum Menschen?
Wo sind sie nur, die Mit-Menschen? Warum sitze ich jetzt hier Ohne-Menschen? Komisch, das Wort Ohne-Menschen kennt das Rechtschreibprogramm des Computers nicht. Warum eigentlich nicht? Es sind doch so viele ohne Menschen. Allein. Einsam. Die sich lieber für ein Haustier entscheiden, als dass sie sich noch jemand anderem anvertrauen ...
Nun gut. »Jeder ist seines Glückes Schmied!« Wer war das, der solch einen ›klugen‹ Spruch abgelassen hat? Ich weiß es nicht. Habe auch so meine Zweifel an dieser Aussage. Für mich klingt es eher wie ein Vorwurf. ALSO: Selbst schuld ... Da ist sie wieder, diese Schuld! Aber wer ist schuld? Warum? An was?
Quälende Fragen und Selbstzweifel bereiten meinen Weg … machen mich kaputt.
Ich will euch sagen, warum. Dazu muss ich euch eine Geschichte erzählen ...
... eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, das auf dem Land aufgewachsen ist.
Meine Mutter kam aus dem Norden, aus einem Dörfchen in der Nähe von Schwerin. Wir würden sagen, wo sich Fuchs und Hase »Gute Nacht« sagen. Ihr Name war Henny. Sie war schön und unschuldig. Eine liebenswerte Frau. Schlank, braunes Haar, voller Lebenslust.
Im Ort gab es nur Sandwege, einen kleinen Laden mit Waren für den täglichen Bedarf, ansonsten nichts, nicht mal einen Arzt. Dafür gab es eine Badeanstalt in der Nähe. Ein Tummelplatz für die Familien im Sommer. Viele andere Gelegenheiten zum Zeitvertreib außer Arbeiten gab es nicht. Der Weg dorthin, entlang der Wiesen, Baumreihen und einer Eisenbahnstrecke, wo noch die Dampflok regelmäßig entlang zog, war romantisch und schön. Knallerbsenbüsche, riesige Laubbäume, die Schatten und Trost spendeten und weite Wiesenlandschaften bis an die Wälder heran. Man konnte sich hier auch einfach ins Gras legen und in den Himmel schauen, die Vögel beobachten oder auf Rehe warten. Mit den Gräsern spielten wir ›Hühnchen oder Hähnchen‹. Die kleinen Dinge brachten Abwechslung und Freude. Ich war sehr gern dort in den Ferien. Weg von dieser Familie ... Aber dazu später.
Henny lernte, wie viele Mädchen in den Vierzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts Hauswirtschafterin in Kühlungsborn. War dort während der Ausbildung bei Verwandten untergebracht, denn Geld für ein Zimmer hatte sie nicht. An manchen Wochenenden fuhr sie nach Hause zu ihrer Mutter und legte stets den Weg über Schwerin zurück. Die Verkehrsanbindung gab nichts anderes her. Sie fuhr mit der Bahn: zuerst mit der ›Molli‹, der mecklenburgischen Bäderbahn, einer dampfbetriebene Schmalspurbahn mit einer Höchstgeschwindigkeit von vierzig Kilometern pro Stunde, dann musste sie zweimal umsteigen auf den großen Zug. Der Rest wurde auf Schusters Rappen zurückgelegt. Bis sie zu Hause war, gingen schon mal weitere drei bis vier Stunden ins Land. Deshalb fuhr sie nicht mehr so häufig nach Hause. Es war umständlich, langwierig und teuer.
Sie stand schon bald auf eigenen Beinen. Wurde immer selbstständiger und verdiente ihr eigenes Geld als ›Mädchen für alles‹. Mit sechszehn Jahren fühlte sie sich schon erwachsen. Zu dieser Zeit musste man bereits alleine zurechtkommen. Es gab keine Möglichkeit, bei jedem Problemchen Mama anzurufen und um Hilfe zu bitten. Telefon hatte nur der Bürgermeister und der Pfarrer. Zu der Zeit wurden statt WhatsApp noch Briefe geschrieben, die mitunter eine Woche unterwegs waren, bis sie den Adressaten erreichten. So blieb sie also vor Ort oder fuhr maximal bis in die Kreisstadt Schwerin. Sie schlug sich durch. Es war 1946.
Oft machte die junge Frau, wenn sie frei hatte, bereits in Schwerin halt, weil dort ihre Cousine lebte. Sie war älter als Henny. Kannte sich gut aus in dieser Stadt. Hier pulsierte das Leben nach dem Krieg. Die Armee unterhielt in der Nähe ein Schützen-Bataillon. Bereits 1822 begann hier schon die militärische Nutzung der Region. Ein Artillerieschießplatz wurde im Schutz des ringsherum liegenden Waldes eingerichtet. Es entstand der Militärstützpunkt Stern Buchholz. Die Wehrmacht begann mit dem Bau eines Versorgungsdepots und einer Heeresmunitionsanstalt. Später galt es nur noch, dieses Lager zu bewachen und zu verwalten. Der Krieg war seit Mai 1945 zu Ende – in manchen Regionen etwas später. Häuser und Landschaften waren genauso kaputt wie die Ideale der Menschen, Gefühle lagen in Trümmern, Männer waren knapp.
Aber in Schwerin, da waren die Soldaten, Offiziere – Männer! Die Sehnsüchte wuchsen in der schweren Zeit der Zerstörung. Sehnsucht nach Streicheleinheiten, Zuwendung, Nähe, Schutz und Geborgenheit. Henny lernte in der Stadt einen großen und stolzen Offizier kennen, verliebte sich in ihn und heiratete. Mit achtzehn war sie bereits Ehefrau. Sie war versorgt. Das war es zu dieser Zeit, worauf es im Leben eines Mädchens ankam. Verheiratet sein … ›unter der Haube‹ sein. Der Mann hatte das Geld nach Hause zu bringen, und die treusorgende Ehefrau kümmerte sich um den Haushalt. Sie ›durfte‹ kochen, waschen, putzen und den Gatten, als Dank für das Haushaltsgeld, das Bett warm halten. Bald stellte Henny fest, dass das Leben mit ihrem Offizier doch nicht die Erfüllung brachte. Dieser Mann war dienstlich so stark eingebunden, dass er kaum zu Hause war. Sie spielte nur eine untergeordnete Rolle in seinem Leben. Die Nähe und der Schutz, die Geborgenheit fehlten. Bald schon spielte sie gar keine Rolle mehr für ihn. Henny war allein, einsamer als je zuvor.
In Schwerin Stern-Buchholz war auch Wilhelm stationiert. Als Soldat war er kein Kostverächter, genoss das Leben in vollen Zügen. Der Alltag war schon schwer genug, deshalb zog er mit seinen Kameraden an den freien Tagen um die Häuser, durch Kneipen und Bars, und tat, was man halt bei dem spärlichen Sold tun konnte, um den Kopf frei zu kriegen und nicht mehr dem gedanklichen Elend hinterherzuhängen. Fern von der Heimat. Nicht wissend, wie es zu Hause aussah.
Es sprach sich natürlich schnell herum, wo man die übriggebliebenen Männer finden konnte. So ging auch Henny mit ihrer Cousine spazieren, um gesehen zu werden, sie gingen zum Tanzen in die Stadt oder fuhren mit einem kleinen Fährboot über den Pfaffenteich. Dort traf man sich. Hier tummelten sich die jungen Leute und verwickelten sich gegenseitig in Gespräche, während man den Schwänen verträumt hinterher schaute. Manchmal fuhren Wilhelm und Henny, nachdem sie sich kennengelernt hatte, ganze drei Mal über den Pfaffenteich, weil sie so ins Gespräch vertieft waren. Der Teich war nicht sonderlich groß, man könnte auch um ihn herum spazieren, aber das war nichts für Wilhelm mit seinen schweren Armeestiefeln. Er ließ sich lieber chauffieren. Auch wenn es nur vom Fährmann war. Das gab ihnen ein klein wenig das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Es war ein erhebendes Gefühl. Und man konnte seine Angebetete besser im Arm halten. Schließlich waren auch die Männer auf der Suche nach Abwechslung und Liebkosungen. Wenn auch nicht gerade mit noblen Absichten.
Da war er nun: Wilhelm. Er war frech, aufdringlich und doch liebenswert. Er war voller Kraft, Humor und Beschützerinstinkt. Das imponierte ihr. Da Henny Wochen bis Monate allein war, suchte sie das Abenteuer. Frust, Trotz und Neugierde wuchsen in ihr, sie wollte sich auflehnen gegen die Ketten, die ihr durch die Ehe auferlegt waren. Spaß und Freude waren die größte Sehnsucht nach den angsterregenden Erfahrungen, die ihnen die Kriegs- und Nachkriegszeit bescherten. Es kribbelte wieder im Bauch.
Sie war verheiratet, mit ihrem Offizier. Das war schon etwas. Die sogenannten geordneten Verhältnisse konnte sie vorweisen, aber das genügte ihr nicht mehr. Was sollte sie mit einem Mann, der nur auf dem Papier zu ihr gehörte? Mit den Alltagsproblemen blieb sie allein. Wo war die anfängliche Wärme geblieben? Sie war einsam. Diese Ehe bestand nicht mehr, nicht für sie. Wenn sie doch wenigstens ein Kind von ihm gehabt hätte! Ein Wesen, für das sie hätte sorgen, welches sie hätte liebkosen können. Aber auch das wollte einfach nicht klappen. Es passte eben nicht. Sie entfremdeten sich zusehends. Gespräche, gemeinsame Interessen und oder gar Aktivitäten fanden mit ihrem Offizier nicht mehr statt. Keine Ausflüge, Kutschfahrten durch die Natur mit einem Picknick im Wald, wie man es inzwischen in den Kinos sehen konnte. Sie träumte von romantischen Abenden beim Tanz unter dem Sternenhimmel in den Armen eines starken Mannes, der ihr zuhört. Wo war dieser Mann? Ihr Angetrauter nahm sie gar nicht wahr.
Und da war er nun. Wilhelm. Sie fand nach einer enttäuschten Ehe mit einem Offizier ihre neue Liebe zu Wilhelm, dem Soldaten. Trotz oder wegen der Nachkriegswirren. Henny war verliebt. Heimlich trafen sie sich in der Stadt. Ihre Cousine war pikiert. So etwas schickte sich nicht. »Du bist verheiratet!«, sagte sie immer wieder. »Nein! Nur auf dem Papier!«, trotzte Henny. Sie wollte diese Ehe nicht mehr. Was für eine Schande, aber das war ihr egal. Sie brauchte Streicheleinheiten. Aufmerksamkeit. Respekt. Liebe. Bald monierte ihre Cousine nicht mehr, weil sie ebenfalls ihre große Liebe fand und inzwischen Henny besser verstehen konnte. Damit hatte die junge Frau freie Bahn.
Und er war ihr Wilhelm!
Nach dem Abzug der alliierten Truppen sprengte die Sowjetarmee das Munitionslager in Schwerin. Die deutschen Soldaten wurden nach Hause geschickt. Es gab nichts mehr zu bewachen. In Friedenszeiten warteten andere Aufgaben auf die Jugend. Der alte Schmutz und Ballast musste aufgeräumt werden. Man hatte keine Verwendung mehr für sie in Sternbuchholz. Wilhelm fuhr in seine Heimat, zurück in die Börde. Tränen flossen beim Abschiednehmen, aber er versprach ihr, sie nachzuholen ...