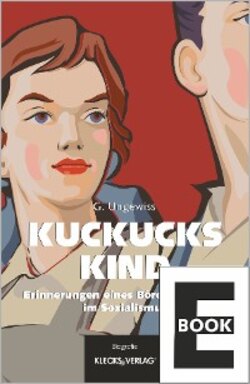Читать книгу Ein Kuckuckskind - G. Ungewiss - Страница 6
HENNY IN DER BÖRDE
ОглавлениеSie war hübsch, schlank, mit braunem schulterlangen Haar. Ja, die Männer drehten sich nach ihr um. Doch sie dachte nur an den einen. Ein halbes Jahr später fuhr sie ihm nach. Sie hatte gewartet, aber er kam nicht, sie zu holen. So nahm sie ein kleines Köfferchen und setzte sich in den Zug. Zuvor schrieb sie ihrem Geliebten. Sie meinte es ernst und fuhr in ihre Zukunft. Die Aufregung war groß. Willi holte sie vom Bahnhof ab und brachte sie in sein Heim. Der Weg führte durch das halbe Dorf. Beide wurden gesehen.
Wen hat Willi denn da mitgebracht? Eine schmucke Dern. Woher kommt sie? Was ist mit unseren Bräuten im Ort, die jahrelang auf die Rückkehrer gewartet haben? Die Hoffnung der Jungfrauen oder besser, der jungen Frauen war groß, als er ledig und gesund zurückkehrte. Und nun das! War alles vergebens? Das Warten umsonst? So ein gutaussehender Mann … schade!
Wieder flossen Tränen.
Vielleicht war sie schwanger, fragte man sich im Ort. Und dann hatte man die Gewissheit. Er musste sie also mitbringen. Und wann wird nun geheiratet? Nach der Scheidung. Na ja, irgendwas ist ja immer. Verheiratet ist sie also auch noch! So eine Verschwendung. Und die ledigen Frauen hier mussten sich mit dem ›vorhandenen Material‹ an Männern zufriedengeben.
Eine verheiratete, schwangere Frau aus Mecklenburg-Vorpommern!
Wie ungerecht doch die Welt ist!
Bei den Frauen aus dem Ort war sie schon mal unten durch, trotzdem wurde sie mit einer überraschenden Freundlichkeit empfangen, sodass sie sich ziemlich schnell heimisch fühlte.
Aber ...
Sie hatte keinen leichten Einstieg bei der Mutter des Geliebten und blieb immer die Unerwünschte. Aber was soll’s? Eine starke Liebe kann doch nichts erschüttern, dachte sie. Sie ward geschieden von ihrem Offizier, gebar im Dezember ihren Sohn Rudolf und heiratete im folgenden Jahr, am 16. Februar 1952, mit 22 Jahren den Soldaten Wilhelm.
Sie war lebenslustig und verliebt. Ihre Wünsche gingen in Erfüllung. Nun hatte sie einen Mann, der für sie da war, und ein Baby. Wilhelm wusste, wie man Frauen verwöhnt. Er war ein Charmeur vor dem Herren. Das Leben kann so schön sein. Im Dorf lebte sie sich durch ihre aufgeschlossene Art schnell ein. Die Männer flirteten mit ihr. Die Frauen fragten sie aus und beäugten sie neidisch. Es war ein ruhiges und friedliches Leben. Einfach schön. Drei Jahre später brachte sie eine Tochter zur Welt. Sie nannte sie Karla. Jetzt schien sie das Glück auf ihrer Seite zu haben. Es war eine Freude. Die Familie war komplett.
Der Kindesvater arbeitete in der LPG. Die Landwirtschaft, das war die einzig mögliche Arbeit in der Börde, die für den inzwischen 29-Jährigen infrage kam. Der Armee hatte er den Rücken gekehrt. Die Soldaten wurden sowieso nicht mehr gebraucht. Somit war er zu Hause in Klein Siehstenicht – bei seiner schönen Frau und seinem Sohn. Und wie stolz war er erst, als er auch noch eine Tochter bekam. »Wir müssen zusammenrücken«, sagte er. Aber liebende Menschen haben auch in der kleinsten Hütte Platz.
Schließlich waren da auch noch seine Eltern. Die freuten sich sicher auch, wenn sie die Kinder umsorgen durften. Kinder bringen Liebe und Wärme ins Heim. So ein kleiner Mensch scheint wie ein großes Wunder. Man musste sie einfach liebhaben.
Bald bekamen sie einen kleinen, verkommenen Wohnraum, den sie sich gemütlich herrichten konnten. Henny hatte schließlich gelernt, wie es geht. Mit einfachen Mitteln dekorierte sie für die Familie ein gemütliches Zuhause. Die Wände wurden getüncht, Stoffe als Tischdecken ausgelegt und Feldblumen für den Tischschmuck gepflückt. Dann noch ein altes Foto an die Wand – und nach und nach entwickelte Henny ihren eigenen Stil. Und für die Sorgen gab es Likör. Ein Allheilmittel gegen Langeweile, Betrübtheit, Ärger und Bauchweh. Das hatte man ihr in diesem Ort beigebracht: »Es ist bekannt von Alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör.« Also musste dieser auch im Hause sein.
Willi übernahm schließlich die Verantwortung eines ehrenamtlichen Dorfpolizisten. Die wurden gesucht von staatlicher Seite. Die Ausbildung in Theorie und Praxis übernahm die provisorische Regierung. Das war eine ungeübte Verwaltung, angeleitet von russischen Soldaten mit willigen Bauern, die etwas ›Besseres‹ werden wollten oder sollten. Sie versuchten, die neuen Gesetze und Verordnungen, die von ›Oben‹ kamen, umzusetzen. So schulte diese Regierung die Bauern zu Hilfspolizisten. Alle waren dabei, weil es offensichtlich alle gestandenen Männer machen mussten. So auch Wilhelm. Schließlich galt es, »die Grenze zu schützen«, wie es hieß. Soldaten durften dort nicht agieren, da die Gefahr bestand, dass zwei Streitmächte aufeinandertreffen und somit Grundlagen für einen neuen Krieg gelegt würden. Das wollte niemand. Also wurde in Berlin die kasernierte Volkspolizei an den Grenzstreifen gestellt und auf dem Land die Volkspolizei mit Unterstützung der Hilfspolizisten – auch um zu verhindern, dass weitere Anwohner flüchteten und auch noch wertvolle Kulturgüter mitgehen ließen. Sie lebten nahe der niedersächsischen Grenze, in der Ostzone, die immer mehr gesichert wurde. Hier galt es besonders, die wenigen noch verbliebenen Wirtschaftsgüter zu sichern. Oft waren es Fachkräfte, die das Weite suchten, sagte man. Warum eigentlich gerade die gebildeten Leute? Was wissen die, was wir nicht wissen, fragten sich die anderen. Warum treibt es sie fort? Wir sind doch die ›Guten‹. Wir wollten den Neuanfang in einer neuen, besseren Gemeinschaft. Eine Gesellschaft errichten, in der es allen Menschen gleichermaßen gut geht.
Die Grenzen nach Westdeutschland waren provisorisch geschlossen. Die politischen Abgrenzungen wurden immer drastischer und nahmen zu. Das Land sollte geschützt und gesichert werden, aber vor wem? Ein neues Feindbild wurde von staatlicher Seite aufgebaut und vermittelt. In der Freizeit betrieben viele Propaganda. Später auch ganz offiziell während der Arbeitszeit. Die Stallarbeit blieb liegen. Die politische und gesellschaftliche Verantwortung wurde im sogenannten Ehrenamt verwirklicht.
Henny und ihre Familie befanden sich in der Ostzone, eine der vier Besatzungszonen, die es nach dem zweiten Weltkrieg gab. Das Gebiet war von den Russen besetzt und die Verwaltung wurde von der sowjetischen Staatsmacht diktiert. In Russland gab es schon den Sozialismus. Hier sollte dieser ebenfalls praktiziert werden – nach dem Vorbild der großen Sowjetunion. Sie nannten sich ›Freunde‹. Jahre später wurden sie ›Brüder‹ genannt, weil man zwar das gleiche Ziel verfolgte, man sich schließlich aber die Freunde aussuchen konnte, aber Brüder nicht. Viele hätten lieber andere Wege eingeschlagen, hatten aber keine Wahl. Sie hatten sich zu beugen. Schließlich waren es die Deutschen, die über die Menschheit großes Unglück, Leid, Elend, Armut und Krankheiten gebracht hatten. Somit hatten sie demütig das letzte Hemd herzugeben und zu tun, was die Siegermächte verlangten. Es bestand eine Diktatur. Nach Karl Marx war es die »Diktatur des Proletariats«. Nach der zunehmenden Auffassung der hier lebenden Bürger war es aber eine Diktatur der Russen über die Ostdeutschen. Über den restlichen Teil Deutschlands befanden die Engländer, Franzosen und Amerikaner. Nur die Deutschen hatten nichts mehr zu sagen.
Im Osten sollte der Sozialismus aufgebaut werden. Eine Staatsform, in der es allen gut gehen sollte. Es war schwer, aus Schutt und Asche Optimismus aufzubauen. Sie sollten etwas Neues, Wunderbares schaffen. Eine Gesellschaft, in der alle gleich sind. Ohne Standesdünkel. Ohne Vorurteile. Jetzt sollten die, die die Arbeit leisteten und die Früchte anbauten, diese auch ernten und verzehren. Ja, da machen alle gern mit, oder? Deshalb entschied auch Wilhelm, eine politische Schulung über sich ergehen zu lassen. Er gehörte dazu und verstand die aktuelle Entwicklung besser. »Was ist denn dabei, alles gemeinsam anzupacken, aufzubauen und zu nutzen?«, sagte er. »Das kann nur richtig sein.«
Im Westen hielt man an dem Konkurrenzkampf fest. Der Kapitalismus blieb erhalten. Der Aufbau ging dort durch die amerikanische Unterstützung viel schneller voran. Der Wohlstand wuchs dort im Vergleich zum Osten drastisch. Trotz Ausbeutung der Arbeiterklasse. Und hier? Hier baute man wohl auf Bescheidenheit und Dankbarkeit.
Hier hieß es: sozialistischer Wettbewerb. Es mangelte an Rohstoffen und materiellen Wirtschaftsgütern. Das, was funktionierte, wurde von den Russen abgebaut und in das gelobte Land geschickt. Man sollte im Osten der Republik aus Scheiße Geld machen. Das Rezept dafür war noch unbekannt. Deshalb wuchs auch der Drang, in den goldenen Westen abzuhauen, um dort ein üppigeres Leben führen zu können. Nach der Zeit des Darbens war jetzt leben angesagt. Dies gelang im Westen besser. Viele junge Menschen wollten sich der Diktatur im Osten nicht fügen. Selbstbestimmt wollten sie ihr Land aufbauen und sich nicht sofort wieder unter einer anderen Knute wissen. Deshalb träumten viele von einem Leben in der Bundesrepublik Deutschland. Die gründete sich nach dem Ausruf des Grundgesetzes der BRD im Mai und ein paar Monate später, im September 1949, mit der Wahl des Bundetages. Vier Monate danach zog die sowjetische Regierung nach und gründete die DDR. Ab dem 7. Oktober 1949 begann man in Deutschland zweisprachig zu sprechen: Westdeutsch und sozialistisches Deutsch. Der Traum von der Wiedervereinigung war ausgeträumt und der Bau der bereits auf dem Papier gezogenen Grenze begann – erst mit Zäunen, Mauern, Gräben, dann mit Stacheldraht, Minenfeldern und auch Selbstschussanlagen.
Um die Flucht einzugrenzen und letztlich auch zu beenden, brauchte man Helfer der Volkspolizei, die mit einschreiten sollten, wenn Republikflüchtige unterwegs waren. Die Grenzen wurden allmählich sicher geschlossen. Neben dem herkömmlichen Stacheldraht wurden bewaffnete Posten aufgestellt, sogar mit abgerichteten Wachhunden und zum Teil eben auch mit mörderischen Selbstschussanlagen, die gegen die eigene Bevölkerung gerichtet waren. Aber Genaues wussten die Grenzschützer nicht. Alles das war geheime Verschlusssache.
Die ausgebildeten ehrenamtlichen Polizisten nannte man hinter vorgehaltener Hand die »Hilfsscheriffs«. Wilhelm war einer von ihnen. Das machte nicht nur die Männer, sondern auch deren Frauen stolz. Sie wurden zu einer Gemeinschaft. Zusammenarbeit wurde großgeschrieben. »Gemeinsam sind wir stark!«, lautete die Parole. Gegenseitige Hilfe wurde selbstverständlich. Keiner blieb mit seinen Sorgen allein. Allerdings wachsen in so einer Gemeinschaft auch das Misstrauen und die Zweifel. Leider! Man erfuhr aber erst Jahre später, dass Menschen bei einer geheimen Mission die eigenen Freunde und Nachbarn ausspionierten und an die Staatssicherheit verrieten, um sich selbst ein paar Mark dazuzuverdienen und einen Posten zu sichern.
Dafür erhielten sie Geld? Um ihre Mitmenschen zu verraten? Sogar vor Provokationen schreckten diese Mitmenschen nicht zurück. Sie provozierten ein brisantes Thema am Kneipentisch, und am nächsten Tag war der ehrliche Nachbar nicht mehr zu erreichen. Allein eine unbestimmte Aussage wie: »Ich haue ab!«, brachte die Stasi später auf den Plan.
Es war nicht zu verstehen, nur verwunderlich, wieso die Stasi immer so gut informiert war, trotz der spärlich vorhandenen Technik. Heute wissen wir es. Nicht die Menschen mit einer anderen Meinung waren Verbrecher, sondern die Spitzel der Stasi. Das war Verrat an der Menschlichkeit. Auch in unserer Familie gab es so einen Verräter. Ein junger Mann, dem ich vertraute. Ein Mensch, der durch seinen Fleiß und seine Weltoffenheit meinen Respekt und meine Bewunderung hatte. Davon ist heute nichts mehr übrig.