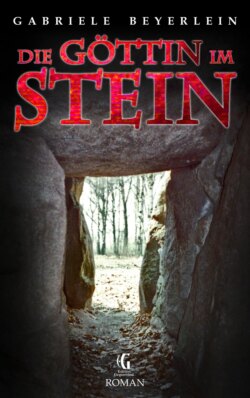Читать книгу Die Göttin im Stein - Gabriele Beyerlein - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 3
ОглавлениеNaki kniete am Brunnen und zog den Wassereimer hoch. Schwer war er, der große Eimer aus Eichenholz, randvoll mit Wasser gefüllt und noch mit einem Stein beschwert, damit er unterging.
Nakis Arme waren müde. Ein dumpfer Schmerz hatte sich in ihren Schultern und ihrem Rücken eingenistet. Seit Tagen zog sie Wasser aus dem Brunnen. Wenn es doch endlich regnete!
Mit dem Seil in der Hand erhob sie sich, trat einen halben Schritt vom Brunnen weg und lehnte sich weit zurück. Das Lindenbastseil scheuerte an der hölzernen Brunnenumrandung. Sie beachtete es nicht. Gleichmäßig setzte sie die Hände um, rechte, linke, rechte, linke. Endlich wuchtete Naki den Bottich über den niedrigen Brunnenrand und füllte einen der bereitstehenden Ledereimer. Sie ließ das Schöpfgefäß in den Brunnen zurückgleiten und wartete auf das klatschende Geräusch des Aufschlagens.
Sie zog erneut, stöhnte leise, als sie das Gewicht des vollen Eimers spürte, und bog sich rückwärts. Da plötzlich riss das Seil. Schlagartig von der Last befreit, verlor Naki das Gleichgewicht und fiel nach hinten. »Nein!«, schrie sie laut. Schlaff lag das Ende des Seils in ihrer Hand.
Sie raffte sich auf, sprang hoch, starrte in den dunklen Brunnenschacht hinunter. Der Eimer war versunken. Das Seil trieb auf der Wasseroberfläche. Der kleine Rablu, ihr jüngster Bruder, war herbeigelaufen und gaffte in den Brunnen. »Warum machst du das?«
»Na zum Spaß, was sonst!« Sie rieb sich das Gesäß.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte eine Stimme hinter ihr. Sie drehte sich um, Wirrkon, der älteste ihrer Brüder, war von der Baustelle herübergekommen.
»Mit mir schon. Aber nicht mit dem Eimer! Er ist im Brunnen versunken. Das Seil ist gerissen.«
»Ich hab‘s gesehen!« Er lachte. »Wenn du ein neues Seil besorgst, hol‘ ich dir den Eimer wieder hoch.«
»Danke!« Sie nickte und wandte sich zum Gehen.
»Lass dir ruhig Zeit!«, rief er ihr nach. »Ich bin froh über eine Pause!«
Das verstand sie nur zu gut. Wirrkon spaltete schon den ganzen Morgen gemeinsam mit Oheim Aktoll Baumstämme zu Brettern für die Verschalung des neuen Brunnens. Oheim Aktoll war der geschickteste Zimmermann im Dorf. Es musste schwer sein, im Gleichklang mit ihm Keile mit dem Beil ins Holz zu treiben.
Über die Schulter lächelte sie Wirrkon zu und ging am Haus von Oheim Ritgos Frau Songo vorbei auf das Haus ihrer Mutter zu. Aufatmend trat sie in den Schatten des Vorplatzes unter dem hohen, mit Rinde gedeckten Dach. Neben dem Mahlstein stand ein Körbchen mit Walderdbeeren. Rasch schob sie sich eine Handvoll in den Mund. Sehr klein waren sie wegen der großen Trockenheit – aber darum umso süßer.
Sie stieß die schwere Holztür auf, musste sich dagegen lehnen, damit sie sich ganz öffnete. Naki trat ein, wartete, bis ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, und sah sich suchend um. Ihr Blick glitt kurz über das breite, mit einer Wolldecke zugedeckte Lager in der Ecke, über die Bänke an der Längsseite des Raumes, den Webstuhl, den Wollkorb, das Geschirr auf den Wandborden, die mit Steinen umgrenzte Feuerstelle und verharrte dann bei den vielen kleinen Gerätschaften, die an Holzpflöcken ringsum an den lehmverputzten, in roter Farbe mit den Zeichen der Göttin bemalten Flechtwänden hingen: den Steinbeilen und Flintmessern, Holzlöffeln und Käsesieben und vor allem den Lederriemen, mit denen die Ochsen ins Joch gespannt wurden. Ein langes Seil war nicht darunter.
Seufzend kletterte sie den Steigbaum zum Zwischenboden hinauf und sah sich um. Tongefäße und Körbe voll Getreide und anderen Vorräten, büschelweise Flachs, ein Haufen ungesponnener Wolle, ein zerbrochener hölzerner Pflughaken und vieles mehr. Könnte sie die Mutter fragen, wo hier ein Seil lagern mochte! Die Mutter –
Heute war diese schon den dritten Tag im Grab. Ein kurzes Schaudern ließ Naki zusammenfahren. Sie stieg vom Boden herunter, durchsuchte erfolglos den zweiten Raum des Hauses und betrat schließlich den dritten und letzten, die Töpferwerkstatt von Tante Gwinne. »Du bist ja hier!«, sagte sie überrascht, als sie die Tante bemerkte. Vorhin noch hatte sie diese im Gemüsegarten angetroffen.
»Bei diesem Wetter trocknet der Ton so schnell aus«, erwiderte die Tante. »Er hat schon die richtige lederartige Festigkeit. Ich muss eben die Muster in die Becher ritzen, sonst ist es zu spät. Sei so gut, gib mir die beiden Stichel dort!«
»Wie du das machst«, meinte Naki bewundernd und beobachtete, wie die Tante ein Muster aus den heiligen Zeichen in den ebenmäßig geformten Becher grub. »Ich könnte das nicht.«
Die Tante lächelte. »Die Göttin gibt jedem andere Gaben. Mir hat sie eben Hände gegeben, die den Ton zum Leben erwecken, damit jedes Gefäß, das meine Werkstatt verlässt, ein Sinnbild Ihres geweihten Leibes ist.« Sie hielt den Becher in die Höhe. »Siehst du die einladende Öffnung und das ausladende Rund – die weibliche Höhlung, Ursprung und Geheimnis des Lebens? Wann immer wir aus diesem Becher trinken, feiern wir damit Ihre Fruchtbarkeit. Und unsere eigene Weiblichkeit. Denn wir Frauen sind die Ebenbilder der Göttin.«
Naki nickte. Ihre Augen wanderten über die fertigen Gefäße auf den Wandborden. Weite Schalen, zierlich-dickbauchige Fläschchen, elegante Tassen, hohe Becher und rundliche Näpfe aus dunkel glänzendem, glattpoliertem Ton, deren weiß und rot leuchtende Muster nur von einem erzählten: der Heiligkeit der vielgestaltigen Göttin.
»Dir wird auch noch klarwerden, welche besonderen Gaben Sie dir gegeben hat«, meinte die Tante.
Naki zögerte. Sollte sie Tante Gwinne davon erzählen? Da war diese Scheu, mit jemand anderem als Zirrkan darüber zu sprechen …
Die alte Tante stöhnte. Schweißperlen standen auf ihrer Stirn, blauschwarze Schatten dunkelten um ihre tiefliegenden Augen. Die fahle Haut spannte über den vorstehenden Wangenknochen.
Seit Tagen hatte Tante Kjolje vor Schmerzen nicht mehr schlafen können, trotz der bitteren Tees aus betäubenden Pflanzen, die die Mutter ihr einflößte. »Nicht mehr lange, Tante Kjolje«, sagte die Mutter, Tränen erstickten ihre Stimme, »nicht mehr lang musst du dich so quälen. Bald wird Zirrkan hier sein, ich habe nach ihm geschickt. Er wird deine Schmerzen lindern.«
Sie selbst, das Kind, trat von einem Fuß auf den anderen. »Ich geh‘ ihm entgegen«, sagte sie und lief aus dem Haus, die Dorfstraße hinab, in den Wald.
Zirrkan, der Heiler. Erst dreimal hatte sie ihn im Dorf gesehen. Trotzdem musste sie immer wieder an ihn denken. An seine Flöte. Seine Lieder. Seine Geschichten. Seine Trauer. Und sein stilles Lächeln, das sich auf die Menschen übertrug, mit denen er sprach, und auf die Dinge, die er berührte.
Alles war anders, wenn er da war. Vor allem die Mutter. In Zirrkans Gegenwart leuchtete die Mutter.
Und wie er den Muga geheilt hatte, als diesen beim Grabbau ein unsichtbarer Zauberpfeil getroffen hatte, so dass der Muga sich kaum mehr bewegen konnte! Zirrkan würde der armen Tante helfen. Er musste. Vor Ungeduld rannte sie. Und dann sah sie ihn um die Wegbiegung kommen. Sie stürmte ihm entgegen.
Er hielt nicht die Arme auf, wie die Oheime und der Muga es taten, fing sie nicht auf, hob sie nicht in die Luft. Er lächelte nur und nickte ihr zu: »Na, du!«
Dennoch war da wieder diese Vertrautheit zwischen ihnen. Als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt, dass sie nebeneinanderher gingen, miteinander schwiegen. Er, der berühmte Heiler, und sie, das Kind. Sie begleitete ihn ins Haus der Mutter, ans Lager der alten Tante.
Zirrkan begrüßte die Mutter. Einen Augenblick schien es, als seien die beiden allein im Raum. Dann wandte er sich der Tante zu, beugte sich über sie und sprach leise mit ihr. Die Mutter reichte Zirrkan eine Schale mit Mehl. Zirrkan nahm etwas Mehl auf die flache Hand und blies es in die vier Winde. Dann malte er mit Mehl die Zeichen, mit denen die Göttin in der Gestalt der Großen Bärin verehrt wurde, auf den Boden und rief sie mit dem Lied seiner Trommel herbei.
Sie selbst beobachtete genau, was er tat, sah, wie sein Körper unwillkürlich zu zucken und sich zu schütteln begann, als die heilige Kraft in ihn fuhr. Und spürte, wie etwas im Raum sich veränderte.
Auf einmal war sie anwesend, zum Greifen deutlich: die Große Bärin. Zirrkan legte die Trommel beiseite und ließ sich am Kopfende des Bettes nieder. Eine Weile saß er ganz still da, mit geschlossenen Augen, die Hände vor den Lippen zusammengelegt. Dann nahm er behutsam den Kopf der Tante in seine Hände.
Die Gesichtszüge der alten Tante verwandelten sich, verloren das krampfhaft Verzerrte, wurden weich und gelöst. Das wimmernde Stöhnen verstummte. Ruhig strömte der Atem der Kranken. Und sie, das Kind, stand da und dachte: Das will ich auch einmal tun. So heilen wie Zirrkan.
»Was ist«, fragte Tante Gwinne, »solltest du nicht eigentlich am Brunnen oder im Gemüsegarten sein?«
»O ja!« Naki schreckte auf. Wirrkon wartete auf sie! »Ich habe nur ein langes Seil gesucht.«
»Nebenan an der Wand über dem Bett. Die Mäntel hängen darüber!«
»Danke!«
Wenig später war Naki mit dem Seil bei Wirrkon. Er knotete es an der hölzernen Brunnenumrandung fest und schwang sich über den Rand.
»Pass bloß auf!«, meinte sie, plötzlich besorgt, als sie beobachtete, wie er an dem Seil in den tiefen Schacht einstieg, die Füße gegen die eine Seite gestemmt, den Rücken gegen die andere.
Stück für Stück glitt er in die Tiefe. Mit angehaltenem Atem sah sie zu, wie er, über der Wasserfläche angelangt, nach dem Seil griff und wieder nach oben kletterte. »Schön kühl da unten!«, meinte er, als er endlich wieder an die Oberfläche kam und ihr das Ende des zerrissenen Seiles reichte.
»Danke, Wirrkon!«
»Keine Ursache!«
Sie sah ihm nach, wie er zur Baustelle zurückging. Einen Bruder zu haben wie Wirrkon. Mit ihm an der Seite ließen sich einmal alle Schwierigkeiten meistern und die Geschicke einer Sippe lenken, so wie es jetzt die Mutter und Oheim Ritgo taten.
Schön wäre das. Und doch war da das Gefühl, dass es nicht so kommen würde. Dass ihre Bestimmung etwas anderes war.
Naki zog den Eimer hoch, knotete das neue Seil an seinen Henkel und machte sich wieder ans Wasserschöpfen. Ihre Gedanken aber waren bei Zirrkan. Sie stellte den gefüllten Eimer auf den Brunnenrand und setzte sich daneben.
Seit jenem Tag in ihrer Kindheit, als sie Zirrkan zum ersten Mal heilen gesehen hatte, war sie an seiner Seite geblieben, wann immer er ins Dorf gekommen war und nach der Anrufung der Großen Bärin Kranken die Hände aufgelegt oder sie mit Nadelstichen, Kräutersud und ätherischen Dämpfen oder mit Operationen behandelt hatte – oder mit Hilfe seiner Trommel ihre Seelen im Niemandsland zwischen Leben und Tod gesucht und in ihren Körper zurückgeleitet hatte.
Er hatte ihre Anwesenheit dabei geduldet, ohne etwas dazu zu sagen. Er hatte sie sogar zusehen lassen, als er Oheim Li geheilt hatte. Nach einer Kopfverletzung hatten sich Dämonen in Oheim Lis Kopf eingenistet und ihm qualvolle Kopfschmerzen bereitet. Da hatte Zirrkan mit seinem Steinmesser ein rundes Loch in dessen Schädelknochen geschabt und die Dämonen zum Entweichen gebracht. Und Naki hatte die Heilpflanzen zu einem Brei stampfen dürfen, mit dem er die Wunde wieder verschlossen hatte.
Nach und nach hatte er sie immer mehr Handreichungen machen lassen und ihr die Wirkung mancher Kräuter erklärt. Aber nur ein einziges Mal, bei seinem letzten Besuch im Dorf, hatte er davon gesprochen, was hinter dem stand, was er tat. Von dem, was man nicht sehen konnte.
Von dem Klang hatte er gesprochen, der in jedem Menschen schwinge und den es zu spüren gelte, wenn man die Hände auflege. Mit den Fingerspitzen – aber auch mit der Seele. Und dass man diesen Klang finden und aufnehmen und mit dem großen Lied der Lebenserhalterin verquicken müsse.
Und dann hatte er es sie fühlen lassen.
Zirrkan legte seine Hände an ihre Schläfen. Da lag sie in weichem Moos, sank tiefer und tiefer hinein, sah Bäume über sich, sah in die wogenden Wipfel, löste sich aus dem Moos, wurde hinaufgetragen, schwebte höher –
Als er schließlich die Hände wieder von ihr löste, blieb sie liegen wie im Traum. Dann erhob sie sich und sagte: »Ich würde so gerne heilen wie du. Was muss ich tun, damit die Göttin mich dazu auserwählt?«
Er schwieg lang. Dann sagte er: »Du kannst nichts dazu beitragen, Naki. Sie tut es oder sie tut es nicht. Ich muss zugeben, dass ich es bei dir sehr gut für möglich halte, deshalb lasse ich dich ja schon an so vielem teilnehmen. Aber ob ich es dir wünschen soll, das weiß ich nicht.«
»Ist es so schwer?«, fragte sie, und ein Schauer kroch ihr den Rücken hinab.
»Am Anfang ist es das. Jedem, den die Göttin erwählen will, fügt sie Schmerzen zu. Sie schickt einen durchs Feuer, bis man geläutert ist. Und der Einweihungsweg – er ist hart.«
»Würdest du mich dabei begleiten? Würdest du mich alles lehren?«
»Wenn das deine Berufung ist – gewiss.«
»Dann fürchte ich mich nicht davor!«
Er lächelte.
Doch woher sollte sie wissen, ob die Göttin sie berufen hatte?
»Naki, wo bleibst du so lang, meine Mutter wartet auf dich!«
Naki zuckte zusammen, blickte auf. Uori war an den Brunnen gekommen. Naki füllte den zweiten Ledereimer, ging in die Knie, nahm das Joch auf die Schultern, an dem die beiden Eimer hingen, richtete sich langsam auf und balancierte vorsichtig die Wassereimer zum Gemüsegarten. Der kleine Rablu lief neben ihr her und versuchte die überschwappenden Wasserspritzer abzubekommen.
Der Vormittag verging mit Wassertragen. Es wurde glühend heiß. Naki atmete erleichtert auf, als die Tante sie ins Haus schickte, um den Brei für die Mittagsmahlzeit zu erwärmen. Sie legte Holz auf die Feuerstelle und blies in die alte Glut. Als das Feuer wieder brannte, stellte sie den Topf mit der Grütze daneben, goss etwas Milch hinein und begann zu rühren.
Warum hatte sie eigentlich niemals mit ihrer Mutter darüber gesprochen? Irgendetwas hatte sie immer davon abgehalten. Nun plötzlich drängte es sie dazu.
Wenn die Mutter aus dem Grab zurückgekehrt war, würde sie mit ihr reden. Ob die Mutter ihr erklären könnte, woran man erkannte, ob man berufen war, und was mit den Schmerzen gemeint war, von denen Zirrkan gesprochen hatte? Oder ob sie entsetzt darüber war, dass ihre einzige Tochter nicht nach ihr Sippenmutter der Dala sein wollte, sondern eine von Dorf zu Dorf ziehende Heilerin?
Naki drehte den Topf etwas, damit er sich auch von der anderen Seite erwärmte. Dann stand sie auf und trat in die offene Tür.
Früher, bevor Zirrkan mit seiner Heilkunst in ihr Leben getreten war, hatte sie sich nichts anderes vorstellen können und nichts anderes gewünscht, als eines Tages so zu sein wie die Mutter. Und nun …
Ohne es recht zu merken, ging sie vom Haus weg und schlug den Weg zum neuen Grab unter den Eichen ein. An ihrem Eichenschößling kauerte sie nieder und strich leicht über seine Blätter. Von den Steinen, die sie einst um die gepflanzte Eichel errichtet hatte, war nichts mehr zu sehen.
Ein kleines Bäumchen war er schon. Und war doch nur eine Eichel gewesen, als die Männer das Grab erbaut hatten …
»Komm, Naki, wir bringen den Männern zu trinken! Sie werden Durst haben, so schwer, wie sie arbeiten!« Die Mutter rührte Wasser unter die Sauermilch, goss dann etwas von dem Getränk in einen kleineren Topf: »Trag du den!«, hob sich selbst den großen aufs Haupt.
Sie, das kleine Mädchen, fasste das Gefäß mit beiden Händen, setzte es sich vorsichtig auf den Kopf, hielt es mit einer Hand, fasste mit der anderen nach der der Mutter.
Die Zunge zwischen die Zähne geklemmt, den Atem vor Anspannung fast angehalten, so ging sie neben der Mutter her, bemüht, deren stolzes Kopfhalten nachzuahmen. Die Mutter ging mit ihr aus dem Haus, den Pfad zum Eichenhain entlang, zur Baustelle.
Unnahbar, hoheitsvoll, mit feierlichem Ernst ragten die großen Steine in die Höhe. Als hätten sie dort gestanden vom Anbeginn der Welt. Als wären es nicht die Männer gewesen, die sie zur Grabkammer errichtet hatten.
Naki stockte. Sie spürte ihn wieder, den Schauer, dieses Gefühl, für das sie keine Worte kannte, das sie zwang, in der Abenddämmerung allein hierher zu gehen, die Steine anzuschauen, sie zu berühren, ihre Wange an die kalten Flächen zu legen. Und plötzlich vor ihnen niederzuknien.
»Siehst du«, sagte die Mutter, »die Männer bauen schon die Außenwand des Grabes. Es wird noch größer werden als das alte Grab drüben am Hang.«
Der Bann verflog. Naki sah nicht mehr die Ewigkeit der Steine. Sie sah die Männer, die sich an der Baustelle mit einem Findling abplagten.
»Mutter, warum bauen die Männer ein neues Grab? Wir haben doch ein Grab, wo die Großmutter drin schläft und alle anderen?«
»Wir haben ein neues Dorf gebaut, weil die alten Häuser morsch geworden sind. Nun bauen wir das Grab dazu. Ein neues Dorf – ein neues Grab. Alle, die in unserem Dorf sterben, werden in diesem Grab beieinander bleiben, bis zu ihrer Wiedergeburt. Wie weit die Männer schon sind! Wie sie das geschafft haben! Und dein Muga ist der Baumeister, auf ihn kommt es am meisten an. Pass auf, gleich setzen sie einen neuen Stein!«
Die Männer waren mit einem Findling dicht vor einer ausgehobenen Grube. Auf Baumstämmen rollten sie ihn, die Koa zogen mit starken Seilen, die Dala schoben oder halfen mit Eibenholzstangen nach. Nakis Muga gab die Anweisungen.
Wie riesig dieser Stein war! Viel größer als jeder Mann und so dick wie fünf Männer gemeinsam! Selbst ihr Großer Oheim sah klein und schmal neben ihm aus, und dabei war er doch so groß und stark, ein Bär von einem Mann, sagte die Mutter immer. Ein kurzer Ruf des Muga, ein letztes Aufbieten aller vereinten Kräfte, und der Stein rutschte von den Rollen über die schräge Fläche, glitt mit dumpfem Schlag in die Grube und blieb, bis zur Hälfte versenkt, aufrecht in ihr stehen. Die Erde bebte.
»Die du Himmel und Erde und Meer geboren hast, gesegnet ist dein Leib in alle Ewigkeit«, sprach die Mutter.
»Muga!«, rief sie selbst, ließ die Hand der Mutter los und rannte. Das Gefäß auf ihrem Kopf hüpfte, die Sauermilch schwappte über, rann kühl und klebrig den Nacken herab. »Ich bring‘ dir zu trinken!«
Der Muga nahm ihr den Topf ab, trank, zog sie kurz an sich. Sie drückte sich an ihn. Er blinzelte ihr zu: »Jetzt lass die anderen trinken! Die haben es nötiger als ich. Die haben die ganze Anstrengung gehabt!«
»Aber Mutter sagt, auf den Baumeister kommt es am meisten an«, widersprach sie.
Er grinste: »Na, wenn das deine Mutter sagt!«
Sie gab den Milchtopf an den Großen Oheim weiter, doch dann kehrte sie zu ihrem Muga zurück. »Erklärst du mir, wie das Grab aussehen wird?«, bettelte sie. Er strich sich über die Bartstoppeln. Sie mochte dieses seltsam kratzende Geräusch.
»Ein andermal, Naki«, sagte er. »Du musst mich jetzt den Stein einrichten lassen. Kletter dort auf die Eiche und sieh dir alles von oben an! Dann erkennst du selbst, dass es so etwas wie ein riesengroßes Ei ist, was wir hier bauen.«
Enttäuscht verzog sie sich, blickte zweifelnd den hohen Baum empor. Sie versuchte den untersten Ast zu erreichen, sprang, verfehlte ihn, versuchte es immer wieder. »So schaffst du das nie!« Oheim Li hob sie in die Höhe, setzte sie auf den Ast. »Pass bloß auf, dass du nicht runterfällst! Ritgo bringt mich um, wenn dir was zustößt!«
»Der Große Oheim bringt niemanden um!«, erwiderte sie empört.
Er seufzte. »Natürlich nicht!«
Sie kletterte einen Ast höher und noch einen, noch einen. Dann sah sie hinunter. Überrascht sog sie die Luft ein.
Dort war die Baustelle. So anders sah von hier oben alles aus. Die lange Grabkammer aus den riesigen Findlingen mit den sorgfältig durch kleinere Steine vermauerten Fugen war mit einem Blick zu überschauen. Auf einer Seite führte eine Erdrampe bis zur Höhe der gewaltigen Decksteine. Im Abstand um die Grabkammer hatte der Muga einen schmalen Graben gezogen. Sieben große Steine waren bereits in der Linie des Grabens errichtet, standen dicht an dicht. Daneben war schon die Grube für den nächsten Stein ausgehoben.
Jetzt konnte sie es erkennen. Wenn alle äußeren Steine standen, würden sie so etwas wie einen langgezogenen Kreis bilden, der die Grabkammer umschloss.
Und wenn dann der Zwischenraum zwischen äußeren Steinen und Grabkammer mit Erde aufgefüllt und über der Grabkammer der Hügel aufgeschüttet war, würde es tatsächlich aussehen wie ein Ei. Sie wiegte sich leicht im Baum, hin und her, hin und her. Ein hünenhaftes Ei.
Sie wippte. Hin und her, auf und ab. Sie schloss die Augen, ließ sich ganz in die sanfte Bewegung gleiten. Da sah sie es vor sich, das Ei. Gras wuchs auf seiner Wölbung, Blumen blühten. Hell glänzte das steinerne Rund, vollkommen glatt und schön. Aber da, ein Sprung bildete sich an der Oberfläche des Eies, wurde breiter, größer. Etwas drang daraus hervor, wuchs in die Höhe: ein junger Baum.
Er wuchs und sprengte das Ei, breitete seine Arme, gedieh zur mächtigen Eiche, erhob sich bis in den Himmel. Eine Schlange kroch aus dem Ei, wand sich den Baum hinauf. Ein Vogel kam geflogen und ließ sich auf einem Zweig nieder.
Sie öffnete wieder die Augen. Dort unten stand die Mutter mit den Männern neben der Baustelle. Alles war unverändert. Und doch war das Ei dagewesen, der Baum, der Vogel und die Schlange.
Sie kletterte die Eiche hinunter, sprang auf die Wiese, hob eine Eichel auf. Dann lief sie zum nahen Bach und suchte Kiesel, sammelte sie in ihrem Rock, trug sie zum Eichenhain. Sie kniete nieder, riss Gras aus, glättete die Erde, versenkte die Eichel darin und begann um die vergrabene Eichel herum eine lange Kammer aus Kieselsteinen zu errichten. Noch einmal musste sie zum Bach rennen, noch einmal Steine sammeln. Sie deckte Kiesel über die Steinkammer. Nur in der Mitte, über der Eichel, ließ sie sie offen. Dann ritzte sie den Umriss des Eies um die Kammer herum in den Boden, grub Kiesel in die vorgezeichnete Linie, füllte Erde dazwischen, drückte sie fest, glättete mit den Fingern ihr Werk.
»Was hast du denn da gebaut, Naki?« Die Mutter setzte sich neben sie ins Gras.
»Ein Ei«, erklärte sie.
Die Mutter nickte. »Da oben fehlt aber noch ein Stein! Und Erde!«
»Nein, das muss so sein. Weil der Baum aus dem Ei wachsen muss. Weil die Schlange aus dem Ei kriecht. Weil der Vogel im Baum wohnt.«
»O Kind!« Die Mutter legte die Arme um sie, zog sie an sich, presste ihren Kopf an die Brust, drückte sie ganz fest, so fest hatte die Mutter sie noch nie gedrückt, es nahm ihr ja die Luft!
Sie sträubte sich. »Lass mich!«
Der Griff der Mutter lockerte sich. »Ja, ich lass‘ dich!« Die Mutter zog sich ein kleines Lederbeutelchen über den Kopf, das sie an einer Schnur unter ihrer Kleidung verborgen um den Hals trug, und legte es ihr, der kleinen Tochter, um. »Das schenke ich dir. Es ist ein Stein darinnen. Heb ihn gut auf. Es ist kein gewöhnlicher Stein. Ein ganz besonderer. Die Göttin ist in ihm. Nun wird Sie immer bei dir sein.« Die Mutter stand auf und ging.
Naki fühlte nach dem Stein in seinem Beutel, spürte ihn zwischen ihren Brüsten.
Das Ei, der Vogel und die Schlange – Zeichen der Göttin. Hatte die Göttin sich ihr damals offenbart – und ihr angekündigt, dass Sie sie in Ihre besonderen Dienste nehmen wollte? Und hatte die Mutter verstanden, was sie, das Kind, noch nicht einmal geahnt hatte?
Ja, ich lass‘ dich. Plötzlich wusste sie: Ihr Wunsch würde die Mutter nicht unvorbereitet treffen. Schon damals hatte die Mutter begriffen, dass sie ihre einzige Tochter für den Dienst der Göttin freigeben musste. Und sie mit dem geweihten Stein dafür gesegnet. Könnte sie nur gleich mit der Mutter darüber reden, über alles!
Naki ging zum Haus zurück. Sie öffnete die Tür. Beißend schlug ihr der Geruch von angebranntem Essen entgegen. Der Brei!
Die Brüder, die Oheime, die Vettern und Kusinen, Tante Mulai und Tante Gwinne, alle waren im Raum. Und alle sahen sie an.
»Ist ja ganz großartig, dass du auch schon da bist!«, sagte ihr Bruder Karu. »Kannst du uns verraten, wie man das Zeug runterbekommen soll?«
»Tut mir leid!« Erschrocken sah sie auf den Brei. Sie hatte ihn ans Feuer gestellt und vergessen! Sie kostete davon, versuchte den Widerwillen zu unterdrücken. Es schmeckte wirklich sehr angebrannt. Nein, das konnte man niemandem mehr anbieten. Aber wegschütten durfte man es auch nicht – undenkbar.
Naki sog an ihrer Lippe. Sie spürte, dass ihr Großer Oheim sie wartend ansah, und wusste, dass er ebenso wenig nachgeben würde wie Tante Mulai. Sie zögerte, holte tief Luft. »Ich esse es allein! In ein paar Tagen habe ich es geschafft. Ihr könnt ja heute mal Brot essen!«
»Das können wir!« Tante Gwinne lächelte Naki an.
Tante Mulai erklärte bestimmt: »Dann musst du heute Abend aber noch Mehl mahlen und Sauerteig ansetzen, Naki, damit wir neues Brot backen können!«
Naki unterdrückte ein Stöhnen. Kurz sah sie zu ihrem Großen Oheim hin. Er nickte kaum merklich, stimmte mit den Augen zu.
»Arme Schwester! Kein Glückstag für dich!«, sagte Wirrkon leise. Jeder wusste, dass sie das Mahlen hasste. Naki setzte sich neben ihn und zuckte die Schultern.
Tante Mulai holte einen Laib aus dem Holzkasten, schnitt ihn in Scheiben, sprach den Segen darüber und stellte eine Schüssel mit Frischkäse dazu. Alle langten nach dem Brot und fuhren damit in den Käse. Nur Naki nicht. Und auch nicht Wirrkon. Er lud sich eine Schale voll Brei und löffelte ihn, ohne eine Miene zu verziehen. »Zur Abwechslung mal ein anderer Geschmack«, meinte er und grinste Naki an. Sie grinste zurück. Auf einmal machte es ihr nichts mehr aus, den Brei zu essen.
»Ich werde mich sofort nach dem Essen auf den Weg machen«, ergriff der Große Oheim das Wort, »und das Schwein zu den Heiligen Steinen treiben. Dann bin ich zu Einbruch der Dunkelheit dort und kann es mit Lüre gleich morgen früh opfern. Auf dem Rückweg von den Heiligen Steinen will ich noch in einigen Dörfern Besuche machen. Vielleicht gelingt es mir, jemanden zu finden, bei dem wir gegen Gwinnes Töpferwaren Gerste oder Weizen eintauschen können, sonst wird es eng für uns im Winter. Ich bleibe wahrscheinlich ein paar Tage weg. Ihr kommt doch ohne mich mit dem Brunnen zurecht?«
Oheim Aktoll nickte bedächtig. »Werden wir wohl, Ritgo! Was ist, Jungs, wollen wir uns nicht wieder an die Arbeit machen?«
Die Jungen standen auf. Unmöglich, den Oheim warten zu lassen.
Die Grenzen zwischen Wachen und Schlafen verwischten sich. Hatte sie eben etwas gehört, oder war es ein Traum?
Unruhig wälzte Haibe sich herum, stieß an Knochen und Scherben, hatte nicht mehr die Kraft, sie beiseite zu schieben.
Mit brennenden Augen durchforschte sie die Finsternis. Noch immer zeigte sich nicht die geringste Andeutung einer Lichtspur über dem Eingang. Ihre letzte Nacht im Grab nahm und nahm kein Ende.
O Göttin, steh mir bei!
Der Durst glühte in Augen, Nase, Mund und Rachen. Ihr ganzer Körper ein Schrei nach Wasser. Mit der ausgedörrten Zunge fuhr sie sich über die rauen Lippen: Sand auf dürren Blättern.
Gnadenlos brannte die Sonne vom Himmel. Hitze flimmerte über dem Getreide. Glühend stand die Luft über dem sengenden Feld. Längst waren die Lieder verstummt. Nun versickerten auch die Gespräche, versiegten, wie der Bach versiegt war.
Seite an Seite kämpften sie sich durch das Feld, alle Frauen und Mädchen des Dorfes. Ein Bündel Ähren mit der Linken zusammenraffen, mit der Sichel abschneiden, in den Korb werfen, weiter.
Gewöhnlich war die Ernte ein Fest, Höhepunkt des Jahres. Doch heute war es nichts als eine Schinderei: jede Bewegung eine schier unerträgliche Last. Selbst die Ältesten konnten sich nicht an eine vergleichbare Hitze erinnern. Trocken klebte die Zunge am Gaumen, der Durst brannte in der Kehle.
Die kleine Naki sammelte mit der kleinen Uori, Mulais Tochter, herabgefallene Ähren in einen Korb. Ihr Gesicht war hochrot. »Geh, Naki, lauf zum Brunnen, schöpf Wasser, trink und kühl dich! Und du auch, Uori!« Dankbar sahen die beiden Mädchen sie an, stellten den Korb ab, wandten sich erleichtert zum Gehen.
Mulai richtete sich auf. »Aber dann kommt ihr zurück und bringt zwei Ledereimer Wasser mit!«, rief sie den Mädchen nach.
Haibe strich sich den Schweiß von der heißen Stirn, reckte sich kurz. Da sah sie gegen die Sonne den Mann über den abgeernteten Acker auf sie zukommen. Die schlanke, schmale Gestalt. Er kann es nicht sein. Nicht nach acht Jahren.
Sie starrte ihm entgegen. Ließ die Sichel sinken. Warf sie in den Korb. Setzte sich in Bewegung. Ihm entgegen. Dann stand sie vor ihm. Wusste, er war es. Und erkannte ihn kaum. Sein Gesicht war furchtbar verändert. Eingefallene Wangen. Tiefe Linien um seinen Mund. Und ein Ausdruck in den Augen –
»Tot«, sagte er leise. »Sie sind alle tot. Meine Vettern, mein Oheim, meine Freunde. Die Kinder meiner Frau, die Kinder meiner Schwester, alle Kinder. Tot. Alle tot.«
Sie konnte nicht sprechen. Wortlos streckte sie die Hände nach ihm aus, wortlos umfasste sie sein Gesicht, wortlos zog sie seinen Kopf zu sich heran, barg ihn an ihrer Schulter. Er weinte. Sie streichelte sein Haar, hielt ihn umfangen, wiegte ihn wie ein Kind. »Die Wölfe«, flüsterte er heiser, »es waren die Wölfe.«
Haibe zog Arme und Beine an und rollte sich zusammen wie ein ungeborenes Kind, barg sich zitternd in sich selbst. Sie war so schwach, dass ihr jeder Atemzug zu schwer erschien.
Ich überstehe es nicht, dachte sie. O Göttin, es war alles umsonst. Meine Kraft reicht nicht für den vierten Tag. Sie reicht ja nicht einmal für die dritte Nacht. Ach, Zirrkan!
Sie glitt hinweg in einen ohnmächtigen Schlaf.
Ein Sandsturm blies ihr ins Gesicht. Heiße Sandkörner bissen in ihre Haut, brannten in ihren Augen, glühten in ihrem Mund. Sie lief, stemmte sich gegen den Sturm. Dort vorn war die Mutter. Sie musste zu ihr. Die Mutter schrie etwas. Sie konnte es nicht verstehen. Der Sturm heulte. Die Mutter gab ihr Zeichen mit Armen und Händen. Was wollte sie ihr sagen?
Sie rannte der Mutter entgegen durch glimmenden Sand. Da plötzlich gab der Boden unter ihr nach. Ihre Füße staken fest, sanken ein. Entsetzt sah sie nach unten: Treibsand. Sie sank tiefer. Bis zu den Hüften. Bis zur Brust. Sie schlug und ruderte mit den Armen. Sie wurde weitergezogen. Glut hielt sie gefangen.
Die Sandberge, dachte sie, die Sandberge fließen nach Westen. Sie reißen mich mit. Das Gesicht der Mutter über ihr, unendlich traurig. »Warum hast du mich nicht gehört?«, fragte die Mutter. »Warum hast du meine Zeichen nicht verstanden?«
»Mutter, hilf mir!«, schrie sie. »Zieh mich raus!«
Das Gesicht der Mutter sehr fern. »Aber ich hab‘ keine Hände!«
Sie rannte über rotglühende Kohle. Die Hitze flammte an ihrem Körper empor. Dann sah sie die sonnenbeschienene Wiese. In deren Mitte einen großen Stein. Auf dem Stein eine Schlange. Plötzlich war da ein Stier. Die Schlange glitt von dem Stein, glitt auf den Stier zu, richtete sich auf, ihm entgegen. Der Stier senkte seine Hörner, stürmte auf die Schlange zu. Und er zertrat sie unter seinen Hufen. Nein! wollte sie schreien, das ist nicht möglich! Nie würde ein Stier die Schlange zertreten!
Aber da lag sie, die Schlange – tödlich verletzt.
Der Himmel wurde schwarz und Blitze zuckten herab, die Welt hallte wider von Donnergetöse und die Erde bebte von Pferdehufen. Und Wölfe drangen aus dem Wald hervor und Blut troff von ihren Lefzen.
Mit rauem Schrei fuhr Haibe in die Höhe, starrte in die Finsternis. Ihr Puls jagte. Es dauerte lang, bis sie begriff, wo sie sich befand.
Erschöpft ließ sie sich wieder zu Boden sinken.
Die dritte Nacht im Grab – oder ist schon der vierte Tag? –, bald ist es soweit – du wirst Stimmen hören und Bilder sehen, in denen Erkenntnis liegt –
Die Wölfe, warum die Wölfe – Männer gibt es, die sind in Wahrheit gar keine Menschen – es waren die Wölfe – Blut troff von ihren Lefzen – die Sandberge halten sie auf – die Sandberge fließen nach Westen – die Hitze – die Sterne künden Unheil – die Priesterin ist in großer Sorge – eine weite Reise ohne Abschied – der Bach war ausgetrocknet – vor acht Sommern – Zirrkans Dorf – die Wölfe – der Bach war ausgetrocknet – das Zeichen – du bist doch meine Mutter – warum hast du meine Zeichen nicht verstanden.
Auf einmal war sie da, die Erkenntnis: die Söhne des Himmels. Männer, die Wölfe sind. Sie werden uns überfallen.
Die Große Göttin hat sich nicht von uns abgekehrt. Sie will uns helfen. Die Trockenheit ist ihre Warnung. Sie ist unsere Mutter. Sie hat uns ein Zeichen gegeben.
Aber wir haben es nicht verstanden.
»Taku!«, schrie sie. »Taku! Komm und hol mich hier raus! Ich weiß, was wir wissen müssen! Ich muss es euch sagen! Ich muss euch warnen! Die Wölfe kommen! Fliehen! Wir müssen fliehen!«
Kalt und stumm umschlossen sie die Steine. Taku hört mich nicht. Er holt mich erst am Abend. Ich muss bis zum Abend durchhalten. Ich muss nachdenken. Mein Kopf, alles ist so wirr, kein klarer Gedanke – Zirrkans Dorf – das darf uns nicht geschehen. »Mütter, Ahnen!«, keuchte sie. »Ich bin Blut von eurem Blut, durch unzählige Fäden mit euch verbunden! Helft mir! Sagt mir, was ich tun soll!«
Den Allgemeinen Dorfrat muss ich einberufen, noch am Abend, sobald Taku mich hier befreit hat. Es ist meine Aufgabe. Ich bin die Mutter des Allgemeinen Dorfrates. Wir müssen fliehen, werde ich ihnen sagen, sofort, noch diese Nacht! Aber wohin?
Wir müssen unsere Vorräte mitnehmen und unser Vieh. Aber die Ernte ist noch nicht eingebracht! Und wir können doch unsere Felder nicht zurücklassen, den Boden, in dem wir verwurzelt sind. Und unsere Gräber, unsere Mütter und Ahnen – Nicht einen Mann, nicht ein Kind. Und die Frauen und Mädchen –
Ich muss es verhindern.
Und wenn wir uns verstecken? Doch wo? Und wann? Und wie lange?
Oder uns zur Wehr setzen? In aller Eile Befestigungen bauen? Aber wir können doch nicht kämpfen!
Die Streitaxt. Krieger, die von frühester Kindheit das Töten gelernt haben. Keine Menschen –
Ich weiß nicht, ich kann nicht, ich muss –
Naki wälzte sich herum. Erst hatte sie nicht einschlafen können, und nun wachte sie dauernd auf! Noch immer war es dunkel. Aber irgendetwas hatte sich verändert. Etwas war da.
Naki lauschte. Da war nichts. Nur die ruhigen Atemzüge der Schlafenden und der Wind im Rindendach. Noch immer kein Regen. Sie würde wieder den ganzen Tag Wasser tragen müssen. Und dann auch noch Brot backen! Sie sollte lieber schlafen.
Doch alles Zureden half nicht. Eine unerklärliche Unruhe hatte von ihr Besitz ergriffen. Es hielt sie nicht mehr im Bett. Vorsichtig schob sie den kleinen Rablu beiseite, der sich dicht an sie gekuschelt hatte, richtete sich auf, kletterte über Uori und stieg vom Lager.
Sie tastete sich zur Tür, öffnete sie leise, trat hinaus. Die Luft war frisch. Das erste schwache Grau kündete das Ende der Nacht an.
Kaum im Freien, fühlte Naki sich ruhiger. Sie lehnte sich an einen der beiden Pfosten, die das vorgezogene Hausdach trugen, und sah nach Osten, beobachtete das Verblassen der Sterne. Zeichneten sich nicht Schleier am Himmel ab, die ersten Vorboten aufziehender Wolken? Gespannt wartete sie, ob Morgenrot von baldigem Regen künden würde.
Und nichts, kein Vorgefühl warnte sie mehr.
Eine Männerhand presste sich hart auf ihren Mund. Ein Männerarm umschlang sie von hinten, drückte sie an den Pfosten.
Und die Welt, die sie bis zu diesem Augenblick geborgen hatte, hörte auf zu bestehen.
Schreiend fuhr Haibe auf. Sie horchte. Das Blut dröhnte in ihren Ohren. Dahinter, schwach, fern, wie zum Echo zerfetzt – verzweifelte Schreie? Sie strich sich über die Stirn: Wo war die Wirklichkeit, wo der Wahn? Sie presste die Fäuste an die Schläfen. O Göttin, hilf! Lass mich nicht schwach werden!
Sie durchforschte die Finsternis, sah die dünne Linie und das sich erweiternde Dreieck des Lichts. Der vierte Tag war angebrochen.
Diesen einen Tag lass mich noch durchstehen. Ihn überleben. Ich muss die anderen warnen. Völlig entkräftet sank sie zusammen.
Sie tanzte mit den Frauen des Dorfes vor dem Grab den Tanz der Erneuerung. Die Kraft strömte aus der Erde in ihre Füße, durch ihren Körper hindurch, verband sich mit den anderen, verband sich mit den Müttern und Ahnen.
Unter ihren Füßen tat die Erde sich auf, tiefer und tiefer tanzten sie hinab, tanzten in den Ursprung der Erde.
Ein schriller Schrei. Der Kreis zerriss, wurde zur Schlange. In immer enger werdenden Windungen tanzten sie in die Mitte einer Schnecke. Dort im Zentrum brannte ein Feuer. Beißend hing der Rauch in der Luft.
Die erste Frau erreichte das Feuer, verschwand darin, die zweite, die dritte. Verschwand und kehrte nicht wieder. Ich muss umkehren, dachte Haibe, dort im Feuer wartet der Tod. Sie versuchte sich gegen die Richtung des Tanzes zu wehren, vom Feuer weg zu tanzen, doch mit unheimlicher Kraft zog ihre linke Nachbarin sie weiter, zog sie näher ans Feuer. Haibe stemmte sich dagegen, vergebens, sie wollte ihre Hand zurückreißen, doch die vor ihr Tanzende umklammerte sie fest. Mit Fingern ohne Haut und Fleisch.
Entsetzt sah Haibe der Frau ins Gesicht: Ein Totenschädel grinste sie an. Um den knöchernen Hals schimmerte die Bernsteinkette. Dann verschwand das Skelett im Qualm des Feuers. Doch unerbittlich hielt sie die Knochenhand.
Sie zerrte und zog, bekam ihre Hand nicht frei. Der Qualm biss in ihren Hals.
Haibe wimmerte. Sie roch den Rauch. Ein Traum, nur ein Traum. Aber das Feuer, in dem ich verbrennen werde – ich rieche den Rauch! Sie krümmte sich.
Ich darf nicht dem Wahn verfallen! Lüre hat mir vorhergesagt, dass es so kommen werde. Du wirst deinen Sinnen nicht mehr trauen können und die Grenzen deines Körpers verlieren … Du wirst dich dem Tode nah wissen …
Nah wissen. Aber nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Ich muss ihnen die Botschaft bringen! Fliehen, wohin, sagt es mir –
Sie glitt in einen tiefen Abgrund.
Da, plötzlich, hörte sie ein Dröhnen, im Schlag ihres jagenden Herzens dröhnte es lauter, die Steine hallten wider von diesem Dröhnen, und dann setzten sie sich in Bewegung, kamen immer näher, sie spürte es im Finstern, die gewaltigen Deckensteine senkten sich auf sie herab, die Trägersteine rückten heran, gleich würden sie sie umschließen, zermalmen. Aus der Tiefe des Grabes schrien die Mütter.
Haibe presste die Hände an die Ohren. Schon berührte sie der kalte Atem der Steine. Da plötzlich wichen die Steine zurück, weiteten sich, wurden durchsichtig, ließen den Blick frei, ließen Haibe in den Wald sehen.
Die Abendsonne schien durch die Bäume. Wie Kupfer glühten die Stämme. Rötlich schimmerte der Sand auf dem Pfad, der über die kleine Lichtung führte.
Dort am Bach die Trauerweide, unter deren dicht herabhängenden Zweigen sie auf Zirrkan gewartet hatte … Wie einst ließ sie sich unter dem Blätterzelt nieder, sah durch den grünen, wispernden Vorhang.
Sie hörte Schritte im Wald. Viele Schritte. Dann traten Menschen zwischen den Bäumen heraus. In tiefem Schweigen gingen sie, schwarze Schemen gegen das rötliche Licht, Männer zunächst, Männer mit bärtigen Gesichtern, wehenden Haaren und schrecklichen Wolfsschädeln auf ihren Köpfen, Wolfsfell auf ihren Schultern, darüber Langbogen und Köcher, dann Frauen, gebückt unter hoch aufgepackten Rückentragen, eine hinter der anderen, die Hände auf den Rücken gefesselt, mit Stricken aneinandergebunden.
Eine Frau schwankte, blieb stehen, der Zug geriet ins Stocken, schon war einer der Männer neben der Frau, schlug sie, ein anderer drohte ihr mit erhobener Axt, die Frau taumelte weiter. Die Frauen zogen auf dem Pfad an der Trauerweide vorbei, aneinandergefesselt, von den Männern getrieben wie Vieh, Haibes Augen noch immer geblendet, noch immer konnte sie niemanden erkennen, doch da, nicht weit von ihr entfernt, war das nicht Kugeni, Zirrkans Schwester? Plötzlich war sie hinter Kugeni, legte ihr die Hand auf die Schulter.
Kugeni drehte sich um, sah sie aus verstörten Augen an.
Es war nicht Kugeni. Es war Naki.
»Naki!«, schrie Haibe. Dann brach sie in tiefer Bewusstlosigkeit zusammen.
Feuer glühte in ihrem Leib. Sie tastete sich ab, fühlte Knochen und darüber Haut wie trockenes, heißes Gras. Qualvoll schrie jede Faser ihres Körpers nach Wasser. Alle Feuer ihres Lebens wüteten in ihr, vereinten sich zu einer alles verzehrenden Glut.
Wasser – Wasser –
Wenn Taku das Grab öffnete, würde er ihr etwas zu trinken bringen …
Musste nicht längst Abend sein? Einmal noch nahm sie ihre Kräfte zusammen, bäumte sich auf in verzweifelter Willensanstrengung. Sie durchforschte die Finsternis, drehte sich nach allen Seiten, suchte mit brennenden Blicken nach dem schmalen Lichtstreifen und dem hellen, tröstenden Dreieck, fand es nicht. Ihr Verstand weigerte sich zu begreifen, was das bedeutete: Es war Nacht.
»Taku«, flüsterte sie tonlos, ihre Stimme nur noch ein trockenes Kratzen, »am vierten Tag bei Sonnenuntergang, warum bist du nicht gekommen, du bringst mich um, warum, Taku, warum …«
Zirrkans Schwester – der Zug der gefesselten Frauen – und Naki –
Die Erkenntnis kam über sie und tötete sie.
Sie schwebte. Schwerelos ruhte sie dicht unter den mächtigen Deckensteinen des Grabgewölbes.
Kein Durst mehr und kein Hunger, kein Brennen und keine Qual. Alles, was blieb, war gelöste Leichtigkeit.
Ihr Blick durchdrang den Stein. Hell sah sie das Morgenlicht im Freien. Im Dunkel des Grabes, zwischen Knochen und Scherben, sah sie sich selbst. Leblos lag sie dort unten, merkwürdig verkrümmt und eingefallen, spitz stachen die Knochen aus der fahlen, vertrockneten Haut.
Was mache ich dort, warum liege ich am Boden, fragte sie sich mit lächelnder Verwunderung.
Da hörte sie ein schreckliches Knirschen. Schmerzhaft durchdrang es sie, wurde lauter und lauter. Die Steine traten auseinander, öffneten einen schmalen, schwarzen Spalt.
Sie wurde von einer ungeheuren Kraft erfasst, auf diesen Spalt zugesaugt, sie wollte sich wehren – Lasst mich, ich will nicht, ich muss bei meinem Körper bleiben! – umsonst, näherte sich unerbittlich diesem Spalt, wurde hineingezogen, hineingepresst, ein schmaler, finsterer Höhlengang, kaum passte sie hindurch, wusste plötzlich: Dies war der Weg, den sie gekommen war, nun ging sie ihn zurück, kein Sträuben half, zurück, zurück –
Und Freiheit – Weite – Licht.
Das Licht, heller noch als die Sonne, umfing sie mit glänzendem Schein, umschmiegte sie wie weiches, warmes Wasser und blendete nicht.
Sie sah nichts als dieses Licht, und doch wusste sie mit unerschütterlicher Gewissheit: Sie war in dem Licht, Sie war es selbst, die Eine, die Drei war in Eins und Eins in Drei.
Gestalten kamen aus dem Licht auf sie zu, sie hatten keinen menschlichen Körper, und doch erkannte sie sie sofort: ihre Mutter, Tante Kjolje, ihr Großer Oheim. Strahlend kamen sie ihr entgegen.
Freude und Ruhe umströmten sie. Sie bewegten ihre Lippen nicht, und doch sprachen sie zu ihr: Komm mit uns, Haibe, fürchte dich nicht, wir führen dich, wir geleiten dich, dein Schmerz hat ein Ende, es ist gut, alles gut …
Unwiderstehlich war der Wunsch, bei ihnen zu bleiben, tiefer in das Licht hineinzugehen. Sie folgte ihnen.
Neue Gestalten tauchten auf, unsicherer als die anderen, Suchende beinahe noch wie sie selbst, und doch auch sie voll heiterem Frieden: ihre beiden Vettern, ihre Söhne Wirrkon, Karu und der kleine Rablu, ihre Brüder Li und Aktoll und dort Taku und die anderen Männer der Koa. Sie eilte ihnen entgegen, glücklich, sie alle zu sehen, heil bei sich zu wissen. Aber da war etwas, was sie zurückhielt.
Sie formte den Gedanken, sie musste ihn nicht aussprechen, sie wusste, dass die anderen ihn hörten: Was ist mit Naki?
Mitleid legte sich wie ein Schleier über die Gesichter: Naki ist noch nicht berufen.
Da war das Bild wieder da: Naki im Zug der gefangenen Frauen, gefesselt, gebeugt unter der schweren Last …
Ich muss zu Naki, schrie sie stimmlos in das Licht, ich bitte dich, Große Göttin, versteh, dass ich nicht bleiben kann, sosehr ich es mir wünschte, schick mich noch einmal zurück, bitte, ich muss Naki helfen …
»Haibe! Komm zurück! Du darfst nicht tot sein, nach allen anderen nicht auch noch du! Ich brauche dich! Trink das, ich flehe dich an, trink!«
Ihr Körper war eine flammende Qual.
»Große Bärin, hilf meiner Schwester! Lass mich nicht zu spät gekommen sein!«
Jemand hielt ihren Kopf, träufelte Wasser in ihren Mund, unter grässlicher Anstrengung kämpfte sie gegen den glühenden Schmerz, schluckte das Wasser, trank.
»So ist es gut. Trink weiter, Haibe, trink! O Schwester, meine Schwester!«