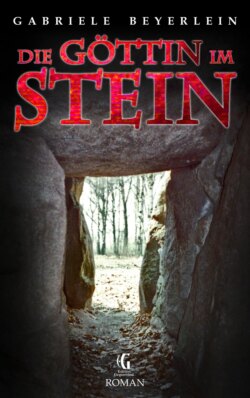Читать книгу Die Göttin im Stein - Gabriele Beyerlein - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 4
Оглавление»Amros, sag Agala, ich möchte Tee mit Sahne!«
»Ja, Herr!« Morias kleiner Bruder wandte sich gehorsam an die Schwägerin: »Mein Vater möchte Tee mit Sahne!«
Agala kauerte mit gesenktem Kopf an dem niedrigen Tisch vor dem Vater und Krugor und legte ihnen das Fleisch vor. Nun erhob sie sich – sorgfältig achtete sie darauf, dass sie dem Vater nicht das Gesicht zukehrte – und ging zur Tür, nein, sie ging nicht, sie huschte. »Sag deinem Vater, ich bereite den Tee sofort!«, erwiderte sie leise.
»Agala sagt, sie macht ihn sofort«, gab Amrox weiter.
Eine belanglose Begebenheit, die sich von selbst verstand. Und doch war dies der Augenblick, in dem Moria die Erkenntnis mit spitzem Stich traf: Mir wird es ergehen wie Agala. Auch ich werde bald verheiratet. Dann bin ich nicht länger Rösos‘ Tochter in ihrem Vaterhaus. Sondern eine Fremde unter Fremden. Mit einem Schwiegervater, vor dem ich das Gesicht abwenden muss und der mich behandelt, als wäre ich nicht da, einer Schwiegermutter, die mich mit Arbeit überhäuft und mir das Leben schwermacht, und einem Ehemann, der mich …
Moria stellte das Brot vor den Vater und den großen Bruder und folgte Agala in den rußgeschwärzten Nebenraum. Agala kauerte an der Feuerstelle, blies in die Glut. Zum ersten Mal bemerkte Moria die Anspannung in Agalas stillem Gesicht, die dunklen Schatten unter ihren Augen. Agala wandte sich zum großen Wassergefäß. Ein Laut des Erschreckens entfuhr ihr. »Es ist kein Wasser mehr da!«
Die Magd, die gewöhnlich das Wasser holte, arbeitete mit der Mutter im Speicher. Und Agala musste auch noch für Sahne sorgen.
In ungewohnter Hilfsbereitschaft sagte Moria: »Ich hol‘ dir schnell welches!« Sie rannte über den Hof, zum Tor hinaus, zum Bach hinüber. Der Vater würde ungeduldig werden und es Agala spüren lassen. Und Krugor würde es nicht in den Sinn kommen, Agala vor der Missbilligung durch den Vater zu schützen.
Krugor kam es überhaupt nie in den Sinn, sich anders um seine junge Frau zu kümmern, als ihr knappe Befehle zu erteilen und sie nachts im Dunkeln rasch und ohne Zärtlichkeit zu nehmen.
Moria wusste es, obwohl sie in der anderen Zimmerecke schlief: Oft genug hatte sie sich in den Wochen seit der Hochzeit des Bruders die Hände an die Ohren gepresst, um Krugors Keuchen nicht zu hören …
Nein, das Keuchen war nicht das Schlimme. Das Schlimme war, dass man von Agala nichts hörte, nicht den geringsten Laut.
Moria bückte sich zum Bach, füllte das Gefäß nur halb, um schneller zurücklaufen zu können. Krugor hatte Agala vor der Hochzeit nie gesehen noch sie ihn. Sie konnten sich ja gar nicht lieben.
Dieser Wolfskrieger auf dem Fest …
Lykos. Mit ihm wäre es anders. Mit ihm ließe sich sogar ein Schwiegervater ertragen und eine Schwiegermutter. Er hatte sie beobachtet, sie nicht mehr aus den Augen gelassen. Er wollte sie, nur sie, nicht einfach irgendein Mädchen aus guter Familie, wie es Krugors Absicht gewesen war. Wie sie sich angeschaut hatten …
Die Hitze schoss ihr in die Wangen. Wenn sie nur wüsste, ob der König wirklich für ihn bei ihrem Vater um sie werben würde!
Sie rannte. Als sie zurückkam, war auch die Mutter im Raum und bereitete Preiselbeermus für die Nachspeise. Agala hatte das Feuer nachgeschürt, Sahne aus der Vorratsgrube im Hof geholt und die Spanschachtel mit den Lindenblüten bereitgestellt. »Du warst schnell«, sagte sie dankbar, erhitzte ein klein wenig Wasser, brühte den Tee und füllte den Tontopf nach.
Moria presste auf Geheiß der Mutter saure Milch durch ein Tuch. Endlich war der Tee fertig. Agala brachte ihn zu den Männern. Als sie zurückkam, forschte Moria im Gesicht der Schwägerin. »Mach dir nichts draus«, flüsterte sie Agala zu.
Diese blickte sie verwundert an, lächelte dann zaghaft. »Ich hole neues Brennholz, Schwiegermutter«, sagte sie über die Schulter und wandte sich hinaus.
»Und ich helfe dir«, rief Moria und folgte der Schwägerin, ehe die Mutter etwas einwenden konnte.
Draußen dehnte sich Agala und strich sich die Haare aus der Stirn. »Du bist plötzlich so hilfsbereit«, sagte sie.
»Ach«, meinte Moria und zuckte die Achseln. »Du tust mir leid.«
»Leid?«
»Na ja, es muss schwer sein, von daheim weg und in eine andere Familie, wir sind doch noch fremd für dich …«
Ein Zittern lief durch Agalas Körper. Und plötzlich legte Agala Moria die Arme um den Hals, lehnte ihren Kopf an ihre Schulter und weinte. Moria stand hilflos da, rührte sich nicht. »Noch nie hat hier jemand etwas so Liebes zu mir gesagt!«, schluchzte Agala dicht an ihrem Ohr.
Zaghaft legte Moria die Hand auf das Haar der Schwägerin. Agala löste sich wieder von ihr, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. »Holen wir Holz!« In stiller Übereinkunft erledigten sie die Arbeit.
Als die Männer gegessen hatten, aßen Moria und Agala mit der Mutter und den anderen Frauen und den Kindern die Reste. Dann schickte die Mutter Agala und Moria in den Gemüsegarten: Die Beete mussten gehackt und gesäubert werden.
Agala ging voraus. Moria holte noch die Geräte aus dem Schuppen. Als sie in den Garten kam, kniete Agala mitten in einem Beet und zeichnete mit den Fingern etwas in die Erde. »Was tust du da?«, fragte Moria und trat neben sie.
Agala zuckte zusammen, »Ach, nichts!« und verwischte hastig ihre Zeichnung.
Aber Moria hatte gesehen, was Agala gezeichnet hatte: ein offenes Dreieck. Plötzlich war Morias Mund trocken. Das Dreieck. Das Zeichen der Schwarzen Göttin des Alten Volkes.
Der Vater hatte streng verboten, dass an seinem Hof die Schwarze Göttin angerufen wurde. Sie musste es ihm sagen. Er würde dafür sorgen, dass Krugor Agala schwer bestrafte, vielleicht sogar tötete, so wie der Vater vor Jahren eine seiner Nebenfrauen –
Ein Alp legte sich auf ihre Brust. Sie konnte es nicht. Nicht Agala, die an ihrer Schulter geweint hatte. Sollte sie die Schwägerin warnen? O nein, damit wäre offensichtlich, dass sie gesehen hatte, was sie niemals hätte sehen und verschweigen dürfen!
Wenn sie tat, als habe sie nichts bemerkt, dann war es so, als sei alles in Ordnung. Und außerdem – vielleicht hatte sie sich getäuscht!
Agala nahm eine Hacke und begann scheinbar unschuldig zu arbeiten. Moria ließ sich neben ihr nieder und versuchte zu vergessen, was sie gesehen hatte. Es gelang ihr nicht. Aber sie wusste nun, sie würde die Schwägerin nicht verraten. Denn schließlich, war sie selbst nicht um vieles schuldiger, auch wenn es schon so lange zurücklag?
Heftig hackte sie gegen das Wirbeln in ihrem Kopf an.
Sie war ein kleines Mädchen im kurzen Kleid: Den Finger im Mund stand sie am Tisch, keiner achtete auf sie, alle Frauen waren mit der Vorbereitung des Gastmahls beschäftigt. Sie nutzte die allgemeine Hast, um rasch den Finger in den süßen Brei und dann wieder voll scheinbarer Unschuld in den Mund zu stecken, wieder und wieder. Niemand merkte es.
Mit hochrotem Gesicht gab die Mutter den Nebenfrauen, den Mägden und Cythia, der großen Schwester, Anweisungen, lief hin und her, kostete den Met, prüfte die Tücher, sah nach dem Brot im Ofen, der Suppe im großen Topf, dem Fleisch am Grillspieß, rührte Beeren unter die Dickmilch.
»Geh, Moria, steh mir hier nicht im Weg!« Ungeduldig schob die Mutter sie beiseite. Sie schlüpfte aus dem Haus. Auf eine Gelegenheit wie diese hatte sie gewartet.
Sie spähte über den Hof. Kein Mensch zu sehen. Und das Tor einen Spaltbreit geöffnet. Unbemerkt zwängte sie sich durch das schwere Tor, blickte noch einmal ängstlich zurück, dann rannte sie den Weg hinunter, so schnell sie konnte.
Als sie die Hecke erreicht hatte, verließ sie den Weg, lief im Sichtschutz der dichten Büsche, etwas langsamer nun: Hier hatte sie keine Entdeckung mehr zu fürchten. Raureif lag auf der morgendlichen Wiese, brannte unter ihren nackten Füßen. Dennoch war ihr heiß.
Mit Cythia gemeinsam hatte sie schon manchmal etwas Verbotenes getan. Sie war sehr mutig, die große Schwester. Aber jetzt, ganz allein –
Sie erreichte das Wäldchen, schlug sich hindurch, trat wieder ins Freie hinaus, stockte: Dort lag er, am Rand des kleinen Dorfes, der armselige Hof ihrer Freundin Wai. Sie durfte nicht mehr hingehen.
Der Vater war zornig geworden, als er erfahren hatte, dass sie mit einem Mädchen aus dem Dorf gespielt hatte, die Mutter hatte er angeherrscht: Warum hast du das nicht unterbunden! Ich will nicht, dass meine Tochter mit Kindern vom Alten Volk verkehrt!
Die Schwiegermutter hat gesagt, es kann nicht schaden, wenn eine zukünftige Hausfrau weiß, wie es bei den Bauern zugeht, hatte die Mutter sich verschüchtert zu rechtfertigen gesucht, doch da war der Vater noch zorniger geworden und hatte nicht nur auf die Mutter, sondern auch auf die Großmutter geschimpft, und dabei war die auf den Tod krank gewesen. Und dann hatte er Moria verboten, zu dem Dorf zu gehen oder mit der Freundin auch nur ein Wort zu reden oder einen Blick zu tauschen. Aber eine Freundin blieb doch eine Freundin. Und außerdem hatte Wai versprochen, ihr das Geheimnis der Göttin zu verraten. Wenn der Vater davon wüsste! Die Göttin zu besuchen, das war noch viel schlimmer, als zu Wai zu gehen.
Sie lief langsamer, blieb stehen, zögerte. Eben wollte sie wieder umkehren, da öffnete sich die Hoftür, und ein Mädchen kam heraus. Sie lief auf es zu. »Wai!«, rief sie schon von weitem. Wai winkte, kam ihr entgegen. Ihre Zöpfe wehten im Wind. Dicht voreinander blieben sie stehen. Plötzlich war eine große Befangenheit zwischen ihnen.
»Du warst lang nicht hier«, sagte Wai.
»Ich durfte nicht.« Wai nickte, als habe sie diese Antwort erwartet.
Sie schwiegen. »Ich darf auch jetzt nicht«, sagte Moria schließlich. »Aber es ist mir gleich!«
Wai strahlte. »Du traust dich was!« Und dann, nach einer Pause: »Dann trau‘ ich mich auch. Ich zeige es dir, das Geheimnis.«
»Gleich?«, fragte sie. Ihr Herz klopfte.
»Ja, gleich. Aber erst musst du schwören!«
Wai zeichnete ein großes offenes Dreieck auf den Boden. »Da trete hinein! Und jetzt schwöre bei der, die Eins ist in Drei und Drei in Eins! Schwöre, dass dir die Zunge abfallen soll und du nie wieder sprechen kannst, wenn du ein Wort von dem verrätst, was ich dir zeige!«
Sie schluckte. Schaute sich rasch noch einmal um.
Dann trat sie in das Dreieck und sprach den Schwur.
»Komm!« Wai nahm ihre Hand. Gemeinsam liefen sie auf den großen Wald zu. Sie krochen durch die Büsche, tauchten zwischen den Bäumen ein, drangen tiefer und tiefer in den Wald. Wusste Wai überhaupt, wohin sie gehen mussten? Würden sie zurückfinden?
Nach endlos erscheinender Zeit erreichten sie eine kleine Lichtung. Wai blieb stehen und wies auf den großen runden Stein inmitten der Lichtung.
»Da ist sie«, sagte Wai sehr leise, feierlich und scheu. Moria stieß die Luft aus. Die Göttin hatte Wai ihr versprochen, und nun war da nichts als ein riesiger Stein. Wäre nicht Wai gewesen, wäre sie gleich wieder umgekehrt.
Langsam machte sie ein paar Schritte auf den Stein zu. Wai war ihre Freundin, Wai hielt diesen gewöhnlichen Stein für die Göttin ihres Volkes, sie durfte Wai nicht vor den Kopf stoßen. Noch ein Schritt. Da plötzlich stockte sie. Der Stein sah sie aus unzähligen glänzenden Augen an! »Die Augen der Göttin«, flüsterte Wai dicht neben ihr.
Sie nickte. Plötzlich drängte alles in ihr niederzuknien. Etwas so Heiligem durfte sie sich doch nicht nähern! Widerstrebend ließ sie sich von Wai zu dem Stein ziehen. Die Augen erloschen.
Jetzt sah sie, dass in die glattgeschliffene Oberfläche des Findlings viele Schälchen eingelassen waren, in denen Feuchtigkeit schimmerte.
»Die Tränen der Göttin. Sie weint um unser Leid«, wisperte Wai und strich ehrfurchtsvoll über den Stein. »Fass Sie auch an, komm!« Wai führte ihre Hand. Sonst hätte sie nie gewagt, den Stein zu berühren. Sie zitterte, als sie die glatte, kühle Oberfläche fühlte.
»Du musst dich nicht fürchten«, behauptete Wai. »Pass auf, mach alles so, wie ich es mache!«
Wai trat ganz dicht an den Stein, erhob sich auf die Zehenspitzen, näherte ihren Mund einem der Schälchen, trank. »Trink auch Ihre Tränen! Sie erhalten dich gesund!«, befahl Wai.
Einen Augenblick fühlte Moria, wie etwas sie zurückhalten wollte, eine harte Hand griff mitten in ihr Herz, das Gesicht ihres Vaters blitzte vor ihr auf, zornig drohend sah er sie an, doch dann spürte sie den kühlen Schutz des Steines, näherte ihre Lippen dem Schälchen, saugte die Feuchtigkeit auf. Schauer rieselten ihr den Rücken hinunter.
»Jetzt müssen wir unsere Augenlider benetzen, damit wir sehend werden!«, sagte Wai.
Moria wusste nicht, was das war: sehend werden. Aber sie tat es Wai nach. Als sie mit dem feuchten Finger ihre Augenlider berührte und die Tränen der Göttin fühlte, spürte sie, wie etwas mit ihr geschah. Sie wusste nicht, was. Aber es war da.
»Und wenn wir uns an dem Stein reiben, dann werden wir fruchtbar«, erklärte Wai. Und fügte in plötzlicher Verlegenheit hinzu: »Na ja, dazu sind wir noch zu klein.« Stumm standen sie da.
»Pass auf«, sagte Wai endlich, »ich habe etwas für dich!« Wai öffnete ihre Gürteltasche und holte zwei Kieselsteine hervor. Den einen legte sie Moria in die Hand. »Tauch ihn in die Tränen der Göttin! Dann geht Ihre Kraft aus dem großen Stein in den kleinen! So kannst du Sie immer bei dir haben!«
Sie starrte auf den Kiesel in ihrer Hand. Hell und glatt war er, fast wie ein Vogelei geformt, nur da, an der Rundung, war eine kleine Vertiefung. Sie schloss die Finger um den Kiesel. Wai trat an den großen Stein, badete ihren Kiesel in einem der Schälchen. Da machte sie es Wai nach. In den Tränen der Göttin begann der Kiesel zu schimmern und rötlich zu leuchten. Die Kraft war in ihm.
Eine Weile hielt sie ihn noch in der Hand, dann verbarg sie ihn wie Wai in ihrer Gürteltasche. Nun war Wais Göttin immer bei ihr.
Sie sahen sich an. »Jetzt müssen wir mit unserer Spucke das Zeichen der Göttin auf den großen Stein malen, Blut wäre besser, aber Spucke geht auch«, flüsterte Wai, spuckte auf ihren Finger und malte ein offenes Dreieck auf den Fels. »Jetzt du!«
Sie gehorchte, zeichnete das Dreieck. Dann zog sie die Hand zurück, als hätte sie sich verbrannt. In stiller Übereinkunft machten sie einen tiefen Kniefall vor dem Stein, fassten sich wieder an den Händen und liefen zurück.
Auf dem ganzen Heimweg sprachen sie kein Wort, trennten sich am Wäldchen mit einer stummen Umarmung. Als sie endlich allein den Hof ihres Vaters erreichte, war es längst Nachmittag.
»Moria, wo warst du?« Die Mutter rannte ihr entgegen, kniete vor ihr nieder, schloss sie in die Arme. »Was hast du gemacht, ich habe solche Angst um dich gehabt, ich bin so glücklich, dass du wieder da bist, du kannst doch nicht einfach weglaufen, den ganzen Tag wegbleiben, und ich weiß nicht, wo du bist, wir haben dich überall gesucht, tu das nie wieder, hörst du, nie wieder, ich bin fast gestorben vor Angst um dich!« Die Mutter weinte und lachte in einem, drückte sie, schüttelte sie, küsste sie.
Da erst wurde ihr klar, wie lange sie weg gewesen war, was sie getan hatte.
»Moria!« Das war die Stimme des Vaters.
Die Mutter ließ sie los, erhob sich, trat einen Schritt zurück. Moria drehte sich um, er stand vor ihr. Er war so groß. »Wo warst du?«
Sie ertrug seinen scharfen Blick nicht, schlug die Augen nieder, er fasste sie am Kinn, hob ihren Kopf: »Sieh mich an!« Etwas schnürte ihr den Hals zu.
»Antworte!«
Sie schwieg. Meine Zunge soll mir abfallen.
Verzweifelt suchte sie nach einer Ausrede, Cythia, was soll ich tun, Großmutter, warum bist du nicht mehr da, kein klarer Gedanke in ihrem Kopf, nur das Dröhnen ihres Herzens, zu spät, er wusste, dass sie ihm nicht sagen wollte, was sie getan hatte, er wusste, dass es etwas Verbotenes gewesen war, etwas Schlimmes …
Seine Augen verengten sich. Die strengen Linien um seinen Mund traten hart hervor. Sie sah es, gelähmt vor Angst.
»Wie du willst.« Er packte sie am Handgelenk, drehte ihren Arm auf den Rücken, schob sie vor sich her über den Hof. An einer der Vorratsgruben hielt er an, rollte mit dem Fuß den schweren Stein weg, der den Deckel beschwerte, hob den Deckel mit der einen Hand ab, ohne sie mit der anderen loszulassen.
Dann steckte er sie in die Grube. »Dort bleibst du, bis du mir gestehst, wo du dich herumgetrieben hast!«
Er legte den Deckel auf. Unwillkürlich duckte sie sich, er drückte sie mit dem Schilfdeckel tiefer, schloss die Grube. Sie merkte, wie er den Stein daraufrollte. Da erst fing sie an zu schreien.
Sie schrie, bis ihr die Stimme wegblieb. Dann begann sie still zu weinen.
Dunkel war es in der Grube, nur schwach sickerte Tageslicht durch den Schilfdeckel und den winzigen Spalt, den er offen ließ. Die Luft wurde ihr knapp. Und es war so schrecklich eng: Sie konnte nicht stehen, ohne den Kopf einzuziehen. Sie konnte nicht sitzen, da ein großer Korb mit Moosbeeren die Hälfte des Platzes einnahm. Erst nach vielen Verrenkungen fand sie eine Stellung, in der sie in der Grube kauern konnte. Der Vater – er durfte es nicht erfahren – meine Zunge soll mir abfallen –
Der Deckel wurde geöffnet. Sie blinzelte ins Abendlicht: der Vater. Er sagte nur ein einziges Wort: »Nun?« Sie schüttelte stumm den Kopf. Wieder schloss sich der Deckel.
»Cythia«, wimmerte sie leise, »was soll ich nur tun? Ach, Großmutter, warum bist du nicht mehr da?«
Ihre Beine prickelten, verkrampften sich, schmerzten unerträglich. Unruhig ruckte sie umher. Ihre Gürteltasche drückte. Der Kiesel …
Sie holte ihn aus der Tasche, schloss die Finger um ihn. Glatt und kühl lag er in ihrer Hand. Die kleine Vertiefung an der Seite schien dafür geschaffen, die Kuppe ihres Zeigefingers zu bergen. Sie streichelte mit dem Daumen über den Stein. Eine wundersame Ruhe entströmte ihm, drang durch ihre Finger, ihren Arm, drang bis in ihr Herz. Die Kraft der Göttin. Sie schloss die Augen, atmete tief. Da öffneten sich die Wände der Grube, und sie war frei.
Das Moor lag vor ihr. Sanft strich der Wind durch das Wollgras. Nebel lagen über dem Ried. Zwischen den Krüppelkiefern schimmerten rot die reifen Moosbeeren. Sie gelangte zu ihnen, ohne den Boden zu berühren. Sie bückte sich zu den Beeren, sog ihren säuerlichen Duft ein, pflückte sie, aß.
Endlich wollte sie zurück in den Wald. Sie sah sich um: Moor, schwankender Boden, braune Tümpel. Sie wagte keinen Schritt zu machen, fürchtete, in jedem Augenblick zu versinken. Da strich sie über den Stein in ihrer Hand.
»Hilf mir!«, flüsterte sie.
»Du hast mich gerufen?« Eine Gestalt kam über das Moor auf sie zu, in weit wallende schwarze Tücher gehüllt, ein dunkles, altes Gesicht. Die Großmutter? Nein, doch nicht. Fremd, aber auch irgendwie vertraut.
Die Worte kamen von selbst über ihre Lippen: »Ich brauche deine Hilfe!«
»Ich weiß!« Eine kühle Hand fasste nach der ihren. Sicher wurde sie über das Moor geleitet.
»Moria!« Der Vater war über ihr, hob sie aus der Grube, stellte sie auf die Füße. Sie schwankte. Jeder Muskel, jedes Gelenk schmerzte. In ihrer Hand verborgen der Stein.
Die Abenddämmerung war hereingebrochen. Sie konnte sein Gesicht kaum sehen. »Was hast du mir zu sagen?«
Dieser Satz, immer der gleiche Satz. Sie umklammerte den Stein. »Ich wollte Moosbeeren pflücken«, sagte sie heiser. »Ich weiß, ich darf nicht zum Moor. Aber – ich war dort. Und dann wusste ich nicht mehr, wie ich zurückkommen sollte.«
»Im Moor?«, wiederholte der Vater. »Moria, es ist so tief, dass ein Kind darin versinken kann! Dein Ungehorsam hätte dich das Leben kosten können!«
»Ja, Herr.«
»Und wie bist du herausgekommen?«
»Eine alte Frau. Sie ist gekommen und hat mich an Land geführt.«
»Wer war sie?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe sie nicht gekannt.«
»Nun, wer auch immer, sie hat dich gerettet, das ist dir hoffentlich klar!«
»Ja, Herr.«
»Und weil du mein Verbot übertreten hattest und Strafe fürchtetest, wolltest du es mir nicht sagen«, stellte er fest.
Sie senkte den Kopf.
»Du hättest dir die Grube ersparen können, wenn du es mir sofort gestanden hättest!«
»Ja, Herr. Es tut mir leid.«
»Ist das alles?« Nun war es soweit. Unausweichlich. Unabänderlich. Gegen das, was jetzt kam, konnte auch der Stein ihr nicht helfen.
»Ich warte!«, sagte er scharf.
»Ich war Euch ungehorsam, Vater«, presste sie hervor. »Ich habe Schläge verdient.«
»Allerdings! Du wirst sie erhalten – morgen! Und bis zur Wintersonnenwende wirst du den Hof nicht mehr verlassen!«
»Ja, Herr!« Ein letzter strenger Blick, dann ließ er sie stehen und ging den Gästen entgegen, die eben am Hoftor erschienen.
Moria ließ die Hacke sinken. Nicht auszudenken, wenn der Vater damals die Wahrheit erfahren hätte. Was war dagegen ein flüchtiges Zeichen, das Agala in den Boden geritzt hatte! Sie selbst hatte es seinerzeit nicht mehr gewagt, dem Vater noch einmal so zuwiderzuhandeln. Sie war nicht noch einmal bei dem großen Stein im Wald gewesen und hatte sich mit Wai nicht mehr getroffen.
Nur den Kiesel, den hatte sie noch länger in ihrer Gürteltasche getragen, bis zu dem Tag, von dem an alles anders geworden war, dem Tag, an dem Cythia –
Ich habe ihr die Zöpfe geflochten. Ich bin schuld.
Moria packte die Hacke und hämmerte damit auf den Boden ein. Konnte sie es denn nie vergessen? Ihr ganzes Leben war eine heimliche Buße seither. Aber diese Schuld war nicht zu tilgen.
Das Baby, das die Nebenfrau dem Vater geboren hatte, schrie. Moria warf einen kurzen Blick in den Korb, in dem es auf sein festes Wickelkissen geschnürt lag, und prüfte, ob die Wickelbänder durchnässt waren oder stanken. Das Gesichtchen des Kindes war dunkelrot angelaufen und verzerrt. Aber ihm fehlte nichts. Erst am Abend musste es wieder gestillt werden. Erst am Abend durfte man es wieder kosen und mit ihm spielen.
Moria unterdrückte den Wunsch, das Kleine aus dem Korb zu nehmen und zu wiegen, damit es endlich aufhörte zu schreien. Die Mutter duldete nicht, dass ein Baby verzogen wurde. Um das Gebrüll nicht ganz so laut hören zu müssen, nahm Moria den Korb mit dem Baby und trug ihn nach nebenan in den Herrenraum, stellte ihn auf dem Bett der Eltern ab. Der Vater und Krugor feierten am Königshof, sodass die Frauen nun diesen Raum mitbenutzen konnten. Die Verbindungstür ließ sie vorsichtshalber offen.
Seufzend kehrte Moria an den Webstuhl zurück und webte pflichtschuldig weiter, drückte jede gewebte Reihe fest. Endlich schlief das Baby wieder ein. Die Ruhe war eine Wohltat.
Moria fuhr prüfend über den Rand des Webstücks. Er war gerade. Fast jedenfalls. Wenn man nicht allzu genau hinsah. Einen so feinen, weichen und doch dichten Wollstoff hatte sie noch nie gewebt. Gerne hätte sie ihn etwas lockerer gelassen, dann wäre es schneller gegangen. Aber da ließ die Mutter nicht mit sich reden. Schließlich war es der Stoff für Morias Brautkleid.
Sie lächelte. Würde er Lykos heißen, ihr Mann? Wieder sah sie sein Gesicht vor sich wie in dem kurzen Augenblick, als sie sich angesehen hatten. Und wieder schlug ihr Herz schneller, nur beim Gedanken daran.
Jede Einzelheit rief sie sich ins Gedächtnis: den Schmuck aus den ungeheuerlichen Eberzähnen – was für ein mächtiger Krieger musste er sein, wenn er einen solchen Keiler getötet hatte! –, die rasche Bewegung, mit der er den Mantel zugezogen hatte, damit sie nicht die blutigen Spuren seines letzten Kampfes sah – was für eine Feinfühligkeit! –, die achtungsvolle Art, wie er ihretwegen seinen Gefährten die rohen Reden verboten hatte – sie wusste es, obwohl sie nichts verstanden hatte, aber es waren meist rohe Reden, die Wolfskrieger untereinander führten, und selten machten sie sich die Mühe, dabei auf die sie bedienenden Mädchen zu achten …
Sie nickte. Ja, das alles zusammengenommen konnte nur eines bedeuten: Er war ein Held und dennoch war er nicht gefühllos wie ihr Bruder Krugor. Er liebte sie. Was für ein Glück, wenn er wirklich um sie warb! Nein, nicht er: der König für ihn. So viel Ehre für ein Mädchen wie sie! Wenn er nur keinen roten Mantel trüge! Unwillkürlich schauderte sie.
Sie runzelte die Stirn. Wie dumm sie war! Alle Wolfskrieger trugen rote Mäntel. Und wenn er sie heiratete, würde er bereits den schwarzen Mantel erworben haben.
Sie drehte sich zur Schwägerin um: »Hast du gehört, wie der Kriegszug ausgegangen ist?«
Agala hielt die Spindel an, wickelte den Faden auf. »Vermutlich ruhmvoll«, sagte sie. »Sonst hätte der König wohl nicht zum Fest geladen! Seit wann kümmern dich die Geschäfte der Männer?«
Einen Augenblick war Moria in Versuchung, Agala von Lykos zu erzählen, aber ehe sie den Mut dazu fand, wurde nebenan die Tür zum Hof aufgerissen und die kleinen Geschwister stürmten in den Herrenraum, schüttelten sich den Regen aus Haaren und Kleidern und rannten zur Ehrenbank, die dem Vater, Krugor und den Ehrengästen vorbehalten war.
Moria beobachtete die Kleinen. Wie sich das Leben veränderte, wenn der Vater und Krugor nicht zu Hause waren. Wie übermütig dann die Spiele der Kleinen wurden und Regeln in Vergessenheit gerieten, die sonst mit peinlicher Genauigkeit beachtet wurden. Fast war es, als würden auch die Vögel lauter singen.
»Ich täte der Vater sein!«, erklärte der kleine Amrox gewichtig, nahm einen Besen wie einen Stab in die Hand und setzte sich auf die Bank – eben die Bank, auf der nur der Vater, Krugor oder ehrenwerte Gäste sitzen durften. »Und ihr tätet die Bauern sein!«
Die kleinen Halbschwestern murrten etwas, gaben sich dann aber mit ihrer Rolle zufrieden und schleppten schwer an unsichtbaren Körben. Beide verbeugten sich tief. »Ich bringe Euch Gerste, Herr«, sagte die Größere. »Ich bringe auch Gerste«, ahmte die Kleinere nach.
Amrox warf sich in die Brust und stieß mit dem Besen auf den festgestampften Boden. »So wenig?«, fragte er streng.
»Wir haben nicht mehr, die Ernte war schlecht«, sagte die Größere und verbeugte sich wieder.
»Die Ernte war schlecht«, wiederholte die zweite.
Amrox fuhr mit spitzem Zeigefinger auf sie zu. »Und das soll ich glauben«, schrie er. »Muss ich euch bestrafen?«
Die Größere fiel auf die Knie. Die Kleinere, vom Spiel ernsthaft erschreckt, begann zu weinen. »Nicht, Herr«, jammerte die Größere, »ich bringe Euch alles, was ich habe!« Sie sprang auf, schleppte noch einen unsichtbaren Korb heran.
Amrox strahlte Zufriedenheit aus. »Na also!«
»Amrox, was fällt dir ein! Runter von der Bank! Raus aus dem Herrenraum!« Die Mutter stand in der Tür. »Wenn ich das dem Vater sage!«
Amrox sprang von der Bank, ließ den Besen fallen, schob die Unterlippe vor. »Das tust du nicht!«, bettelte er. Seine Unterlippe zitterte.
Die Mutter strich ihm über den Kopf. »Wenn du es nicht noch einmal machst!« Dann trat sie neben Moria, prüfte mit den Fingern den Stoff und seufzte: »Hier hast du schon wieder einen Fehler gemacht, Moria, hast du das nicht bemerkt? Es hilft alles nichts, das musst du noch einmal auftrennen! Und pass auf, dass der Rand endlich gerade wird! Du ziehst manchmal den Faden zu fest, siehst du, hier!«
Moria stöhnte. Die Mutter stützte das Kinn in die Hand. »Ich frage mich nur, in welcher Farbe wir die Borte wählen sollen. Vielleicht rot?«
»Nein, nicht rot!«, entfuhr es Moria.
Die Mutter wiegte den Kopf. »Vielleicht hast du recht. Vielleicht wäre ein zartes Lila kleidsamer, zurückhaltender. Für ein Brautkleid besser. Also lila?«
Moria stimmte zu und begann mit dem Auftrennen. »Fehlt nur noch der Bräutigam«, meinte die Mutter.
Moria spürte die Wärme im Gesicht. Die Mutter wusste es ja noch nicht.
Hufschlag wurde hörbar. Die Nebenfrau stürzte herein, gefolgt von der Magd: »Die Herren! Sie kehren schon zurück!«
Die Mutter fuhr herum, ihre Augen glitten durch den Herrenraum: »Wie sieht es hier aus! Räumt auf, rasch! Ich versuche sie etwas aufzuhalten! Macht das Feuer an und Wasser heiß! Mädchen, kämmt euch! Agala, das Bier!«
Amrox rannte in den Hof, um die Pferde in Empfang zu nehmen, Agala eilte zur Vorratsgrube, die Mutter griff zwei hohe Becher vom Wandbord und gab letzte Anweisungen, ehe sie das Haus verließ, um gemeinsam mit Agala die Männer mit einem Trunk willkommen zu heißen.
Die Nebenfrau nahm den Korb mit dem Baby, es wachte auf und schrie wieder, sie trug es im Korb in den dritten Raum des Hauses, zog die schwere Tür zu und schöpfte hastig Wasser in einen Kochtopf. Die Magd brachte zwischen zwei Holzstecken Glut vom Kochfeuer zur Herdstelle im Herrenraum und beeilte sich, ein Feuer zu entfachen. Moria aber räumte mit fliegenden Händen auf, zog die bunten Webdecken über den beiden Bettstellen zurecht, die Felle auf der Ehrenbank, fegte mit dem Arm die Kräuter, die zum Trocknen auf den niedrigen Tischen lagen, in ihren aufgehaltenen Rock, riss Kleidungsstücke von Haken und Stangen und warf sie in die Truhe – und wies neben allem die kleinen Halbschwestern an, Abfall und herumliegenden Kleinkram aufzusammeln und rasch die durcheinander geratenen Binsen zu richten, die den festgestampften Boden bedeckten.
Schon hörte man Stimmen. Hastig flohen sie alle nach nebenan und brachten ihre Kleidung und Haare in Ordnung. Da kam der Vater in den Herrenraum, hinter ihm her die Mutter. Er rief nach Moria. Noch einmal fuhr sie sich durch die offenen Haare, dann lief sie hinüber und knickste vor ihm.
Er nickte ihr zu. »Ich habe eine wichtige Nachricht für euch!« Halb sprach er zu ihr, halb zur Mutter. »Der König hat unserem Haus große Ehre erwiesen!« Er warf seinen nassen weißen Mantel auf den Boden und setzte sich auf die Bank.
Moria hob den Mantel auf und hängte ihn über eine Stange. Die Mutter reichte dem Vater Bier. Er trank, wischte sich den Mund und streckte sich. »Schön, wieder zu Hause zu sein!«
Moria schüttete warmes Wasser in die Schale, kniete bei dem Vater nieder und hielt ihm das Wasser zur Handwaschung. Sie merkte kaum, was sie tat. Der Vater trocknete die Hände, fasste leicht ihr Kinn. Sie kniete vor ihm, schlug nicht die Augen nieder wie sonst.
Er lächelte ihr zu. »Der König hat für seinen besten Krieger um deine Hand angehalten! Ich habe sie ihm zugesagt.«
»Der König!«, rief die Mutter aus. »Sein bester Krieger! O Moria, was für ein Glück! Du wirst …« Sie stockte, sagte rasch in verändertem Ton: »Welch verdienter Ruhm für dich, mein Rösos!«
Moria presste die Hände aufs Herz. Den Namen, Vater! Sag den Namen!
»Nun, in der Tat, es hat mich erfreut. Und der junge Mann hat alle Voraussetzungen, ein angesehener Herr zu werden. Er war der Anführer des letzten Kriegszuges und hat reiche Beute gemacht. Bei der Siegesfeier wurde von seinen Taten gesprochen und gesungen, und es war recht eindrucksvoll. Er hat Ehre, Tatkraft, Stärke und Mut, er verfügt über Weitblick, und er weiß sich Achtung und Gehorsam zu verschaffen. Mir scheint, er wird es weit bringen. Sein Name ist übrigens Lykos, Sohn des Nuerkop. Es heißt, Nuerkop wisse sich dem Tode nah. Wenn Lykos sein Erbe angetreten hat, wirst du Lykos‘ Frau, Moria! Vielleicht schon diesen Herbst!«
»Ja, Herr«, flüsterte sie. »Ich danke Euch.« Wie im Traum stand sie auf, ging zur Tür und trat hinaus.
»Moria, dein Vater hat dir nicht erlaubt zu gehen!«, rief die Mutter hinter ihr her. Doch der Vater sagte ruhig: »Lass sie! Ich habe Verständnis dafür, dass sie jetzt allein sein möchte!«
Moria blieb unter dem Vordach stehen, sah in den Regen hinaus und lehnte sich an die Wand. So schwach war ihr plötzlich, ihre Knie weich und nachgiebig, ihre Hände zittrig. Sie schloss die Augen.
Lykos. Er hatte gesiegt. Und er hatte Wort gehalten. Sie würde ihn lieben, ja, das würde sie. Sie tat es ja schon längst! Tränen rollten die Wangen hinab. Sie wischte sie ab: Warum weinte sie? Sie war doch glücklich, so glücklich.
Was hatte der Vater gesagt? Er hat Ehre, Tatkraft, Stärke und Mut. Er weiß sich Achtung und Gehorsam zu verschaffen.
Gut. Es würde eine Freude sein, ihm zu gehorchen. Mit ihm und ihr würde es anders sein als mit Krugor und Agala.
Göttin der Morgenröte, jungfräuliche Tochter des mächtigen Himmelsvaters, ich danke dir. Du hast meine Gebete erhört. Du hast dich für mich verwendet. Du hast mir den Bräutigam gewährt, den ich mir erhofft habe! Hilf, dass ich ihm immer gefalle! Dass ich ihm viele Söhne schenke! Dass er mich immer liebt!
»Moria, ich habe gehört, du wirst verheiratet!« Agalas leise Stimme neben ihr. Moria umarmte die Schwägerin.
Sie hielten einander. »Ich wünsche dir Glück, Moria! Möge dieser Lykos ein guter Herr und freundlicher Gebieter für dich sein«, sagte Agala in Morias Haar hinein. »Und ein rücksichtsvoller Mann!«
»O Agala!« Plötzlich weinte Moria. Agala streichelte ihr Haar, gab leise Laute des Trostes von sich.
Sicher dachte Agala, dass sie vor Angst weinte, sie musste es ihr sagen, aber es ging nicht, die Tränen flossen einfach, und es war schön, von Agala getröstet zu werden. Endlich trocknete sie die Tränen, rückte von der Schwägerin ab, lächelte ihr zu. »Danke, Agala. Ich bin so glücklich.«
Agala wandte ihr Gesicht ab, schwieg. Und dann sagte sie mit nüchterner Stimme: »Ein Gutes hat diese Heirat allemal: Du wirst nur einen Herrn haben und nicht zwei!«
Verblüfft starrte Moria ihre Schwägerin an, errötete. Es war wahr: Sie würde keinen Schwiegervater haben, und das war ein Glück. Aber es auszusprechen!
Die Mutter trat zu ihnen, holte Moria ins Haus. Die ganze Familie versammelte sich, der Vater gab die Neuigkeit allen bekannt und lobte dabei den Brautpreis, den er für Moria erhalten würde. Jeder beglückwünschte Moria, jeder drückte ihr die Hand.
Der Vater brachte dem Himmelsvater ein Dankopfer und gelobte für den Tag der Hochzeit die Opferung eines Stieres.
Die Mutter und Agala trugen allein das Abendmahl auf, ließen nicht zu, dass Moria wie sonst die Männer bediente, richteten dann auch das Essen der Frauen und Kinder im Nebenraum festlich aus und bewirteten Moria, als sei sie ein Ehrengast.
Zum ersten Mal in ihrem Leben stand sie im Mittelpunkt, einen ganzen Abend lang. Sie genoss jeden Augenblick davon.
Als sie sich zum Schlafen begaben, dankte sie dem Vater noch einmal. Er nickte wohlwollend. Und dann sagte er: »Übrigens, Nuerkops Hof, den Lykos übernehmen und in dem du leben wirst, liegt weit weg von hier. Aber in der Nachbarschaft von Hairox‘ Hof. Du wirst also Cythia wiedersehen!«
Morias Atem stockte. Mit offenem Mund stand sie vor ihrem Vater, starrte ihn an, merkte nicht, wie ungehörig das war. Hinter sich hörte sie einen erstickten Aufschrei: die Mutter.
Cythia. Ihre Schwester Cythia. Es war das erste Mal, dass der Vater den Namen der Schwester wieder in den Mund genommen hatte. Dass das Schweigen gebrochen wurde, welches seit damals jede Erinnerung an die Schwester bedeckte. Als habe die Aussicht auf Morias ehrenvolle Heirat das Schandmal von Cythia getilgt.
Plötzlich wurde Moria schlecht. Hastig stürzte sie aus dem Haus. Schwer atmend hielt sie sich am Pfosten fest und sog tief die kalte Luft ein. Lang stand sie noch im Regen, ehe sie wieder hineinging. Schwach und zitternd legte sie sich schließlich auf ihr Lager, zog die Decke fest um sich, fror dennoch.
Im Laufe der Jahre hatte sie viele Wege erprobt, vor dem Einschlafen der Erinnerung zu entfliehen: An etwas anderes denken, Gebete aufsagen, sich Bußen auferlegen – zum Beispiel sich am nächsten Tag zu erbieten, trotz der Kälte die Wäsche im Bach zu waschen oder die schlimme Aufgabe zu übernehmen, nach dem Brotbacken in den heißen Backofen zu kriechen und darin die Flachsbüschel zum Rösten aufzustellen – oder sich so fest in den Finger zu beißen, dass es schmerzte. Heute versagten sie alle.
»Es ist schrecklich heiß! Und diese Haare!« Cythia blies sich eine Strähne aus der erhitzten Stirn, fuhr sich mit der Hand in den Nacken, hob ihr schweres, offenes Haar für einen Augenblick in die Höhe, ließ es mit einem Seufzer wieder fallen. Sie, die kleine Moria, sah die große Schwester bewundernd an: unerreichbar erwachsen und unerreichbar schön.
»Lass mich deine Haare flechten, dann ist dir nicht mehr so heiß«, bat sie schüchtern.
»Flechten?! Wie einem Bauernmädchen?! Du weißt schon, dass das verboten ist?«
Sie spürte, wie ihr die Röte in den Kopf stieg.
Die Schwester lachte. »Du böse Kleine! Na los, worauf wartest du noch!« Cythia setzte sich auf einen Schemel, zwinkerte ihr zu.
»Wirklich?« Ihr Herz klopfte. Schnell holte sie einen beinernen Kamm vom Wandbord, begann die Haare zu kämmen und zu flechten.
»Du machst das gut«, sagte die Schwester erstaunt. »Woher kannst du das?«
»Als ich noch mit Wai gespielt habe, habe ich ihr manchmal die Haare geflochten und ihr Blumen in die Zöpfe gesteckt.«
Cythia warf ihr einen raschen Blick zu. »Seit Vater dich in die Grube gesteckt hat, traust du dich nicht mehr zu Wai, oder?«
»Deine Zöpfe sind fertig«, erwiderte sie.
Cythia legte ihr den Arm um die Schulter. »Weißt du was, Schwesterchen, wir beide gehen jetzt in den Wald, Heidelbeeren pflücken, wir zwei allein! Zieh dein ältestes Kleid an!«
Sie nickte nur. Aber die Freude glühte auf ihren Wangen. Cythia legte ihren Schmuck ab, zog sich ein altes, verwaschenes Kleid an, ließ es am Hals offen. Sie selbst machte der großen Schwester alles nach.
Die Mutter kam herein. »Wie siehst du denn aus, Cythia!«, rief sie entsetzt. »Zöpfe! Mach sie sofort wieder auf, du weißt, das gehört sich nicht!«
Cythia zuckte die Achseln: »So ist es nicht so heiß. Wir gehen in den Wald, Heidelbeeren pflücken. Da sieht uns ja keiner!«
Die Mutter schüttelte den Kopf. »Wenn das dein Vater merkt!«
»Wird er nicht! Komm, Kleine!«
Rasch, ehe die Mutter sie aufhalten konnte, nahmen sie ihre Körbe, rannten über den sonnengetränkten Hof, aus dem Tor, den glühenden Weg zum Wald. Als sie endlich unter die Bäume eintauchten, seufzten sie erleichtert auf.
»Puh!«, stöhnte Cythia. »Ruhen wir uns erst einmal aus!« Cythia legte sich in den tiefen Schatten einer Linde, zog den Rock höher, fächelte sich Luft zu. »Erzähl mir von Wai! Was habt ihr zusammen gespielt, außer Zöpfe flechten?«
»Oh, ich, wir haben uns im Wäldchen Höhlen gebaut, weißt du, so aus Zweigen und Gras, und dann saßen wir da drinnen und haben uns Geschichten erzählt, na ja, und manchmal sind wir auf Bäume geklettert …«
»Geklettert? Du kannst klettern? Richtig auf Bäume? Das glaube ich nicht!«
»Ich zeig‘ es dir!« Sie sprang auf, schätzte die Linde mit den Blicken ab, suchte nach Ästen und Auswüchsen und schon schwang sie sich auf den untersten Ast, stieg höher und höher, schaute nicht mehr nach unten, richtete alle Aufmerksamkeit aufs Klettern.
Da hörte sie unter sich einen Aufschrei.
Erst dachte sie, Cythia habe Angst um sie, und grinste. Doch dann wiederholte sich der Schrei, und ein Ton war in ihm, ein Ton …
Sie bog die Zweige auseinander, spähte hinunter, konnte Cythia nicht sehen, aber dort, Rot schimmerte durch das Blattwerk, wirbelte herum, Äste brachen, da war Cythia, Cythia rannte, Rot holte Cythia ein, Rot stieß Cythia zu Boden, Rot warf sich über Cythia. Und Cythia schrie.
Wie war sie selbst vom Baum gekommen? Aus dem Wald? Zum Hof? Der Vater legte eben seinem Hengst das Zaumzeug an. »Herr!« Sie keuchte. Das Blut hämmerte. Pferdehufe dröhnten in ihrem Kopf.
Er drehte sich heftig zu ihr um, Unwillen im Gesicht – einem Mädchen war es nicht erlaubt, seinen Vater anzusprechen –, doch plötzlich kniete er bei ihr nieder, fasste sie an den Armen, »Ruhig, Kind, ruhig«, sagte er eindringlich, »was ist geschehen, sag mir, was geschehen ist!«
Nur zwei Worte würgte sie hervor: »Cythia! Rot!«
Und er wurde blass. »Wo?«
Sie zeigte zum Wald. Sie zitterte. Mit wenigen Schritten war er im Haus, schon wieder heraußen, Bogen, Köcher und Streitaxt in der Hand, er hob sie aufs Pferd, schwang sich hinter sie, hielt sie fest, stieß die Fersen in die Flanken des Hengstes, preschte mit ihr los. »Zeig mir, wo Cythia ist!«
Sie ritten. Zum ersten Mal saß sie auf einem Pferd. Er fragte sie nach dem Weg, sie versuchte zu antworten, es ging nicht, kein Ton, kein Laut, nur ein verzweifeltes Würgen, mit stummen Gesten lenkte sie ihn zu der Linde.
Und dann sah sie Cythia. Vor dem Gebüsch lag die Schwester, nackt und merkwürdig zusammengekrümmt, warum war die Schwester so weiß, nur um den Hals, da war die Schwester rot, warum zitterte die Schwester, es war doch heiß, ihr Gesicht blutig, Nasenbluten, die Schwester hatte nie Nasenbluten, sie selbst schon oft, aber nicht Cythia, und die Haare: offen und zerwühlt, keine Zöpfe mehr, sie hatte ihr so schöne Zöpfe geflochten –
Der Vater zügelte den Hengst unmittelbar vor der am Boden liegenden Cythia, Cythia blickte nicht auf, schlug die Hand vors Gesicht, kroch auf das Gebüsch zu, rote Flecken auf der blassen Haut, der Hengst stieg auf die Hinterhand, hart fasste der Vater zu. Und der Vater wendete den Hengst, preschte weiter.
Cythia, wollte sie schreien, was ist mit Cythia, lass mich zu Cythia, helfen, ich muss ihr helfen. Kein Ton. Der Vater ritt. Weg von Cythia.
Dort auf dem Weg – Rot.
Ein Schrei. War sie es, die da schrie?
Rot fuhr herum. Ein Krieger.
Der Vater ließ sie los, fast wäre sie gestürzt, sie klammerte sich an die Mähne des Pferdes. Es blieb einige Schritte von dem Krieger entfernt stehen. Der Vater hatte den Bogen gehoben, den Pfeil auf der Sehne.
»Eine Bewegung, und du bist tot!« Kalt zerschnitt die Stimme des Vaters die Luft.
Der Krieger erstarrte. »Rösos!«, sagte er. »Ihr!«
»Ja, ich. Und du, Wolfskrieger, hast meine Tochter geschändet!«
»Eure Tochter geschändet? Ich verstehe nicht …«
Ein kurzer Ruck, der Bogen spannte sich. »Willst du behaupten, du wärst es nicht gewesen, der Mädchenschänder eben, hier unter der Linde?«
Der Krieger erbleichte, stieß hervor: »Aber, es war doch, ich dachte, es war nur ein Bauernmädchen … Eure Tochter? O ihr Himmlischen, wenn ich geahnt hätte! Rösos, bei der alles erspähenden Sonne, beim alles verzehrenden Feuer, bei des Himmelsvaters alles vernichtendem Donnerkeil, ich schwöre Euch: Ich glaubte, dass es ein Bauernmädchen war! Nie und nimmer hätte ich mich an Eurer Tochter vergriffen!«
Der Vater ließ den Bogen sinken. »Ich glaube dir. Aber das ändert nichts daran, dass meine Tochter geschändet ist!«
Der Krieger riss seinen Mantel auf, bot dem Vater die Brust. »Tötet mich, so habt Ihr Genugtuung!«
Cythia, was ist mit Cythia, ist mit Cythia, helfen, ich muss ihr doch helfen …
Wie ein Rad ging es in ihren Gedanken herum. Und dennoch hörte sie jedes Wort dieser Unterhaltung, hörte es und sollte es in den Tiefen ihrer Erinnerung vergraben:
»Genugtuung durch deinen Tod?«, fragte der Vater voller Verachtung. »Und was ist mit meinem Verlust? Wertlos wie weggeschüttetes Wasser hast du meine Tochter gemacht, und sie war doch einmal ein kostbarer Besitz! Eine Herde hätte ich als Brautpreis für sie bekommen! Ich will keine Rache, ich will Ersatz. Du wirst mir Recht widerfahren lassen, Wolfskrieger, das wird meine Genugtuung sein. Wie ist dein Name?«
»Ich bin Hairox, Sohn des Plicovit, und ich stehe zu Eurer Verfügung.«
»Nun denn! Da du meine Tochter geschändet hast, wirst du sie heiraten! So verlangt es der Brauch. Und du wirst mir zur Sühne den doppelten Brautpreis zahlen. Ich fordere achtzig Schafe, zwölf Kühe, vier Ochsen, drei Stuten und zwei Hengstfohlen. Und wenn du meine Forderungen nicht erfüllst, so ziehe ich dich vor den Rat der Weisen und vernichte dich und deinen Vater und deine ganze Sippe!« Damit wendete der Vater das Pferd.
Endlich ritt er zu Cythia. Cythia kauerte am Boden, hatte sich notdürftig mit ihrem zerfetzten Kleid bedeckt, hielt es mit gekreuzten Händen an der Brust zu. Der Vater sprang vom Pferd, riss Moria mit sich. Cythia wich vor ihm zurück. Der Vater nahm sich den Umhang von der Schulter und hielt ihn Moria hin: »Da! Leg deiner Schwester das um! Ich will ihre Schande nicht sehen!«
Moria zog sich die Decke über den Kopf, krümmte sich zusammen. Wenn sie so weit war, konnte sie auch der anderen Erinnerung nicht mehr entfliehen, sie wusste es. Verzweifelt versuchte sie dennoch, sich dagegen zu wehren und das Bild des Lykos vor ihren Augen zu beschwören. Zu spät.
Die Stimmen der Eltern im Nebenraum. Der Vater, erregt: »Dieser Wolfskrieger, dieser Hairox, er hat sich gerechtfertigt, er habe Cythia für ein Bauernmädchen gehalten. Warum?! Wie konnte so etwas geschehen?!«
Die Mutter, schluchzend: »Sie hatte ein altes Kleid an. Und sie hatte sich Zöpfe geflochten …«
Der Vater, brüllend: »Zöpfe? Und du hast das gewusst? Du hast das zugelassen?!«
Die Mutter, noch heftiger schluchzend: »Ich hab‘ es ihr noch verboten, das gehört sich nicht, habe ich gesagt, mach sofort die Zöpfe wieder auf, wenn dein Vater das sieht, hab‘ ich gesagt, aber sie ist einfach in den Wald gelaufen …«
Der Vater, kalt: »Dann ist es ihre eigene Schuld! Diese verfluchte Widerspenstigkeit! Und meine eigene Mutter hat ihr früher auch noch den Rücken gegen mich gestärkt! Was habe ich an Strenge gegenüber Cythia walten lassen, aber sie musste sich ja immer wieder auflehnen! Das hat sie nun davon. Zöpfe flechten!«
Die Zöpfe! An allem sind die Zöpfe schuld.
Ich war es. Ich, ich, ich. Ich habe ihr die Zöpfe geflochten. Ich bin schuld.