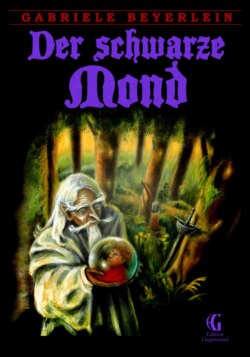Читать книгу Der schwarze Mond - Gabriele Beyerlein - Страница 5
3
ОглавлениеHeute ist der letzte echte Ferientag und ich wollte noch einmal so richtig ausschlafen. Aber jetzt liege ich hier rum und werde immer wacher.
Nur noch ein Ferientag. Dann kommt das Wochenende und dann muss ich in die Schule. In eine neue Schule, in der ich kein Aas kenne. Scheiße.
Wenn ich nur dran denke, wie alle grinsen, falls ich aus Versehen „Grüß Gott“ sage! Oder wenn sie an meiner Aussprache hören, dass ich aus Bayern komme.
Außerdem ist es eine Gesamtschule, die dreimal so groß ist wie das Gymnasium, auf das ich bisher gegangen bin.
Papa hat gestern Abend gemeint, ich soll froh sein, die neue Schule ist bestimmt leichter als meine alte. „Vielleicht wirst du jetzt sogar Klassenbester“, hat er gesagt und gelacht.
Der hat ja keine Ahnung.
In einer Gesamtschule sind furchtbar viele Schüler, glaube ich jedenfalls. Bestimmt auch solche wie die Großen, mit denen ich daheim im Schulbus fahren musste.
„Ich will überhaupt nicht Klassenbester werden, da hat man bei den anderen doch gleich verschissen!“, habe ich zu Papa gesagt. „Und ich will nicht in so eine blöde Gesamtschule mit lauter doofen Kerlen, die ich nicht kenne! Und neue Freunde, wie du behauptet hast, habe ich hier übrigens auch nicht gefunden!“
„Meine Güte, Jens“, hat er geantwortet und mich mit diesem Kopfschütteln angesehen, bei dem ich immer so ein flaues Gefühl im Magen kriege, „reiß dich zusammen, ich kann es nicht mehr hören! Bist du eine Junge oder ein Jammerlappen? Es gibt noch mehr Kinder, die umziehen und die Schule wechseln müssen, und die stellen sich auch nicht so an! Sprich ein paar Jungen an, die nett aussehen, und sag, dass du mitspielen willst, dann ist die Sache doch gelaufen!“
Ich bin aufgestanden und gegangen. Auf der Treppe habe ich gehört, wie Mama zu Papa gesagt hat: „Musste das jetzt sein mit deinen Machosprüchen? ‚Jammerlappen‘ – also wirklich! Der Umzug ist nicht leicht für ihn.“
„Weiß ich. Aber je eher er lernt, mit Schwierigkeiten fertigzuwerden, desto besser!“, hat Papa geantwortet. „Er ist viel zu ...“
Da habe ich meine Tür hinter mir zugezogen und bin ins Bett gegangen. Weil ich nicht hören wollte, was er sonst noch alles über mich sagt. Denken kann ich es mir sowieso. Ich glaube, manchmal wünscht sich Papa einen anderen Sohn als mich.
Einen zum Beispiel, der mit solchen Kerlen fertig wird wie mit diesen Großen an unserer Bushaltestelle. Die immer damit angegeben haben, wie viel sie wieder gesoffen haben, und die geraucht haben und mir den Rauch direkt ins Gesicht geblasen haben. Und die sich vorgedrängelt und mich nie vor sich in den Bus gelassen haben, sodass ich keinen Sitzplatz gekriegt habe, auch wenn ich viel eher da war als sie. Und die gesagt haben: „Was willst du hier, ey!“, wenn ich mich bei schlechtem Wetter ins Wartehäuschen stellen wollte, und dann auch noch gemein gelacht haben, wenn ich nass geregnet war, und verlangt haben, dass ich ihnen Geld gebe, damit sie sich Zigaretten aus dem Automaten ziehen können, und es mir natürlich nie zurückgegeben haben. Und mich, als ich kein Geld mehr hatte, in eine Pfütze gestoßen haben, dass ich reingefallen bin, und dann auch noch nachgetreten haben, bis ich geheult habe. Und dann gesagt haben: „Beim nächsten Mal gibt es mehr, Heulsuse!“
Ich habe es Papa erzählt und ihm gesagt, dass ich nicht mehr Schulbus fahren will. Da ist Papa am nächsten Morgen mit mir zur Bushaltestelle und hat die großen Jungen zur Rede gestellt, er allein gegen die alle. Ganz ruhig hat er sie angesehen und gesagt: „Ihr seid das also, die es nötig haben, Jüngere zu drangsalieren! Versucht euch doch zur Abwechslung mal an jemandem, der euch gewachsen ist! Wie wäre es zum Beispiel mit mir?“
Sie haben einfach nichts gesagt und versucht, coole Gesichter zu machen, aber so ganz gelungen ist ihnen das nicht. Da ist Papa ziemlich scharf geworden: „Wenn ich noch ein Mal höre, dass ihr die Kleineren abzockt oder fertig macht, dann setze ich mich im Sportheim mal zu euren Vätern an den Tisch und erzähle ihnen was über euch. Ich kann mir ganz gut vorstellen, was sie von Söhnen halten, die sich an Schwächeren austoben!“ Die Jungen haben ziemlich betreten geguckt, denn sie wussten, dass Papa ihre Väter kennt, vom Sportverein. Und dass er dort viel gilt. Papa war nämlich Vorsitzender vom Sportverein und hat in unserem Dorf einfach jeden gekannt.
Am Abend habe ich ihm gesagt, dass mich die Großen im Bus haben hinsetzen lassen, und mich bei ihm bedankt und er hat geantwortet: „Wozu hat man denn einen Vater!“ Doch dann hat er mich ganz nachdenklich angesehen und gesagt: „Aber weißt du, ich kann so was nicht immer für dich erledigen. Du musst lernen, dich selbst durchzusetzen. Solche Kerle, die es auf Schwächere abgesehen haben, hält man sich am besten vom Leib, indem man keine Feigheit kennt. Selbstbewusstsein zeigt. Und niemals heult, auch nicht, wenn’s weh tut!“
Seither habe ich Papa nichts mehr davon erzählt, wenn es wieder mal welche auf mich abgesehen hatten.
Inzwischen bin ich hellwach. Aber zum Aufstehen habe ich trotzdem keine Lust. Also denke ich mir eine Geschichte aus: Wie ich mit Papa ganz allein eine unbekannte Höhle erforsche und er mich an einem Seil einen tiefen Schacht hinunterlässt und dann selber an dem Seil hinterherklettert, aber das Seil reißt und Papa stürzt ab und bricht sich das Bein und kann sich nicht mehr vom Fleck rühren, aber ich sage: „Keine Angst, Papa, ich hol dich hier raus!“ Und weil es unmöglich ist, ohne Seil den Schacht wieder hinaufzuklettern, erforsche ich die Höhle immer weiter und komme an einen unterirdischen Fluss, dem folge ich, aber dann wird es zu eng und ich muss im Wasser schwimmen und komme durch einen niedrigen Kanal, in dem ich tauchen muss und fast ertrinke, aber dann werde ich im Fluss aus der Höhle hinausgespült, draußen ist finstere Nacht und ich bin mitten im Wald, aber ich renne einfach immer den Fluss entlang, denn ich muss ja Papa retten, und endlich komme ich an ein Haus und klingle einen Mann heraus, der sehr wütend ist, weil ich ihn mitten in der Nacht wecke, aber ich laufe nicht weg und sage ihm, dass er die Polizei anrufen muss, und dann warte ich auf die Bergwacht und die Sanitäter und zeige ihnen die Höhle und die Stelle, wo Papa abgestürzt ist, und als sie ihn hochgezogen haben und er auf der Bahre liegt, nimmt er meine Hand und sagt: „Danke, mein Junge. Du hast mir das Leben gerettet“, und ich sage: „War doch klar!“
Was ist das eigentlich für ein Krach da draußen? Ein Hubschrauber? Es hört sich fast an, als stehe er über unserem Haus.
Ich räkle mich noch einmal, dann quäle ich mich aus dem Bett und zieh Shorts und T-Shirt an. Hat ja doch keinen Zweck, noch länger liegenzubleiben.
Barfuß gehe ich in die Diele hinunter. Unten sitzen Mama und Papa am Frühstückstisch. Jeder hat einen der Zwillinge auf dem Schoß.
„Du bist schon auf?“, fragt Mama und schaut mich groß an.
„Wie soll man denn schlafen bei so einem Krach!“, antworte ich, nehme mir einen Becher aus dem Schrank und schenke mir Milch ein. „Haben wir jetzt einen privaten Flughafen, oder was?“
Papa schüttelt den Kopf: „Leider ist das Ganze gar nicht lustig. Das mit dem Hubschrauber ist die Polizei, sie sucht nach drei vermissten Jungen. Ich hab es vorhin beim Bäcker gehört und im Radio kam es auch schon. Die Jungen sind seit gestern Mittag vermisst, erst haben ihre Eltern das nicht weiter ernst genommen, jeder hat gedacht, sie wären bei dem andern, aber als sie nun nachts nicht nach Hause gekommen sind ...“
„Die armen Eltern“, meint Mama. „Ich würde wahnsinnig vor Angst. Obwohl es ja wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Drei Jungen auf einmal! Ich glaube nicht, dass drei Jungen gemeinsam etwas zugestoßen ist. Das Ganze ist bestimmt bloß ein Dummejungenstreich, vielleicht haben sie im Wald übernachtet und in ein, zwei Stunden stehen sie vor ihren Haustüren und können die ganze Aufregung gar nicht verstehen.“
„Jens, dass du dir nie einfallen lässt, über Nacht einfach wegzubleiben, ohne uns Bescheid zu geben!“, droht Papa.
„Ich bin doch nicht blöd“, murmle ich. Obwohl, zu gönnen wäre es ihnen schon, dass sie sich mal so richtig Sorgen um mich machen würden ...
„Übrigens sind die drei gestern Vormittag auf dem Flohmarkt zum letzten Mal gesehen worden. Vielleicht hast du sie ja auch bemerkt, Jens?“, fragt Mama. „Du hast uns doch erzählt, dass du dort deine Lego-Eisenbahn verkauft hast!“
Drei Jungen auf dem Flohmarkt? Plötzlich klopft mein Herz. Trotzdem zucke ich bloß die Achseln. „Und wenn schon. Ich wüsste es ja gar nicht, wenn es so wäre.“
„Sie sind zwischen zwölf und dreizehn Jahren alt“, sagt Papa. „Und einer von ihnen, der übrigens hier in der Straße wohnt, hat eine Narbe im Gesicht. Eine Klassenkameradin hat beobachtet, wie sie auf dem Rathausplatz bei einem alten Mann irgendwelchen Krempel gekauft haben. Danach wurden sie von niemandem mehr gesehen. Die Polizei sucht jetzt nach dem Mann, aber es scheint, dass keiner ihn kennt. Himmel! Meine Straßenbahn!“ Er springt auf, drückt Mama Anne auf den Schoß, nimmt seine Aktentasche, ruft im Rausgehen: „Übrigens, Jens, heute Abend toben wir beide uns mal mit den Rädern aus, zur Burg hoch, ja?“, und weg ist er.
Ich starre ihm nach.
Nicht wegen dem Fahrradfahren auf die Burg. Das ist okay, auch wenn der Burgberg ganz schön steil ist, aber mit meinem Mountainbike schaffe ich das schon, Papa und ich unternehmen öfter solche Sachen, und das finde ich echt cool. Doch daran zu denken habe ich jetzt keine Zeit.
Die drei Jungen -
Ich weiß, wo sie hingefahren sind, nach dem Flohmarkt. Vielleicht war ich der Letzte, der ...
Soll ich zur Polizei gehen?
Aber der Brunnen war bestimmt das Geheimnis der Jungen, und wenn sie nun in Wirklichkeit gar nicht in Gefahr sind, wenn die drei nur ein Abenteuer erleben in ihrem Rollenspiel und es gerade ganz spannend ist, und dann kommt die Polizei und scheucht sie aus dem Brunnen, und ich bin schuld daran -
Dann kann ich es vergessen, dass ich jemals mit ihnen mitspielen kann.
Ob ich Mama frage?
Da klingelt das Telefon. Ich gehe hin. Es ist Karin, Mamas Freundin von daheim. Ich gebe Mama den Hörer. Wenn Mama mit Karin telefoniert, dauert es ewig. Ich kenn das.
„Ich geh mal kurz weg!“, sage ich. Mama nickt und winkt mir zu. „Stell dir vor, was hier in der Nachbarschaft passiert ist“, erzählt sie Karin. „Drei Jungen sind über Nacht ...“
Ich ziehe die Tür hinter mir zu. Ehe ich etwas unternehme, muss ich wissen, ob die drei noch in dem Brunnen sind. Ob sie vielleicht gar nicht gefunden werden wollen.
Ich nehme mein Fahrrad und radle den Weg durch den Wald zum Brunnen. Der Hubschrauber hat inzwischen abgedreht. Ein Stück vor der alten Mauer steige ich vom Rad und lehne es an einen Baum. Stimmen höre ich nicht. Ich schlage die Zweige zurück und spähe durchs Gebüsch. Tatsächlich, dort liegen drei Fahrräder. Vorsichtig nähere ich mich dem Brunnen. Schaue über die Mauer.
Es geht ein paar Meter hinunter. Unten ist es duster. Aber nicht zu duster, um nicht erkennen zu können, dass sich hier kein Mensch aufhält. Schon gar nicht drei Jungen.
Aber – liegt dort nicht etwas am Boden und glänzt?
Ich gehe um die Mauer herum bis zum Eingang in den Brunnenschacht, steige die alte Steintreppe hinunter.
Plötzlich schaudere ich zusammen.
Ich sollte umkehren und zur Polizei gehen. Oder Mama alles erzählen. Oder Papa anrufen in seinem Büro.
Aber erst muss ich wissen, was da glänzt.
Am Fuß des Brunnenschachtes entspringt die Quelle. Nur ein ganz kleines Bächlein, das aus einem steinernen Löwenkopf rinnt, ein paar Schritte den Schacht durchfließt und durch ein Loch auf der gegenüberliegenden Seite wieder verschwindet. Vielleicht war es nur das Wasser, was ich von oben glitzern gesehen habe?
Nein, da ist etwas: eine Kugel aus Glas. Ich bücke mich und hebe sie auf, drehe und wende sie in meinen Händen. Ich kenne sie. Es ist die Kugel, die der alte Mann den Jungen geschenkt hat für ihren „Magier“.
Sie sieht aus wie eine große Christbaumkugel ohne Aufhänger. Man braucht schon eine Menge Phantasie, um sie für eine magische Kugel zu halten. Aber hier unten im Dustern ...
Noch einmal drehe ich sie hin und her und sehe, wie das schwache Tageslicht, das durch das Blätterdach in den Schacht fällt, sich darin spiegelt. Ich reibe sie ab, bis sie ganz sauber ist. Da, plötzlich –
Ist mir schlecht!
Und schwarz wird mir vor Augen, ich kann gar nichts mehr sehen, ich schwanke, fall auf die Knie –
So kotzübel war mir noch nie in meinem Leben. Ich knie da, die Hände vor dem Gesicht, und hoffe nur, dass es vorübergeht.
Es geht vorüber. Puh. Als wäre nichts gewesen.
Da merke ich, dass ich nass bin. Mehr noch, dass ich im Wasser knie. Ich nehme die Hände herunter.
Die Quelle! Sie war doch eben noch nur ein kleines Rinnsal, ein Bächlein, das durch das Loch im Brunnenschacht davonfloss, und nun steht mir das Wasser bis zu den Hüften.
Vielleicht war das gerade ein Erdbeben und jetzt fließt plötzlich viel mehr Wasser aus der Quelle und ich muss aufpassen, dass ich nicht ertrinke. Schnell die Stufen rauf, aus dem Brunnen raus! Ich nehme immer zwei Stufen auf einmal, komme oben an und –
Mein Fahrrad ist weg. Und nicht nur das. Alles kommt mir plötzlich ganz anders vor. Der Wald viel dunkler und dichter. Und der Weg nicht mehr geteert, sondern nur ein schmaler Pfad, der von Pferden zertrampelt ist.
Es ist, als würden lauter Ameisen auf meiner Haut krabbeln, auf dem Rücken, den Beinen, überall. Und auch in meinem Bauch.
Es kann nicht sein.
Ich renne los. Bis zum Ort und unserem Haus ist es nicht weit, keine zehn Minuten. Wenn nicht -
Ich renne und komme außer Atem und renne immer weiter. Ich müsste längst am Ortsanfang sein und das Schwimmbad sehen. Aber da kommt kein Ort und kein Schwimmbad. Hier ist einfach nur Wald.
Wenn jetzt Papa da wäre. Der würde nicht durchdrehen. Der würde sagen: „Es gibt immer einen Ausweg.“ Mit dieser festen, gelassenen Stimme, die er hat, wenn es brenzlig wird.
Bestimmt bin ich vom Brunnen aus in die verkehrte Richtung gelaufen. Wahrscheinlich war da eine Kreuzung, die ich nicht bemerkt hatte. Und ich habe einfach den falschen Weg erwischt.
Ich drehe um und laufe zurück. Meine Füße tun weh, ich habe ja keine Schuhe an, und immer wieder drücken Steine in meine nackten Fußsohlen.
Meine Güte, Jens, reiß dich zusammen! Bist du ein Junge oder ein Jammerlappen?
Auch wenn meine Füße gleich bluten, ich laufe weiter. Ich will den richtigen Weg finden. Ich muss.
Ich komme wieder am Brunnen an. Nein, hier gibt es keine Kreuzung. Hier führt nur dieser eine Weg vorbei, dieser Weg, der ganz anders aussieht als vorhin. Ich setze mich auf eine Treppenstufe und versuche nicht zu –
Ein Junge heult nicht, das ist sowieso das Allerletzte. Sagt Papa.
Ich beiße mir in den Knöchel meines Zeigefingers, bis es richtig weh tut. Dann renne ich wieder los. Diesmal in die andere Richtung.
Ich laufe immer weiter, bestimmt eine halbe Stunde, ich habe Seitenstechen, trotzdem geh ich nicht langsamer, ich darf nicht langsamer werden, sonst muss ich denken, und dann –
Der Wald wird immer dschungeliger. Bäume stehen da, die müssen bestimmt schon fünfhundert Jahre alt sein, so dick und knorrig sind sie. Umgestürzte Bäume liegen dazwischen, halb vermodert und von Moos und Pilzen überwuchert, Farne wachsen an sumpfigen Stellen, Flechten hängen von abgestorbenen Ästen.
Unheimlich ist das. So was gibt es nicht, heutzutage ...
Das Rennen hilft auch nicht mehr. Ich bin völlig fertig. Ich habe Seitenstechen und Blasen an den Füßen. Aber das ist nicht das Schlimmste.
Ich lasse mich zu Boden fallen. Heule doch. So was wie mir ist noch nie einem Menschen passiert.
Oder – die Jungen! Die verschwundenen Jungen, der mit der Narbe und der rothaarige und der dritte, der so viel gekichert hat. Denen muss das Gleiche passiert sein wie mir. Die waren auch in dem Brunnen, ich hab sie doch selbst hinuntersteigen sehen mit dem Schwert und der Mütze und der magischen Kugel –
Die magische Kugel.
Aber das sind nur Rollenspiel-Sachen, Zauber und so was gibt es nicht im wirklichen Leben!
Der alte Mann hat gesagt, man muss die Kugel reiben und drehen. Und genau das habe ich gemacht. Und die drei anderen haben es bestimmt auch ausprobiert. Ob sie hier sind? Vielleicht ganz in der Nähe?
Ich wische mir Rotz und Tränen ab und stehe auf. „Hallo! Ist da jemand?“, rufe ich. Und dann lege ich die Hände wie einen Trichter um den Mund und schreie: „Wo seid ihr?!“
Ich lausche. Kein Mensch antwortet. Doch direkt über mir höre ich ein lautes Krächzen. Ich hebe den Kopf und sehe einen großen schwarzen Vogel auf dem nächsten Baum. Nun fliegt er von seinem Ast auf den Weg, hüpft vor meinen Füßen herum, schlägt mit den Flügeln, krächzt immer wieder und sieht mich dabei die ganze Zeit an.
Ich weiß nicht, was für ein Vogel das ist, ein Rabe vielleicht, ich kenne mich mit Vögeln nicht so genau aus, aber dass ein Vogel so was normalerweise nicht tut, das weiß ich. Jetzt flattert er ein Stück den Weg weiter, dreht um und flattert wieder zu mir zurück. Hockt sich vor meine Füße. Krächzt, trippelt in die Richtung, in die er eben geflattert ist, schaut zurück.
Fast sieht es aus, als fordere er mich auf, ihm zu folgen.
Ich gehe ihm nach. Alles ist besser, als hier zu stehen und zu flennen. Der Vogel hüpft vor mir her, fliegt ein kurzes Stück, lässt sich gleich wieder auf dem Pfad nieder und dreht den Kopf nach mir um. Ich glaube wirklich, er will mich führen. Ich laufe schneller, immer hinter ihm her.
Tatsächlich – dort vorn mündet der Pfad in einen breiten Fahrweg. Auf einem Fahrweg findet man bestimmt aus dem Wald raus. Auch wenn ich dann noch immer nicht weiß, warum der Wald so anders ist, wo ich überhaupt bin und wie ich wieder nach Hause –
Darüber wollte ich doch nicht nachdenken!
Der Rabe trippelt auf dem Fahrweg nach rechts. Also gehe ich auch nach rechts.
Auch der breite Weg ist nicht geteert. Abdrücke von Hufen sind darauf zu sehen. Pferdeäpfel. Und tiefe Fahrrillen. Aber keine Reifenspuren. Eher sehen die Rillen so aus, als wären hier Schlitten langgezogen worden. Oder Kutschen mit eisenbeschlagenen Rädern.
Da sind sie wieder, die Ameisen. Diesmal unter der Haut.
Nochmal versuche ich zu rennen, mit letzter Kraft. Ich muss einfach.
Der Rabe fliegt ein Stück voraus, lässt sich dann auf einen Baum am Wegrand nieder und krächzt laut. Als ich ihn eingeholt habe, krächzt er noch einmal und fliegt vom Weg weg in den Wald hinein auf den nächsten Baum. Dorthin führt kein Weg. Auch kein Pfad.
Der Rabe hüpft auf seinem Ast herum. Keuchend bleibe ich stehen. Nein, in dieses Dickicht folge ich ihm nicht! Ich bleibe auf dem Fahrweg, bis ich aus dem Wald gefunden habe, das ist sicherer. Denn wenn ich den Weg erst einmal verloren habe und in dem Dickicht stecken bleibe und nie mehr –
Ich schleppe mich weiter. Hinter mir schreit der Rabe. Irgendwie fühle ich mich ohne ihn noch verlorener.
Plötzlich, wie aus dem Nichts, steht mir ein Schäferhund im Weg. Ein sehr magerer, seltsamer Schäferhund. Steht zum Sprung geduckt da, den Schwanz steif nach hinten gestreckt, und knurrt.
Ich bleibe stehen wie angewurzelt. Der Hund fletscht die Zähne. Diese riesigen Eckzähne –
Das ist kein Hund! Das ist ein Wolf!
Der Schweiß läuft an mir runter, ich kann keinen Muskel mehr rühren.
Ich glaube, es ist auch besser, keinen Muskel zu rühren. Ich hab nicht die geringste Ahnung von Wölfen, aber der da, der macht den Eindruck, als würde er mir an die Kehle springen, sobald ich nur einen Mucks von mir gebe. Bestimmt riechen Wölfe die Angst. So wie Hunde.
Die Zeit bleibt stehen. Der Wolf knurrt. Ich bin erstarrt. Dann, endlich, klappt der Wolf sein Maul zu, lässt seinen Schwanz baumeln und gibt sich harmlos.
Meine Muskeln sind so verkrampft, dass sie wehtun. Langsam stoße ich die Luft aus. Trete ein bisschen von einem Fuß auf den anderen, schüttle ganz leicht meine Arme, schau immer den Wolf dabei an. Die größte Gefahr scheint vorüber. Aber der Weiterweg ist mir gesperrt.
Rückwärts, Schrittchen für Schrittchen, ziehe ich mich vorsichtig zurück und lasse den Wolf dabei nicht aus den Augen. Er beobachtet mich. Verhält sich ruhig.
Meine Entfernung zu ihm wird immer größer. Endlich wage ich es, mich wieder umzudrehen und ganz normal zu gehen. Neben mir krächzt es. Mein Rabe sitzt immer noch auf dem gleichen Baum. Soll ich ihm vielleicht doch in das Dickicht folgen?
Hinter mir knurrt es. Da ist er wieder, der Wolf. Langsam kommt er näher, und näher. Er drängt mich vom Weg ab. Auf den Raben zu.
Es bleibt mir nichts anderes übrig, als diesem in den Dschungel zu folgen.