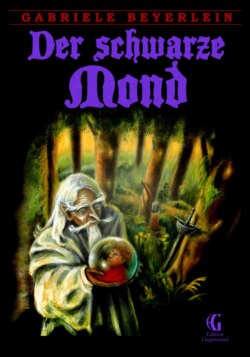Читать книгу Der schwarze Mond - Gabriele Beyerlein - Страница 9
7
ОглавлениеIch renne den Weg auf den Wald zu, renne wie noch nie in meinem Leben. Wenn der Medicus und der Herzog jetzt zurückkommen, die Sterne scheinen, kann man mich sehen? Gleich bin ich bei den Bäumen. In Sicherheit.
Was ist das?!
Mir wird angst, so entsetzlich angst. Ich merke, wie sich mir die Härchen am Nacken sträuben. Etwas Enges, Schweres schnürt mir die Brust ab. Ich kann nicht weiter. Muss umkehren. Nein. Ich darf nicht zurück. Nur noch ein paar Schritte!
Mit unendlicher Mühe hebe ich die Beine. Sie sind aus Blei. Ich kämpfe und laufe und kämpfe und laufe, warum bin ich nicht längst im Wald, es sind nur noch drei, vier Meter, ich quäle mich weiter, wieder ein Schritt und wieder und wieder –
Ich komme dem Wald nicht näher. Etwas hält mich fest.
Noch einmal hebe ich einen Fuß, schau dabei auf den Boden, zwinge mich, einen riesen Schritt zu machen, werfe mich mit aller Kraft vorwärts – und bleibe am gleichen Fleck. Ich falle ins Gras. Ich grabe meine Finger in die Erde. Ich trommle auf den Boden. Ich schmecke Blut.
Es kann nicht sein, kann nicht sein, kann nicht sein.
Ich zwinge mich, wieder aufzustehen, wieder auf den Wald zuzugehen. Wolken sind aufgezogen, die meisten Sterne sind verschwunden.
Da ist sie wieder, diese grauenhafte Angst. Die Schwere in den Beinen. Mit letzter Kraft renne ich. Renne auf der Stelle. Bleibe immer ein paar Schritte vom Waldrand entfernt.
Ich schreie.
„Ruhig, Knabe, ruhig!“, höre ich plötzlich eine Männerstimme. „Ganz ruhig! Tief atmen!“, befiehlt mir die Stimme. Sie ist fest und gelassen.
Auf einmal werde ich wirklich ruhig. Ich schaue mich um, sehe niemanden, es ist zu finster. Aber vom Waldrand her kommt die Stimme.
„Auf dir liegt ein Zauber des Medicus, um dich an der Flucht zu hindern. Es ist alles nur Trug und Schein! Wenn du ihm nicht unterliegst, kannst du dich befreien.“
„Wie soll ich das denn tun?“, flüstere ich. Nur ein heiseres Krächzen kommt aus meiner Kehle.
„Sei getrost! Ich werde dir meinen Beistand gewähren“, antwortet die Stimme.
Jemand tritt unter den Bäumen hervor, ich sehe nicht mehr als eine große Gestalt in der schwarzen Nacht. Dieser Jemand legt mir die Hände auf die Schultern. Etwas geht von diesen Händen aus, durchströmt meinen Kopf, meinen ganzen Körper mit Kraft und Zuversicht.
„Ahnst du im Dunkel den Baum vor dir?“, fragt die Stimme, und jetzt ist etwas anderes in ihr, etwas wie ein Sog. „Du wirst jetzt auf ihn zuschreiten und ihn berühren.“
Ich nicke. Mache einen Schritt. Noch einen. Immer weiter. Dann bin ich beim Baum. Fühle seine Rinde. Ich lehne meinen Kopf an seinen Stamm. Damit ich ganz sicher bin, dass ich es geschafft habe.
„Jetzt folge mir!“, befiehlt mir der Mann.
Nichts lieber als das! Ich stolpere hinter ihm her. Aber ich kann keinen Schritt weit sehen, stoße mir den Kopf an Ästen, laufe vor einen Baumstamm, stolpere über eine Wurzel und falle hin. Den Mann sehe ich nicht mehr. Da ist sie wieder, die Angst. „Helft mir, bitte!“, schreie ich.
Er ist da, sagt, ich soll auf seine Schultern steigen, und trägt mich.
Obwohl ich ganz schön schwer bin, läuft er rasch mit mir durch den Wald. Er muss so stark sein wie Papa.
Es ist stockfinster. Dennoch scheint er zu wissen, wo er geht. Ich ziehe den Kopf ein, damit ich mich nicht an den Ästen stoße, aber nie kommt mir ein Zweig zu nahe. Er scheint Augen zu haben wie eine Katze.
Wir gehen immer weiter vom Hof des Medicus weg. Und vom Herzog. Stundenlang. Das heißt, er geht. Ich werde getragen. Geschaukelt wie ein kleines Kind.
Früher, als ich klein war, hat Papa mich oft auf den Schultern getragen. Ich weiß noch, wie toll ich es fand, die Welt von so hoch oben zu betrachten.
Das erste schwache Morgengrauen dringt durch die Bäume. Ich schau mich um, versuche zu erkennen, wo wir sind, sehe keinen Weg, nichts als Wald. Dicht umgibt er uns, wie eine Wand. Der Mann aber, der mich trägt, schreitet ohne Zögern draufzu. Und die Äste teilen sich vor ihm, weichen auseinander, ehe er sie berührt. Mehr noch: Ganze Baumstämme neigen sich wenige Schritte vor ihm zur Seite.
Ich bekomme eine Gänsehaut. Kaum wage ich es, mich umzudrehen. Hinter uns richten sich die Bäume wieder auf, ohne zu schwanken. Etwas stimmt hier nicht.
Da fallen mir die weißen Haare des Mannes auf. Seine helle Haut. Und seine spitzen Ohren.
Er ist es! Und ich habe gedacht, ich wäre bei ihm in Sicherheit! Aber es ist Aribor, der Elf, der mich zur Höhle gelockt hat, der Elf, der die Jungen gefangen hält, der mein Herz -
Plötzlich geht alles ganz schnell. Ich beiße dem Elf ins Ohr, ich beiße, bis ich den Knorpel knacken spüre, er schreit auf und lässt meine Beine los, ich springe von seinem Rücken und renne, schlage Haken um die Bäume, doch da, er hat mich überholt, steht vor mir, ich weiche zurück, ein Graben, zu spät merke ich es, rücklings falle ich hinein. Und schon ist er über mir und setzt mir seinen Fuß auf die Brust.
„Ist das dein Dank für meine Hilfe?!“ Er drückt mich mit dem Fuß noch fester auf den Boden, ich bekomme kaum Luft.
„Bitte“, beginne ich zu keuchen, „bitte, lasst mich los, tut mir nichts, lasst mich laufen, bitte, nehmt nicht mein Herz ...“
„Dein Herz?“, wiederholt er und es klingt irgendwie angewidert.
„Nicht?“ frage ich. Auf einmal habe ich Hoffnung. Der Medicus hat mich doch die ganze Zeit angelogen – vielleicht hat er auch in dem gelogen, was er über Aribor und die Elfen gesagt hat? „Ihr seid, Ihr seid doch Aribor? Ein Elf?“, stottere ich herum.
„Welch außerordentliche Erkenntnis!“, erwidert er scharf. „Es ist Aribor, König der Elfen in höchsteigener Person, der sich deiner annahm und den du zu beißen wagtest! Wenn du mir dafür nicht mit einer triftigen Erklärung aufwarten kannst, wirst du erleben, wie ein König der Elfen zu strafen weiß! Also, Menschenjunges?“
„Bitte, bitte, es tut mir leid, ich wusste doch nicht, der Medicus hat doch gesagt, Ihr haltet die Jungen in der Höhle gefangen und ich sollte Euer nächstes Opfer sein, Ihr wolltet mir mein Herz rauben, Ihr benötigt immer Herzen von Jungen, damit Euere magischen Kräfte aufgefrischt werden, aber jetzt glaub ich das nicht mehr, der Medicus hat mir auch nicht gesagt, dass er ...“
„Beim silbernen Haar meiner Mutter! Welche Lügengespinste flüsterte dir der Medicus ein! Da nimmt mich nicht wunder, dass du vor mir die Flucht ergriffst und mir beinahe das Ohr abbissest!“
„Das tut mir wirklich leid. Verzeihung, bitte!“
„Unter diesen Umständen sei sie dir gewährt!“
Er hält seine rechte Hand über sein blutendes Ohr und als er sie wieder wegnimmt, blutet es nicht mehr, ja, man sieht nicht einmal mehr die kleinste Wunde. Dann zieht er seinen Fuß von meiner Brust zurück und macht mir ein Zeichen, aufzustehen. Auf einmal bin ich ganz sicher, dass kein Wort von dem stimmt, was der Medicus über die Elfen gesagt hat. Und dass mir von Aribor keine Gefahr droht. Ganz im Gegenteil.
Er erklärt: „Der Medicus ist ein Meister vieler schwarzer Künste und ein Meister des Luges und Truges. Und er steht mit all seiner Macht in den Diensten eines grausamen Herrschers. Es ist der Herzog, der die Knaben in der Höhle gefangen halten lässt, und der Medicus, der einen Bann um den Wald gelegt habe, damit kein Mensch die Höhle findet und die Knaben befreit!“
„Aber ich habe hingefunden!“
„Ja, du! Weil meine Tiere dich geleiteten. Es war mein Wille, dass du das Elend dieser Knaben mit eigenen Ohren vernimmst, mit eigenen Augen erblickst. Damit du begreifst, was es gilt. Denn nur unter deiner Mitwirkung kann verhindert werden, dass jahrein und jahraus unglückselige Kinder so leiden müssen!“
„Ich, wieso, wie soll ich ...“
„Du wirst es erfahren, wenn es an der Zeit ist!“
„Aber ich will das alles nicht, ich will heim, nach Hause! Meine Eltern warten auf mich und ich werde hier vor Angst fast wahnsinnig, alles ist so unheimlich und gefährlich, der Herzog will mich umbringen, was mache ich, wenn der Medicus mich wieder -“
„Schweige still! Wirst du nicht gewahr, wie du dich selbst erniedrigst mit deiner Winselei?! Ich jedenfalls beabsichtige nicht, sie mir anzuhören! Die Menschenkönigin erwartet dich.“
Er geht einfach los, und ich stapfe hinter ihm her.
Winselei! Als ob ich nicht Grund genug hätte, von hier wieder fort zu wollen! Aber es hätte keinen Sinn, wegzulaufen. In diesem Wald wäre ich rettungslos verloren. Ich muss tun, was der Elfenkönig von mir will. Was immer es ist.
Wir gehen durch das Dickicht, als sei da ein Pfad. Aribor läuft, fast ohne den Boden zu berühren. Ich habe Mühe, ihm zu folgen, obwohl es hell wird und ich besser sehen kann.
Aribor dreht sich nach mir um. Der erste Sonnenstrahl fällt ihm ins Gesicht. Er ist älter, als ich dachte. Für einen, der mich so lange durch den Wald getragen hat, ohne auch nur einmal zu keuchen, ganz schön alt.
Er sieht mich an. Er hat sehr helle, durchdringende Augen. Und einen Blick ...
Da, plötzlich, erkenne ich ihn: Er ist der Mann, der auf dem Flohmarkt die Rollenspielsachen verkauft hat! Er ist es, von dem die drei Jungen die magische Kugel geschenkt bekommen haben!
Jetzt wird mir so manches klar. Auch, dass nur er es ist, der mich wieder zurückbringen kann.
Plötzlich bleibt Aribor stehen, legt warnend den Finger an die Lippen und macht mit dem Kopf eine Bewegung in den Wald vor uns.
Leise schleichen wir weiter, das heißt, ich versuche zu schleichen, Aribor geht sowieso lautlos. Wie laut es knackt, wenn ich auf einen Zweig trete!
Schwach höre ich das Schnauben eines Pferdes. Das Knarren einer Tür. Und dann, unüberhörbar, einen lauten Schrei, der schlagartig abbricht.
Ein Schauer kriecht mir den Rücken hinunter. Es war ein Kind, das da geschrien hat. Schon wieder ein Kind.
Jetzt höre ich noch mehr Schreie, eine Frau, einen Mann -
Der Elfenkönig hat mich an der Hand gefasst und neben sich hinter einen Baum gezogen. Durch die Äste spähe ich hinaus auf eine kleine Lichtung. Mehrere seltsame kreisrunde Hügel stehen auf der Wiese und rauchen. Eine erbärmlich baufällige Hütte sehe ich daneben. Die Tür ist weit offen. Und da –
Ein Ritter kommt heraus, ein Ritter in einer schwarzen Rüstung, von Kopf bis Fuß in Eisen gepackt, mit zwei Schwertern und einer Axt bewaffnet, das Visier seines Helmes geschlossen. Unter den eisernen Arm geklemmt trägt er wie ein Paket ein Kind, einen Jungen, kleiner, als ich es bin.
Der Junge schreit und strampelt, der Ritter achtet nicht darauf, wehrt mit dem freien Arm einen Mann ab, der hinter ihm her aus der Tür rennt und mit einer schweren Holzstange auf ihn eindrischt, der Ritter holt aus und schlägt mit der Eisenfaust den Mann zu Boden. Der bleibt liegen und rührt sich nicht mehr. Aber jetzt stürzt eine Frau aus der Hütte und wirft sich dem Ritter in den Weg, wirft sich vor ihn auf den Boden, umklammert seine Beine, weint und fleht. Er stößt sie mit dem eisernen Fuß zur Seite.
Der Junge schreit.
Der Ritter stampft genau auf uns zu.
Ich kann den Jungen sehen, seine Nase blutet, seine Augen sind weit aufgerissen.
Unwillkürlich mache ich eine Bewegung auf ihn zu. Aribor hält mich zurück. Die eine Hand drückt er mir auf den Mund, mit der anderen packt er mich an der Schulter.
Aber die Augen hält er mir nicht zu.
Und ich sehe, wie der Ritter schwerfällig zu einem Pferd geht, das wenige Schritte von uns entfernt an einem Baum angebunden ist, wie er ein Seil vom Sattel nimmt, den Jungen mit dem Seil fesselt und ihn hinter dem Sattel auf das Pferd bindet. Der Junge schreit nach seiner Mutter. Da stopft ihm der Ritter ein Stück Stoff in den Mund. Dann geht er klirrend zu dem kleinen Stall neben der Hütte, tritt die Tür ein, zerrt eine Kuh heraus und zieht sie an ihrem Strick hinter sich her.
Die Mutter des Jungen hat sich inzwischen aufgerappelt, sie will dem Reiter den Weg versperren, aber der Ritter schlägt sie so, dass sie wieder zu Boden fällt. Dann bindet er die Kuh an seinen Sattel, steigt auf einen Baumstumpf, schwingt sich auf das Pferd, greift die Lanze, die an einen Baum gelehnt ist, und reitet in den Wald.
Die Frau kommt taumelnd in die Höhe, reißt sich an den Haaren, schluchzt laut und rennt ihm nach, stolpert, fällt hin. Sie richtet sich auf die Knie auf und schreit hinter ihm her: „Der Tag wird kommen! Die Zwillinge sind schon geboren!“ Dann bricht sie zusammen und weint nur noch.
Ich kann es nicht fassen. Vor meinen eigenen Augen wurde ein Kind entführt, eine Junge von sechs, sieben Jahren!
Aribor nimmt seine Hand von meinem Mund. Da brülle ich los: „Wieso habt Ihr nichts getan, warum habt Ihr dem Jungen nicht geholfen, da entführt einer ein Kind und schlägt dessen Eltern nieder, und Ihr, Ihr steht hier und schaut zu! Ihr könnt doch zaubern, warum zaubert Ihr jetzt nicht! Macht etwas, damit der Junge wieder frei wird!“
Er antwortet kühl: „Sieh an! Jetzt begehrst du, dass diesem Knaben des Köhlers geholfen wird! Solange du selbst nichts wagen musst, nicht wahr? Wer ergriff denn vor der Höhle die Flucht, als gingen die Hilfeschreie der Knaben ihn nichts an?!“
Ich kriege einen heißen Kopf. Ich muss etwas sagen. Aber ich weiß nicht, was.
Aribor sieht mich an, als könne er mir ins Innerste schauen. Mir wird immer heißer. „Nun schweigst du! Beschämt, wie ich hoffe. Wenigstens Trost hättest du ihnen spenden können, das wäre das Mindeste gewesen, nicht wahr? Ihnen versprechen, dass du Hilfe für sie holst. Es wäre Balsam gewesen für ihre geängstigten Seelen!“
Ich beiße die Zähne aufeinander. Und nicke. Er hat ja Recht.
„Jeder soll tun, was in seiner Macht steht“, sagt Aribor streng. „Auch die meine ist nicht unbegrenzt. Der Medicus ist ein mächtiger Gegner, dessen Zauberkünste in vielem meine Kräfte übersteigen. Hätte mich der Medicus sonst vor deinen Augen mit einem Kampfzauber niederstrecken können, sodass ich mich Stunden in Krämpfen winden musste?! Und gegen die Streitmacht schwarzer Krieger des Herzogs kann ich nichts ausrichten – mir stehen gerüstete Heerscharen ebenso wenig zu Gebote wie Kampfzauber. Wozu sollten sie auch dienen! Wir Elfen bekriegen einander nicht und mit Menschenhändeln haben wir nichts zu schaffen! Einmal mehr sehe ich wieder: Es bringt nichts als Unheil, sich mit Menschen einzulassen.“
„Aber“, ich schlucke, „aber warum habt Ihr dann mich geholt?“
„Weil ich die Not des armen Volkes und das Elend dieser Knaben nicht länger ansehen konnte. Und weil der Herzog den weißen Hirsch gejagt und getötet hat, meinen liebsten Gefährten. Da schwor ich dem Herzog Rache und verknüpfte meinen Racheplan mit der Rettung dieser Geschundenen. Was prophezeit ist, muss geschehen. Und es kann nur durch dich geschehen, denn du bist ein Teil der Prophezeiung. Begreifst du?“
„Nein, nicht so ganz.“
„Du wirst es begreifen müssen, denn nur wenn du getan hast, wozu ich dich herbeigerufen habe, werde ich dich wieder in deine Heimat entlassen!“ Damit dreht er sich um, geht über die Wiese zu der Hütte und beugt sich über den noch immer am Boden liegenden Mann.
Ich stehe sprachlos da. Wirklich ich soll es sein, der verhindern kann, dass eisenbepackte Ritter arme Jungen entführen und sie in einer finsteren Höhle einsperren? Ausgerechnet ich?
Schnell renne ich hinter dem Elfenkönig her. Er hat inzwischen dem Mann aufgeholfen, der aus einer Kopfwunde blutet, und führt ihn zu der Bank vor der Hütte. Dort hält er seine Hand über die Wunde, die sofort verheilt.
„Sagt mir, was ich machen soll!“, stoße ich hervor.
Er erwidert nichts als: „Folge mir zur Menschenkönigin!“
Wieder laufen wir durch den Wald.
Von welcher Prophezeiung ist hier dauernd die Rede? Und was hat sie mit mir zu tun? Wenn ich ein Held wäre wie Herkules. Und Kräfte hätte wie Superman. Aber so! Wo sogar mein eigener Vater manchmal findet, dass ich zu feige bin.
Wir erreichen eine große Lichtung. Die Morgensonne glitzert im Tau. Inmitten von Feldern steht ein winziges Dorf mit ein paar niedrigen strohgedeckten Häusern aus Holz oder Fachwerk. Sie sehen aus, als wollten sie im nächsten Augenblick aus Altersschwäche zusammenfallen. Ein paar Schweine, Hühner und halb nackte, kleine Kinder laufen herum, sonst ist niemand zu sehen.
Aribor zeigt auf das Dorf: „Gehe zum ersten Haus! Dort wird dir dein Weg gewiesen werden!“ Er legt mir kurz die Hände auf den Kopf und hängt mir eine Kette um, einen runden Stein mit einem Loch drin, durch das ein Lederband gezogen ist. Dann schiebt er mich von sich weg und verschwindet ohne ein weiteres Wort im Wald.