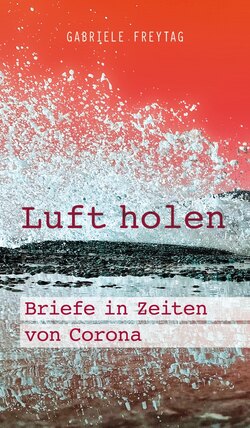Читать книгу Luft holen - Gabriele Freytag - Страница 7
ОглавлениеBetreff: täglich Post?
Liebe Alle,
Vor vier Wochen war ich noch in Lissabon am Tejo, Ihr seht mich oben vor der berühmten Brücke. Die Reise kommt mir jetzt vor wie eine rare und exquisite Köstlichkeit.
Durch meine engen Verbindungen nach Italien fühle ich mich grade der Entwicklung hier ein Stück voraus. Was auch dazu geführt hat, dass Sigrid und ich seit einigen Tagen bereits im Rückzug leben, wir nennen es Retreat.
In unserer Lebenssituation – sie in Rente, ich mit viel Schreiben und einer Praxis im Haus mit nur wenigen Patientinnen – ist das gut machbar.
Mich überkommt ein starkes Bedürfnis über die äußere und innere Lage zu schreiben. Vielleicht auszutauschen? Sehe eine Gruppe vor mir, die häufig kurze oder längere Texte per Mail bekommt.
Ich hänge mal meine ersten beiden Coronabriefe an. Weitere verschicke ich dann nur nach Aufforderung.
Würde mich sehr freuen Dich zu den AbonnentInnen zu zählen – und Auskunft über Dein Befinden zu erhalten.
Ganz herzlich und mit allerbesten Wünschen aus dem Retreat Gabriele
ZEITSCHLEIFE
16.3.2020
Heute hat es angefangen. Im Halbschlaf warte ich am Morgen das Rattern eines vorbeifahrenden Traktors zu hören oder die fürchterlichen Motorsägen aus dem Wald, wobei ich seit Tagen hoffe, für letztere wäre die Saison endlich vorbei. Als es dann ruhig bleibt bin ich verstört. Normalerweise ist mir Stille am liebsten – wenn andere sich nicht bemerkbar machen umso besser. Doch an diesem Montag soll die Woche unbedingt krachend losgehen, soll es möglichst geräuschvoll weiterlaufen und wir nicht feststecken, als würde von nun an das Wochenende täglich wiederkehren wie in einer Zeitschleife.
Man hatte es uns am Vorabend bei Anne Will noch einmal erklärt: Die große Hoffnung ist jetzt, durch einen partiellen Lock-Down die Kurve flach zu halten. Sigrid und ich waren erleichtert, dass wir in der Sendung nichts Neues erfuhren, uns also trotz physischer Isolation auf der Höhe der Zeit befanden. Im Gegensatz zu sonst blieben wir nach dem Tatort noch vor dem Bildschirm sitzen. Eine Teilnahme am sonntäglichen Talk-Show-Ritual schien uns geeignet, unsere aufgewühlten Gemüter zu beruhigen. Die Politiker (es waren nur Männer) kamen uns überraschend sympathisch vor. Bei der Intensivmedizinerin der Charité ging uns sofort das Herz auf: so engagiert und klug, ihr wollte man sich gerne anvertrauen. Wir suchten nach Zeichen. Alle Gäste wirkten müde auf uns, Gesichter und Augen machten einen traurigen Eindruck. Sie taten, das sah man doch, unter großer Belastung ihre Arbeit, versicherten wir uns. Der Finanzminister allerdings hustete oft und fasste sich noch öfter ins Gesicht. Man kam nicht umhin zu befürchten er könne demnächst erkranken.
Seit über fünfzehn Jahren genieße ich die Vorteile von zwei Wohnsitzen, zwei Häusern, zwei Freundeskreisen, zwei Landschaften und zwei Sprachen. In den letzten Wochen war mir, als trüge ich auch die Belastungen von zwei Ländern. Die Not Italiens geht mir nahe. Wenn ich auf twitter und facebook Fotos von unzureichend versorgten PatientInnen auf Krankenhausfluren, überfordertem medizinischen Personal und verzweifelten Angehörigen sehe hoffe ich immer noch, dass es so schlimm wie es wirkt nicht ist. In unserem auf Sicherheit und Risikoreduktion ausgerichteten westeuropäischen Denken sind solche Bilder nicht vorgesehen.
Seit einer Woche befinden sich die ItalienerInnen im Lock-Down. Die drastischen Ausgangsbeschränkungen wurden verordnet, weil man damit jetzt hofft, die rasante Ausbreitung des Virus und den Kollaps der Krankenhäuser noch eindämmen zu können. In Mails und am Telefon wähle ich sorgfältig meine Worte. Ich möchte meinen italienischen FreundInnen beistehen und ihren Schmerz teilen („Mi dispiace cosi tanto“). Ich möchte Hoffnung vermitteln, allerdings nicht zu platt („Wird schon“). Und auf keinen Fall will ich den Eindruck erwecken, dass in Deutschland alles besser bewältigt wird. Doch unweigerlich wird mir irgendwann die Frage gestellt „Und wie läuft es bei euch?“. Dann antworte ich schlingernd zwischen „Wir sind besorgt“ und „Noch ist nicht viel zu merken“ und fühle mich wie ein geretteter Passagier auf sicherem Grund, während andere Schiffbrüchige gegen die Wellen kämpfen. Auch sie werden, so beruhige ich mich, das rettende Ufer erreichen.
Sigrid und ich tauschen seit drei Tagen nur noch Viren untereinander aus. Gegen die Angst vor Ansteckung scheint uns das am besten. Sigrid war am Nachmittag noch ein letztes Mal auf dem Markt im Dorf gewesen. Die Menschen standen dicht wie immer in den Schlangen vor den Verkaufsständen. Am Morgen hatten wir noch eine Freundin zum Frühstück besucht. Das, so hatten wir beschlossen, waren unsere letzten Ausgänge. Ab jetzt würden wir die Biokiste aufstocken, unsere Vorräte aufbrauchen und Aktivitäten auf den Nahbereich beschränken.
Glücklicherweise leben wir in einem Naturschutzgebiet mitten im Wald mit dem See vor der Haustür und puzzeln beide gern alleine vor uns hin. Die ersten Knospen zeigen sich an den Bäumen, der Frühling, so versichern wir uns, wird den Gemütern helfen mit seiner verschwenderischen Fülle.
Auf dem beschaulichen Gut mit seinen ungefähr vierzig Bewohnerinnen sind die Bedingungen für Rückzug ideal. Wenn man sich zufällig trifft, was gar nicht selten geschieht, dann draußen auf dem Hof. Und da kann man sich nach wie vor sicher auf Distanz unterhalten. Mit Birgit, meiner Freundin und Nachbarin auf der Etage, war ich bereits dazu übergegangen, dass sie bei Gesprächen in ihrer Wohnungstür steht und ich drei Meter entfernt am Treppengeländer lehne.
In Birgits Schule war vor nicht einmal zwei Wochen der erste Corona-Fall im Landkreis bemerkt worden. Ein Kollege hatte das Virus auf nie geklärtem Wege mitgebracht und inzwischen andere Menschen in zweistelliger Zahl infiziert. Überraschenderweise war das Gymnasium nicht geschlossen worden. Das Gesundheitsamt erklärte, ein Infizierter begänne erst in den letzten beiden Tagen vor dem Ausbruch von Symptomen anstekkend zu werden. Da der Kollege die Symptome am Montag bemerkt hatte und am Freitagmorgen zum letzten Mal in der Schule gewesen war, konzentrierte man sich nur auf die Menschen, die er am Wochenende privat getroffen hatte. Sie alle wurden vom Gesundheitsamt kontaktiert, mussten in Quarantäne und werden bei Beschwerden getestet.
Weder Birgit noch ich noch sonst jemand, den wir kannten, hatten je von dieser Theorie gehört, auch im Netz fand man sie nicht. Doch alle Ansteckungen passierten wie vorausgesagt im Privatleben. Auf diesem Wege war auch M., eine enge Kollegin von Birgit, in Quarantäne geschickt worden. Wenn sie positiv getestet worden wäre, hätte Birgit zwei Wochen in ihrer Wohnung bleiben müssen. Ich versorge dich dann, beeilte ich mich zu sagen. Zwei Tage später fand ich einen Zettel vor der Tür „M. ist negativ“. Die Umsicht des Gesundheitsamtes wirkte beruhigend auf uns. Mir wurde klar, dass meine übliche Skepsis gegenüber dem schulmedizinisch orientierten Gesundheitswesen gerade Platz machte für Respekt und Vertrauen. Darüber war ich heilfroh. Alle mit denen ich sprach hatten den Eindruck, die Behörden reagierten prompt und behielten Infektionsketten gut im Blick. Allerdings wissen wir auch, dass die Dunkelziffer hoch ist und nur ein Bruchteil der Infizierten, nämlich die mit Symptomen, die sich zudem auch noch melden, getestet wird. Viele Menschen haben begonnen – meist mithilfe bunter Grafiken und Kurven – zu begreifen, was exponentielles Wachstum im Gegensatz zu linearem bedeutet.
Heute, zwei Wochen nach dem ersten Coronafall in unserer Nähe, sind bereits alle Schulen geschlossen, dazu Theater, Museen, Bibliotheken, Klubs und Grenzen. In Hamburg wurden auch private Zusammenkünfte von über 50 Menschen untersagt und von Treffen mit geringerer TeilnehmerInnenzahl wird abgeraten. Offensichtlich ist eine Verfolgung der Infektionsketten inzwischen nicht mehr ausreichend oder gar nicht mehr möglich. Social Distancing wurde zur besten Reaktion auf die Lage erklärt, flatten the curve ist jetzt unsere große Hoffnung.