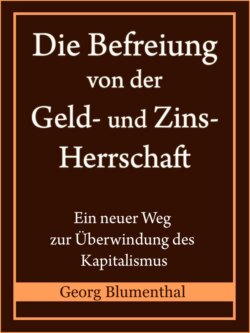Читать книгу Die Befreiung von der Geld- und Zinsherrschaft - Georg Blumenthal - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI. Die Ausnahmestellung des Geldes in der Volkswirtschaft.
ОглавлениеAlle Waren, Produkte und Arbeitsleistungen unterliegen naturgemäß einem Angebots-Zwange, also dem natürlichen Gesetze des Austausches, dem sie sich wohl gelegentlich auf kurze Zeit — nie aber dauernd entziehen können. Die Waren und alle sonstigen Produkte der menschlichen Arbeit verderben, veralten, bedürfen fortwährend allerlei weiterer Aufwendungen und müssen daher zur Vermeidung von Verlusten und Unkosten aller Art seitens ihrer Besitzer beständig dem Markt, dem Austausch gegen Geld, zur Verfügung gestellt werden. Ebenso muss jeder Arbeiter, gleichviel, ob er mit der Hand oder mit dem Gehirn arbeitet, seine Arbeitskraft und seine Leistungen täglich und stündlich anbieten; wer das nicht tut, erleidet einen entsprechenden Verlust.
Nicht so das Geld!
Das Geld besitzt, im Gegensatz zu allen anderen Gütern, mit denen es in Austausch zu treten, resp. deren Austausch es zu vermitteln hat, gewisse Vorzüge, die seinem volkswirtschaftlichen Umlauf und damit seinem Angebot geradezu entgegenwirken, hat man doch sogar versucht, durch Gesetz dem Gelde eine absolute Unveränderlichkeit zu verleihen, indem man einen immer gleichbleibenden Nennbetrag für jede Geldart festsetzte, und zwar beim Metall durch den Prägestempel, beim Papiergeld durch die lithographische Aufschrift.
Obwohl es nicht gelungen ist, vom Gelde alle Einflüsse des Marktes fernzuhalten, so ist es doch dem Zahn der Zeit z. B. völlig entrückt und hat auch sonst noch soviel Vorzüge, dass von einem volkswirtschaftlichen Angebotszwange beim Geld keine Rede sein kann.8 Es lässt sich selbst in großen Mengen leicht transportieren und aufbewahren, es verdirbt nicht, wird nicht unmodern, rostet nicht, braucht keine groben Lagerräume usw.
Der Kriegsschatz von 120 Millionen im Juliusturm bei Spandau blieb 40 Jahre unangetastet. Ein entsprechender Schatz in Weizen, Wolle oder Leder wäre längst in Müll zerfallen.
Außerdem behält das Geld auch eine immergleiche gesetzliche Zahlkraft (nicht zu verwechseln mit Kaufkraft), d. h., man kann jede eingegangene Verbindlichkeit (Schulden, Pacht, Miete, Gehalt, Wechsel, Hypotheken usw.), die z. B. laut schriftlicher Vereinbarung 1000 M. nominell beträgt, auch mit der nominellen Geldsumme (also mit 1000 Mark in Gold oder Papier) selbst nach langer Zeit „bezahlen“, was man mit einem entsprechenden Quantum aufgespeicherter Waren nicht könnte.
Schwankt also zwar die „Kaufkraft“ des Geldes den Waren gegenüber, so bleibt doch seine „Zahlkraft“ eingegangenen Verbindlichkeiten gegenüber „fest“, ein Umstand, der wohl zu der Selbsttäuschung einer tatsächlichen Währung geführt haben mag. In Wirklichkeit kann — wie bereits nachgewiesen wurde — sowohl für den Gläubiger als für den Schuldner, je nach der Marktlage ein Vorteil oder ein Nachteil dabei eintreten, trotz der nominell festgelegten gesetzlichen Zahlkraft des Geldes, weil ja die „Kaufkraft“, d. h., das Preisverhältnis des Geldes zur Ware oder umgekehrt — das der Waren zum Golde — durch diese gesetzliche „Zahlkraft“ gar nicht berührt wird.
Wenn man aber den Umstand, dass auch der Preis des Geldes im Hinblick auf die jeweils dafür erhältliche Warenmenge schwankt, zu dem Einwand benutzen will, dass das Geld demnach denselben Nachteilen ausgesetzt sei wie die Waren, so wäre dies durchaus unzutreffend. Die Waren unterliegen ja außerdem — wie bereits erwähnt — einem Zersetzungsprozess, der durchaus nicht schwankt, sondern ständig — bis zur völligen Auflösung der Ware — fortschreitet. Für diesen Zersetzungsprozess gibt es keinen Ausgleich; keinerlei Konjunkturmöglichkeit gibt dem Warenbesitzer eine Entschädigung für den Verlust, der ihm aus diesem Grunde beständig erwachsen und ihn zum Bettler machen würde, wenn er die Warenvorräte etwa ebenso dauernd vom Angebot zurückhalten wollte, wie dies mit ersparten Geldvorräten möglich ist.
Wer das Geld in der Hand hat, weiß immer, dass er damit jederzeit seinen Verbindlichkeiten in voller Höhe des nominellen Geldbetrages, der ihm zur Verfügung steht, nachkommen kann. Er ist gegenüber dem Warenbesitzer, der seine Waren erst zu Geld machen muss, und nicht weiß, wann und zu welchem Preise ihm dies gelingen wird, ganz entschieden im Vorteil. Geld ausgeben kann bekanntlich jeder Dummkopf, nicht aber Geld erwerben.
Obwohl also auch das Geld den Einflüssen des Marktes unterliegt und sein Preis schwankt, was auf einer Veränderung seiner Menge, seiner Umlaufsgeschwindigkeit, wie auch auf vermehrtem oder vermindertem Warenangebot beruhen kann, ist die Möglichkeit von Nachteilen und Verlusten jedoch für den Geldinhaber nie so groß, wie für den Warenbesitzer.
Die aus einer etwaigen „Entwertung“, d. h. aus einem Preisfall des Geldes hervorgehenden Verluste können nie bis zur gänzlichen Vernichtung des Besitzes führen, was bei den Waren sehr wohl möglich ist, denn ihnen haftet eben infolge ihrer stofflichen Beschaffenheit die Verderblichkeit, d. h. der natürliche Zersetzungsprozess an, der beim Gelde nicht in Frage kommt.
Ein besonders wichtiger Vorzug des Geldes liegt aber in seiner allgemeinen gesetzlichen und volkswirtschaftlichen Anerkennung als Tausch- und Zahlmittel, wodurch es — obwohl selbst ein Arbeitsprodukt, eine Ware — eben zu „Geld“ wird. —
Im Gegensatz zur gewöhnlichen Ware, kann man mit der Überware „Geld“ unmittelbar, also direkt, alle anderen Waren und Leistungen eintauschen (kaufen), also sowohl Bedürfnisse befriedigen, als auch Verpflichtungen damit erfüllen, was mit keiner anderen Ware oder Leistung möglich ist. Biete ich z. B. zwecks Befriedigung meiner Bedürfnisse unter Umgehung des Geldes eine Arbeitsleistung oder Ware an, so wird es die Regel sein, dass der Besitzer derjenigen Dinge, die ich gerade nötig gebrauche, seinerseits durchaus keinen augenblicklichen oder keinen so großen Bedarf an den von mir angebotenen Waren oder Leistungen hat. Biete ich jedoch Geld an, so weiß mein Partner, dass er sich damit jederzeit alles beschaffen kann, dessen er seinerseits bedarf und er wird mir seine eigenen Waren gern und willig überlassen.
Das Geld ist also, wie wir gesehen haben, eine Universal-Ware, und noch dazu eine solche von unbegrenzter Dauerhaftigkeit, für die es nie an Abnehmern fehlt, was zur Folge hat, dass es nicht über den unmittelbaren persönlichen Warenverbrauch seines Besitzers hinaus, angeboten zu werden braucht. Der natürliche Angebotszwang, dem die Waren unterliegen, weil man sie nicht beliebig lange aufspeichern kann, fehlt dem Gelde, und damit fehlt auch die volkswirtschaftliche Voraussetzung für einen glatten Austausch von Geld und Waren, also für das volkswirtschaftliche Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Auf diese Weise ist es erklärlich, dass das Angebot von Waren und Arbeitsleistungen immer stärker und dringender ist, als das Angebot von Geld.9
Mit unserem herkömmlichen Gelde, welches den Waren gegenüber infolge seiner Vorzüge mit einem erdrückenden Übergewicht ausgestattet ist, lässt sich weder eine gesicherte Währung noch ein dauerndes Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage erzielen; der dem Gelde fehlende Angebotszwang (also seine Vorzüge) verhindern es, sich über den persönlichen Bedarf hinaus mit der gleichen Dringlichkeit anzubieten, wie Ware und Arbeit es allezeit tun müssen.