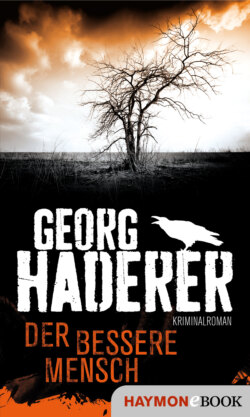Читать книгу Der bessere Mensch - Georg Haderer - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеEs war die Amsel, nicht der Wecker. Dennoch stand Schäfer gleich nach dem Erwachen auf – so konnte er den Tag mit einem langen Frühstück auf dem Balkon beginnen und in aller Ruhe mit Isabelle telefonieren. Er ging ins Bad, rasierte sich, duschte. Mit einem Handtuch um die Hüfte und der Zahnbürste im Mund stellte er sich auf die Waage. Drecksding, hämisches Mistvieh, fluchte er leise, putzte seine Zähne fertig und ging in die Küche, um aus den Einkäufen vom Vortag ein ausgiebiges Morgenmahl zu bereiten.
Nach einem Joghurt mit frischen Erdbeeren, einer Schinkensemmel, einer Marmeladesemmel und einem weichen Ei setzte er sich mit einer Tasse Tee in den Liegestuhl und nahm das Telefon zur Hand. Den Daumen schon auf der Kurzwahltaste, sah er die Zeit: nicht einmal halb sechs – das konnte er nicht bringen. Sah er eben dem glühend roten Sonnenball zu, wie der sich, unbeirrbar und ganz der souveräne Himmelsriese, der er war, über den Horizont schob und an die Arbeit machte. Nicht schlecht für dein Alter, grüßte Schäfer das Gestirn mit erhobener Teetasse, gab sich noch ein paar Minuten den Strahlen hin und holte dann seinen Laptop aus dem Wohnzimmer. Mal sehen, ob Borns Geist schon in der virtuellen Welt angekommen war. Nachdem Schäfer dessen vollen Namen in eine Suchmaschine eingegeben hatte, bestätigten die ersten beiden Ergebnisse seine Vermutung: Zwei Tageszeitungen brachten die Geschichte als großen Aufhänger auf der Startseite. Der Verräter ist immer der Gärtner, kam es Schäfer in den Sinn, als er sich durch die Bildergalerie klickte. Zuerst ein Porträt des Opfers, dann gleich ein Foto, das einen der Forensiker beim Verlassen der Villa zeigte – um die Gasmaske in seiner linken Hand hatten die Bildbearbeiter einen roten Kreis gezogen. Dass Born vielleicht ganz unspektakulär seinen Kopf in den Gasherd gesteckt haben könnte, kam in den Mutmaßungen des Reporters nicht vor. Hier wurde gleich über Viren und biochemische Kampfstoffe spekuliert. Gut, Schäfer wusste, dass die Zeitspanne zwischen einem unübersehbaren Auftreten der Polizei und einer entsprechenden Pressemeldung die Boulevardmedien und ihre Leser ungleich mehr erregte als Tatsachen – die geile Kluft zwischen Fiktion und Fakten. Was Schäfer tatsächlich überraschte, war, dass sein Handy noch kein einziges Mal geläutet hatte. An der Uhrzeit konnte es nicht liegen. Bei den zahlreichen Gefallen, die er ein paar Journalisten schuldig war, hätte er sich über einen Anruf um halb sieben nicht einmal ärgern dürfen. Am besten, er blockierte rechtzeitig aktiv die Leitung.
„Guten Morgen … Natürlich … Ich auch gerade … Die haben keine Semmeln? … Soll ich dir welche schicken? … Auch wieder wahr … Wie geht’s dir? … Das verstehe ich … Na ja, ich bin schon lange nicht mehr umgezogen … Einen alten Baum … Das war ein Scherz, ich fühle mich gut, bis auf … Ja, hab ich … Bis gestern noch ruhig … Hermann Born … Genau der … Dem hat einer Phosphorsäure über den Kopf gegossen … Wenn ich das wüsste, könnte ich den Fall abschließen … Ja, den Namen hab ich schon einmal gehört … Sechsundneunzig? Und der soll den Prozess überleben? … Nein, sicher bin ich dafür, dass so einer verurteilt wird, was glaubst du … Sicher kenne ich die Baumgartner Höhe, ist meine Laufstrecke … Ja, in der Ausstellung war ich vorigen Monat mit einer Schulklasse, habe ich dir eh erzählt … Natürlich … Kommst du am Wochenende? … Verstehe … Ja, stress dich nicht … Ich denke nicht, dass wir den in den nächsten Tagen schnappen … Wäre schön, ja … Ist gut … Jederzeit, und wenn du was brauchst … Mach ich … Du auch … Bis bald.“
Er legte das Telefon weg, atmete tief durch und legte sich die linke Hand aufs Herz. Wie bei einem Teenager, lächelte er wehmütig. Und noch mindestens zwei Wochen … vielleicht konnte er ja eine falsche Spur nach Den Haag legen. Isabelle arbeitete dort gerade an der Anklage gegen einen neunzigjährigen Arzt, der vor ein paar Monaten von Argentinien ausgeliefert worden war. Während des Zweiten Weltkriegs hatte er in einer Klinik auf der Baumgartner Höhe unter dem Vorwand medizinischer Forschung Hunderte Kinder malträtiert, sie mit Pockenviren, Masern und anderen schweren Krankheiten infiziert und dann kontrolliert sterben lassen. Bitte führt die Guillotine wieder ein! Jetzt beherbergte das Klinikgelände eine der größten psychiatrischen Einrichtungen Österreichs – und seit einem Jahr auch eine Ausstellung, die sich den ermordeten Kindern widmete. Vor gut einem Monat hatte Schäfer im Rahmen eines Schulprojekts eine Oberstufenklasse dorthin begleitet. Der anschließende Vortrag, den er penibel vorbereitet hatte, war völlig misslungen. Die Bilder der Toten im Kopf, die verzweifelten Blicke der ausgezehrten und schwer kranken Kinder, wie hätte er da noch sachlich und souverän über die Beweggründe von Schwerverbrechern referieren sollen. Morgen verdorben, dachte er und warf den Rest der Semmel einem Raben zu, der ihn vom Dachsims aus schon längere Zeit aufmerksam beobachtete. Kroah, kroah, doncke, Major. Gleich darauf trat sein neuer Nachbar auf den Balkon und begrüßte ihn überfreundlich.
„Morgen, Herr Wedekind … gute erste Nacht gehabt?“
„Na ja … geschlafen habe ich tief und fest, aber geträumt habe ich ganz absonderlich, von einem Haus, wo ich mit meiner Tante …“
„Das ist meistens so in der ersten Nacht oder wenn man an einem fremden Ort schläft … das hängt mit der Veränderung zusammen, die das Gehirn erst verarbeiten muss.“
„Kennen Sie sich da aus … ich meine, psychologisch …“
Verdammt, dachte Schäfer, bei dem muss ich wirklich genau aufpassen, was ich sage.
„Nein, gar nicht … geht mir nur selber immer so, wenn ich einmal auswärts übernachte.“
Er steckte sich die letzten verbliebenen Erdbeeren in den Mund, kaute hastig und sah dabei auf seine Uhr.
„Na dann“, meinte er, stand auf und begann, den Tisch abzuräumen, „der Dienst ruft …“
„Viel Erfolg, Herr Major“, erwiderte Wedekind aufmunternd, als wäre er die spanische Königin und Schäfer Columbus beim Aufbruch in den unbekannten Westen.
Schäfer holte sein Fahrrad aus dem Keller und machte sich auf den Weg ins Kommissariat. Kauf dir endlich einen Helm, hatte Isabelle ihn zum wiederholten Mal ermahnt. Nur weil er Polizist war, beschützte ihn das noch lange nicht vor irgendwelchen unzurechnungsfähigen Verkehrsteilnehmern. Sie hat recht, dachte Schäfer, und die Liste mit den Kennzeichen der Autofahrer, die ihm in den letzten Wochen den Vorrang genommen oder sich sonst wie regelwidrig verhalten hatten, würde er demnächst wegwerfen; Windmühlenkampf; er würde noch wie Don Quijote enden, mit dem armen, auf einem klapprigen Esel reitenden Bergmann an seiner Seite.
„Guten Morgen, Sancho Pansa“, begrüßte er seinen Assistenten.
„Guten Morgen … Sie wissen aber schon, dass Sancho der Klügere der beiden war, oder?“
„Natürlich … das gebe ich unumwunden zu … für wann haben Sie die Pressekonferenz angekündigt?“
„Zehn … möchten Sie jetzt doch lieber selbst …?“
„Nein, das machen Sie schon … ist schon was von der Telefongesellschaft gekommen?“
„Nein … gegen Mittag …“
„Gut … na dann … hühott, mein Knappe, auf ins Besprechungszimmer.“
Die Gruppe war vollständig versammelt; kurz nachdem sie begonnen hatten, stieß auch Oberst Kamp hinzu, gab Schäfer wortlos zu verstehen, einfach weiterzumachen, und setzte sich an den Besprechungstisch.
Nach zwei Stunden war die Wandtafel vollgeschrieben und die anstehenden Aufgaben grob umrissen: Geschäftsunterlagen, Kontobewegungen, politische Verbindungen, Vereinstätigkeiten, mögliche außereheliche Beziehungen … Schäfer führte die Sitzung wie ein manischer Regisseur die Einweisung seiner Schauspieler. Er selbst wollte ab Mittag mit Borns Nachbarn sprechen – Fußarbeit, die seinem Rang nicht entsprach, ihm aber aus zweierlei Gründen zusagte: Zum einen gab er seinen Mitarbeitern das Gefühl, dass er sich auch für Routinejobs nicht zu schade war; und zum anderen würde er in Bewegung sein, anstatt den ganzen Nachmittag am Schreibtisch zu sitzen. Nachdem die Besprechung beendet war, bat Kamp Schäfer in sein Büro.
„Gut gemacht … Sie scheinen sich wieder gefangen zu haben …“
„Ja … es geht mir gut …“
„Sehr schön. Wissen Sie, mir brauchen Sie da nichts vormachen … diese Arbeit … was glauben Sie, wie oft ich daran gedacht habe, alles hinzuschmeißen …“
Schäfer zögerte einen Moment. Was war denn das jetzt? Beichtstunde?
„Warum haben Sie es nie getan?“
Kamp stand auf und stellte sich ans Fenster.
„Warum … wofür sind wir denn sonst gut? … Ich meine das nicht negativ, schon gar nicht bei Ihnen … aber irgendwie ist es uns wohl in die Wiege gelegt … immer ein besserer Mensch sein zu müssen …“
„Entschuldigung?“, meinte Schäfer, der Kamps letzte Worte nicht begriffen hatte.
„Dass man immer ein besserer Mensch sein muss … wenn man diese Arbeit ernst nimmt … das zehrt … da wird man … aber ich will jetzt nicht wehmütig werden … wenn Sie meine Unterstützung brauchen, bin ich jederzeit für Sie da.“
„Vielen Dank, Herr Oberst“, sagte Schäfer verlegen, „das weiß ich zu schätzen.“
Er nahm die Treppe in den ersten Stock hinunter, rätselnd, was Kamp widerfahren war, dass der sich so rührselig zeigte. Das Alter? Gut vierzig Jahre war der Oberst schon im Dienst … das waren bestimmt an die tausend unnatürliche Todesfälle, überschlug Schäfer. Wie viele Tote hatte er selbst denn schon gesehen? Er wollte nicht weiter darüber nachdenken.
Bergmann wirkte angespannt, ordnete nervös seine Unterlagen, kontrollierte wiederholt seinen Stichwortzettel. Schäfer setzte sich schweigsam an den Computer und störte Bergmann nicht in seinen Vorbereitungen. Kovacs hatte ihm um halb sieben ein E-Mail geschrieben: Sie sei auf dem Weg ins Burgenland, um mit einer Frau zu sprechen, die ihnen im Fall des ermordeten LKW-Lenkers weiterhelfen könnte. Gut, nächstes Mal Absprache vor Abreise, antwortete Schäfer, der Kovacs Ehrgeiz schätzte, die lange Leine aber dennoch manchmal einzog, damit sie nicht übereifrig in die selbst gestellten Fallen lief, die Schäfer nur zu gut kannte. Nicht dass er Kovacs um diese Erfahrung bringen wollte; doch er kannte die immer noch vorherrschende Sichtweise im Polizeiapparat, die bei Fehlgriffen männlicher Beamter unscharf wurde, unterschwellig das männliche Naturell als Entschuldigung heranzog – in der Hitze des Gefechts und so weiter –, und bei Frauen sehr schnell die Kompetenzfrage stellte. Diesen Beschützerinstinkt interpretierte Kovacs freilich anders: Schäfer würde ihr weniger zutrauen, weil sie eine Frau sei, hatte sie einmal wütend gemeint, nachdem er sie an einer gefährlichen Verhaftung nicht teilnehmen ließ. Worauf er sie aus dem Büro gejagt und eine Woche mit dem Parademacho Strasser zusammengespannt hatte. Recht machen kann man es ihnen sowieso nie ganz, murmelte Schäfer, öffnete den Webbrowser und gab in eine Suchmaschine „Säureattentat“ ein. Nichts über Born auf der ersten Seite, dafür ganz oben zwei Einträge eines Pharmakonzerns, der ein neues Gel vorstellte, das den Säureangriff auf den Zahnschmelz abwehren sollte. Gleich nach der Werbung die Horrorgeschichten, mit denen Schäfer gerechnet hatte: Ägypter übergießt untreue Ehefrau mit Säure, Model nach Säureangriff durch Exfreund für immer entstellt, afghanische Mädchen nach Schulbesuch mit Säure übergossen, iranisches Gericht spricht Mann frei, der seiner Frau Säure in die Augen geschüttet hatte … Nach einer Stunde musste Schäfer eine Pause einlegen. Benommen ging er zur Espressomaschine, stellte eine Tasse ein und drehte den Schalter. Als er den ersten Schluck nahm, wurde ihm sein Missgeschick schnell bewusst. Er hatte vergessen, frisches Kaffeepulver in das Sieb zu geben. Kopfschüttelnd leerte er die Tasse in die Spüle, wusch sie aus und korrigierte seinen Fehler.
Als Bergmann von der Pressekonferenz zurückkam, fand er seinen Vorgesetzten regungslos auf den Bildschirmschoner starrend vor.
„Irgendwas nicht in Ordnung?“
„Kann man wohl sagen“, antwortete Schäfer abwesend. „Mit diesen Typen ist wirklich was nicht in Ordnung …“
„Ich kann Ihnen nicht folgen …“
„Männer, die Frauen mit Säure übergießen … das scheint bei den islamischen Spinnern fast so üblich zu sein wie bei uns der prügelnde Ehemann … die Fotos dieser Frauen möchten Sie gar nicht sehen … ich meine, wenn ein Psychopath mit Frauenhass so was tut …“
„Was anderes sind die nicht … Psychopathen …“
„Ja, schon … aber was für kranke Moralvorstellungen sind das …“ Schäfer rieb sich mit geschlossenen Augen die Nasenwurzel. „Da möchte man sich ja fast für das Afghanistan-Corps melden … Taliban abschießen …“
„Haben Sie auch was gefunden, das uns bei Born weiterhelfen könnte?“, bemühte sich Bergmann, Schäfers Negativspirale zu durchbrechen.
„Nicht wirklich … aber bei etwa fünfzig Säureangriffen auf Menschen, die ich durchgesehen habe, bin ich nur auf eine Täterin gestoßen … zumindest statistisch dürfen wir also davon ausgehen, dass wir es mit einem Mann zu tun haben “ Schäfer klopfte auf die Space-Taste und schloss das Internetprogramm. „Was war bei der PK los?“
„Viel für einen Mord, aber wenig für so einen …“
„Die Leute sind so abgebrüht … vor zehn Jahren hätten wir bei so einem Verbrechen ein eigenes Callcenter einrichten müssen … und heute … andererseits können wir uns so besser auf die Arbeit konzentrieren … wenn uns nicht an jeder Ecke ein Reporter auflauert …“
„Das ist mir überhaupt noch nie passiert“, meinte Bergmann fast bedauernd.
„Ach, das kommt schon noch … jetzt, wo Sie im Rampenlicht stehen … gehen Sie mit was essen?“
„Ja … in der Kantine gibt’s Dinkellasagne …“
„Brave new world“, meinte Schäfer und nahm sein Jackett vom Haken.
Während sie mit zwei Kollegen vom Dezernat für organisierte Kriminalität beim Essen saßen, besprachen sie den weiteren Tagesablauf. Bergmann hatte im Büro genug zu tun, also würde Schäfer die Befragungen allein durchführen. Kovacs war beschäftigt, die würde sich Schäfer spätestens am nächsten Tag vornehmen. Was Leitner betraf, bat er seinen Assistenten, ein Auge auf ihn zu haben. Er war mit Eifer bei der Sache, keine Frage, aber noch nicht wirklich erfahren in Mordermittlungen. Und Schreyer war sowieso ein eigenes Kapitel. Warum Schäfer ihn protegierte, war allen im Team ein Rätsel, mitunter auch ihm selbst. Dass er einen Narren an ihm gefressen hatte, traf es wohl am besten. In mancher Hinsicht war der junge Inspektor einfach nicht zurechnungsfähig; die ihn gar nicht mochten, bezeichneten ihn gar als grenzdebil. Doch Schäfer war anderer Ansicht: Er nahm bei Schreyer eher eine milde und praktische Form des Autismus wahr. Wenn er ihn etwa ins Archiv schickte, um alte Akten zu durchforsten, konnte er sich darauf verlassen, dass Schreyer kein Name, kein Datum, kein Kennzeichen, einfach gar nichts entging. Außerdem war Schäfer der Meinung, dass sein Team wie eine Theatergruppe funktionierte. Darin war Schreyer zweifelsohne die Idealbesetzung in der Rolle des Dezernattölpels; und wenn er ihn versetzen ließ oder gar kündigte, würde möglicherweise ein Idiot nachrücken, der wirklichen Schaden anrichtete.
Nach dem Essen ging Schäfer noch einmal ins Büro, um seine Dienstwaffe zu holen. Dass er sie brauchen würde, glaubte er nicht – aber das Gefühl der Nacktheit, das er ohne sie hatte, behagte ihm noch weniger als das zusätzliche Gewicht und die Schweißränder unter dem Lederriemen. Auf dem Weg in die Tiefgarage überlegte er, mit dem Rad in den neunzehnten Bezirk zu fahren. Das waren gut zehn Kilometer. Sein Anzug wäre verschwitzt, er würde keinen allzu seriösen Eindruck machen. Leicht verstimmt öffnete er die Tür des Dienstautos, rückte den Fahrersitz zurecht und startete den Motor. Eine halbe Stunde später stellte er den Wagen in der Nähe von Borns Haus ab, ging noch einmal die Liste der zu befragenden Nachbarn durch und machte sich auf den Weg. Wie oft hatte er schon in den Villen von Wiens reichsten Menschen zu tun gehabt; und immer noch fühlte er sich seltsam beklommen, wenn er an den mächtigen Gartentoren anläutete oder wie jetzt seinen Finger auf einen goldenen, blank geputzten Klingelknopf drückte.
„Jaaaaa?“, meinte eine Frau Mitte fünfzig und schaute ihn verwundert an, als wäre er ein Hausierer für Schuhbänder und Hosenträger.
„Grüß Gott, Frau Varga … Major Schäfer, Kriminalpolizei … dürfte ich kurz Ihre Zeit beanspruchen, um Ihnen ein paar Fragen zu Ihrem Nachbarn Hermann Born zu stellen?“
„Ja, schrecklich, was da passiert ist“, sagte sie, trat zur Seite und ließ ihn eintreten, „haben Sie denn schon jemanden in Verdacht?“
„Ähm, noch nicht … Sie?“
„Wie meinen?“
„Haben Sie einen Verdacht, wer Herrn Born so gehasst haben könnte, dass er ihn ermordet hat?“
„Aber nein, wo denken Sie hin“, antwortete sie und ging in den Salon voraus. „Darf ich Ihnen etwas anbieten, Herr …“
„Schäfer … nur ein Glas Wasser … das wäre sehr nett.“
„Con gas o senza gas?“, fragte sie und entfernte sich auch schon.
„Ganz egal“, antwortete Schäfer und fragte sich, was die Frau dazu bewog, in ihrer eigenen Wohnung Stöckelschuhe und unzenweise Goldschmuck zu tragen.
„Hier bitte.“ Sie stellte ihm das Glas hin, setzte sich und legte die Hände über Kreuz.
„In den letzten Wochen …“, begann Schäfer und drückte die Mine aus seinem Druckbleistift, „ist da hier in der Gegend irgendetwas Ungewöhnliches passiert … in der Art, dass Sie länger darüber nachgedacht haben oder vielleicht sogar jemandem davon erzählt haben?“
„Bei Familie Possnigg … in der Villa schräg gegenüber“, meinte sie nach einer längeren Pause, „ist vor zwei Wochen der Alarm ausgelöst worden … das hat sich allerdings als technischer Defekt herausgestellt … ansonsten … nicht, dass ich wüsste …“
„Und irgendwelche Dinge, die Ihnen vielleicht vor Monaten oder sogar Jahren zu denken gegeben haben … über die Sie mittlerweile nicht mehr nachdenken?“
„Ich verstehe Sie nicht ganz, Herr Inspektor.“
„Na ja … dass Sie sich einige Male über etwas im Umfeld der Familie Born gewundert haben … und weil es keinerlei negative Konsequenzen oder Überraschungen gab, haben Sie es einfach hingenommen, ohne weiter darüber nachzudenken … eine Ihnen fremde Person, die immer wieder in der Nähe war oder die Borns besucht hat … etwas, das von der alltäglichen Routine abwich …“
„Eine dunkle Limousine“, erwiderte sie zu Schäfers Überraschung, „ein schwarzer Mercedes oder BMW, wenn ich mich recht erinnere … den habe ich immer wieder einmal durch das Tor fahren sehen … wahrscheinlich ein Politfreund … ich habe nie jemanden erkannt, da die Scheiben sehr dunkel waren …“
„Können Sie sich an ein Kennzeichen erinnern?“
„Es muss ein Wiener oder ein Diplomatenkennzeichen gewesen sein … alles andere hätte ich mir bestimmt gemerkt …“
„Wie eng war Ihr Kontakt zu Hermann Born beziehungsweise zu seiner Frau? Haben Sie miteinander gesprochen oder sich regelmäßig getroffen?“
„Ich würde es als Nachbarschaft comme il faut bezeichnen.“ Die Frau rutschte ein wenig nach links und zog ihren Rock zurecht. „Wenn wir einen Empfang gegeben haben, waren sie zumeist eingeladen … es sei denn, es hat sich um den engen Familienkreis gehandelt … aber das als Freundschaft zu bezeichnen, so weit würde ich nicht gehen.“
Schäfer machte sich Notizen und suchte in ihrem fast maskenhaften Gesicht nach Zeichen von Anspannung oder Erregung. Wobei: Die alte Schule des Mimiklesens, das Erkennen von unwillkürlichen Bewegungen der Lippen, Augenbrauen oder Nasenflügel – sie wurde mehr und mehr zum Zufallsspiel, seit Lifting, Botox und Tranquilizer zum weiblichen Standardtuning gehörten und die Gesichtsmuskulatur sich von den Emotionen emanzipiert hatte.
„Wie ist man denn hier in der Nachbarschaft Herrn Borns politischer Arbeit und seinen Ansichten gegenübergestanden?“
„Ach, Herr Inspektor … Politik ist Politik und Schnaps ist Schnaps, wenn ich das so burschikos formulieren darf … sehen Sie: Mein Mann war selbst lange Zeit im Ministerium, allerdings bei den Sozialdemokraten … und bis auf ein paar kleinere Scharmützel wurde das immer eher sportlich gesehen.“
Nach einer Dreiviertelstunde entschied sich Schäfer dafür, die Befragung zu beenden. Ihm war heiß und seine Konzentration ließ nach. Er trank sein Glas leer, bedankte sich bei Frau Varga für ihre Mithilfe und verabschiedete sich. Bevor er ans nächste Interview ging, setzte er sich auf eine Bank im Schatten einer riesigen Ulme, um die eben erhaltenen Informationen zu überdenken und seine Mitschrift zu ordnen. Eine schwarze Limousine … dass so etwas in dieser Gegend hier überhaupt auffiel … bei einem alten Opel, ja … Schäfers Telefon unterbrach seinen Gedankenfluss.
„Bergmann, was ist? … Ich mache gerade eine Nachdenkpause … Und? Haben Sie den Anrufer ermittelt? … Ich hasse Wertkartenhandys … Ja … Sicher … Hat die Spurensicherung irgendwas Neues? … Bis jetzt nicht wirklich. Eine schwarze Mercedeslimousine mit getönten Scheiben soll immer wieder mal bei der Einfahrt hinein … Was die Born betrifft: Zu der haben Sie sicher den besseren Draht. Können Sie die nochmals befragen? … Sehr gut … Na ja, ihre Nachbarin hat auch das Landhaus am Semmering erwähnt, in dem Frau Born die letzten paar Tage war … Ich möchte wissen, wann sie in den letzten Monaten nicht in Wien war … Da fällt Ihnen schon etwas ein, Sie sind ja eh so diskret … Was treibt die Knechtschaft? … Sehr gut … Nein, im Moment fällt mir nichts ein … Laufen? … Ja, gerne … Muss ich eigentlich nicht, Sie können mich direkt zu Hause abholen … Gut, bis später, Bergmann.“
Schäfer drückte auf die Abbruchtaste und legte sein Handy auf die Bank. Born hatte einen Anruf erhalten; etwa drei bis vier Stunden vor seinem Tod, von einem Wertkartentelefon mit österreichischer Nummer. Natürlich musste das nichts heißen, aber sie würden den Anrufer ermitteln müssen. Eine Aufgabe, in die sich Schreyer verbeißen konnte, dachte Schäfer und stand auf, um zur Villa gegenüber zu gehen.
Kurz vor sieben beschloss er, genug geleistet zu haben. Fünf Befragungen, dazu drei Nachbarn, die er wohl am nächsten Tag aufsuchen musste, da sie nicht zu Hause gewesen waren. Die Antworten, die er erhalten hatte, waren fast auffällig deckungsgleich. Niemand wollte Born etwas Schlechtes nachsagen, keiner konnte sich erklären, wer zu so einer Tat fähig sei … die Diskretion, mit der Schäfer in den vergangenen Stunden konfrontiert gewesen war, ähnelte schon der Verschwiegenheit, auf die er in der Wiener Unterwelt immer wieder stieß. Dennoch: Immerhin zwei der Befragten gaben auf seine Nachfrage an, dass ihnen die schwarze Limousine aufgefallen war, konnten aber keine genaueren Angaben dazu machen. Hoffentlich würde ihm Borns Witwe darüber Klarheit verschaffen können – zu viele unbekannte Variablen machten Schäfer nervös.
Er stieg in den Wagen, fuhr bis zur nächsten Umkehrmöglichkeit und machte sich auf den Nachhauseweg. Als er auf dem Gürtel im Stau stand, überlegte er, ob er nicht doch ins Kommissariat fahren sollte, um mit seinen Mitarbeitern die ersten Ermittlungsergebnisse zu besprechen. Doch dann würde er das Laufen streichen müssen. Schauen Sie auf sich, hatte ihm sein Therapeut geraten. Schäfer bog vom Gürtel ab und parkte zwanzig Minuten später vor seinem Wohnhaus.