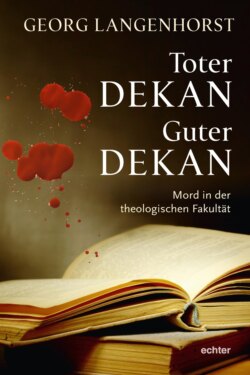Читать книгу Toter Dekan - guter Dekan - Georg Langenhorst - Страница 14
ОглавлениеMittwoch, 12. Mai, vormittags
Ein Prodekan und viele Geheimnisse
Prodekan Hermann-Josef Kösters hockte missmutig in seinem Büro. Das mittellange braune Haar, sonst immer streng gescheitelt und gekämmt, hing ihm ungeordnet über Stirn und Hornbrille. Rechts und links an den Wänden zogen sich Regalreihen hoch, vollgestellt mit Karteikästen, Leitzordnern, Büchern. Da blieb kein Platz frei für Bilder. Auf dem gleichfalls dicht bepackten Schreibtisch fand sich je ein Foto von seiner Frau und seiner Tochter sowie – immerhin – eine unbeholfene Kinderzeichnung, auf der ein Strichmännchen einen Blumenstrauß pflückt.
In der linken Hand hielt der Professor einen dampfenden Becher Kaffee, mit der rechten fingerte er an einem Kugelschreiber herum. Ihm gegenüber saß Silvia Hoberg, die Dekanatssekretärin, auch sie mit einem Kaffee. „Aber verstehen Sie doch“, stieß Kösters gerade aus, „ich habe dem Verlag fest zugesagt, dass das Manuskript bis Ende Oktober fertig ist. Fünf Jahre sitze ich an diesem Kommentar, fünf Jahre! Und jetzt brauche ich einfach noch konzentrierte vier Monate, dann kann ich das auch schaffen. Ich habe ja schon unseren Sommerurlaub abgesagt. Was glauben Sie, wie sauer Gabi und Sophie auf mich sind?!“ Damit wies er auf die beiden Fotos auf seinem Schreibtisch.
Hobi kannte die Ehefrau und die spät geborene Tochter des Prodekans, die immer mal wieder in der Fakultät vorbeischauten.Sophies Grundschule lag gleich um die Ecke. Seine Tochter war sein Ein und Alles. Gerade weil er ein später Vater war, liebte er dieses Kind – ‚fast mehr als seine Frau, wenn man nach dem äußeren Eindruck geht‘, dachte die Dekanatssekretärin immer wieder, ‚aber die beiden haben ja auch lange genug auf ihren kleinen Sonnenschein warten müssen‘. Sie wusste auch, dass Kösters an einem großen Kommentar zum Johannesevangelium schrieb, eine Arbeit, die ihm alle Konzentration und Kraft abverlangte.
„Aber was sollen wir tun, Herr Kösters?“, fragte sie im Wissen, bei ihm den Zusatz „Herr Professor“ weglassen zu dürfen, was beileibe nicht bei allen Kollegen im Hause angesagt war. „Ich weiß ja, ich weiß“, seufzte dieser, während er sich das Haar zurechtstrich. „Ich werde all das aufschieben müssen. Ob ich will oder nicht, als Prodekan muss ich jetzt die Fakultät führen. Ich habe heute Morgen schon die offizielle Bestätigung vom Präsidenten der Universität erhalten. Schauen Sie hier!“ Er zog ein Blatt von einem der Papierstapel und las laut: „… wünsche ich Ihnen eine glückliche Hand und viel Geschick in der Behandlung der unliebsamen Angelegenheit.‘ Unliebsame Angelegenheit, der ist gut! Ein Mord, hier bei uns! Eigentlich unfassbar! Und alle anderen Geschäfte müssen ja auch weitergehen.“
Dann blickte er auf die Uhr. „Wo bleibt er denn, der Herr Kommissar, hat sich doch für zehn Uhr angesagt?“ In diesem Moment führte Verena Obmöller, die studentische Mitarbeiterin im Dekanat, Kommissar Kellert ins Zimmer. „’tschuldigung, habe nicht gleich einen Parkplatz gefunden“, murmelte er, bevor er der Sekretärin und dem Prodekan die Hand reichte, „schön, dass Sie Zeit haben!“ „Nun ja, wir müssen die Angelegenheit ja klären“, meinte Kösters und bot dem Kommissar den zweiten Besucherstuhl neben Frau Hoberg an. „Aber was können wir denn noch für Sie tun?“
„Ja, also zunächst wollte ich wissen, ob Sie nun herausgefunden haben, welche Unterlagen entwendet wurden“, wandte sich Kellert als Erstes an die Sekretärin. Die rutschte ein wenig auf dem Stuhl herum und antwortete dann: „Das kann ich leider nicht ganz genau sagen. Sehen Sie, ich bin jetzt seit zweiundzwanzig Jahren Dekanatssekretärin, und bei wirklich jedem meiner vielen Chefs wusste ich immer genau, wo sich alle Unterlagen befanden. Professor Gerstmaier war da anders. Der hat auch kaum mit dem Computer gearbeitet, alles noch auf Papier ausgedruckt. Der legte selbst seine Ordner und Mappen an, von denen ich keine Ahnung hatte. Die schloss er auch jeden Abend weg, darauf hatte ich keinen Zugriff. Ich weiß nicht, was fehlt. Von meinen Unterlagen nichts, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann.“
„Na kommen Sie“, Kellert zwinkerte ihr vertraulich zu, „so ganz an Ihnen vorbei wird er das doch nicht alles betrieben haben. Sie haben den Laden doch gut im Griff, das sieht man sofort. Haben Sie nicht doch eine Vermutung, was die Unterlagen betrifft, von denen Sie da eben sprachen?“
Hobi wurde ein bisschen rot über das Lob und die charmante Anrede, die sie von ihren Theologen nicht gewöhnt war. Mit einem koketten Lächeln gab sie zu: „Na ja, ich weiß es nicht genau, aber ich hatte so die Vermutung, dass das Personalunterlagen waren. Ganz am Anfang, als er Dekan wurde, musste ich ihm sämtliche Papiere über unsere Mitarbeiter kopieren. Und ich glaube, er hat die irgendwie ergänzt, mit persönlichen Daten und so. Aber bitte: Ich weiß das nicht genau, es ist nur eine Vermutung.“
„Hmm, interessant. Haben Sie denn schon mal in seinem abschließbaren Schrank nachgeschaut?“, wollte Kellert wissen. „Das konnten wir doch nicht“, mischte sich Kösters ein. „Ihr Mitarbeiter hat den Dienstraum des Dekans ja versiegelt, nachdem wir uns einen ersten Überblickt verschafft hatten.“ „Na, dann wollen wir mal“, sagte der Kommissar und stand auf. „Sie haben doch den Schlüssel zu seinem Dekanszimmer, oder?“
Die Sekretärin hielt wortlos einen gut bestückten Schlüsselbund hoch, nickte und folgte dem Polizisten zusammen mit Kösters auf den Flur, in das Treppenhaus, ein Stockwerk hoch und dann den Weg bis zum Dekanat. Kellert nahm den ihm gereichten Schlüssel, ritzte das Siegel durch, schloss die Tür auf und bat die beiden anderen einzutreten.
Sofort stiegen bei der Sekretärin Erinnerungsbilder hoch: Vorgestern hatte sie hier ihren Chef tot aufgefunden. Das schien ihr gleichzeitig unmittelbar nah, andererseits unendlich weit entfernt. Das gleißende Licht des Frühlingsmorgens, das durch die beiden Fenster in den hohen Raum hineinstrahlte, tauchte die Szenerie in eine fast unwirkliche Klarheit. Alles war wie immer: aufgeräumt und in penibler Ordnung. Nur die Blutflecken auf dem Teppich vor dem Schreibtisch störten. Sie waren zu einem braunroten Farbton eingetrocknet. Silvia Hoberg lief ein kalter Schauer den Rücken herunter. Sie schluckte dreimal. „Hier, bitte“, wies Kösters nach rechts zu einem blauen Metallschrank mit verschließbarem Rollgitter.
„Haben Sie dafür auch einen Schlüssel?“, fragte Kellert. Beide verneinten. „Den hatte nur der Dekan selbst“, kommentierte die Sekretärin mit säuerlicher Miene. Offenbar war das früher anders gewesen. Kellert brummelte etwas Unverständliches, durchsuchte lustlos den Schreibtisch, fand nichts und ging dann zum Schrank. Mit einem kräftigen beidhändigen Ruck schob er das Rollgitter beiseite: „Na also, geht doch!“
„Da fehlt etwas!“, rief die Sekretärin. „Schauen Sie hier!“ Tatsächlich, einer der blassgrauen Regalböden war leer. In den anderen türmten sich ungeordnete Papierstapel. ‚Erstaunlich, diese Unordnung in einem ansonsten so penibel aufgeräumten Zimmer! Seltsam!‘, dachte Kellert.
„Da lagen immer einige braune Hängeregistraturen, daran erinnere ich mich genau“, unterbrach die Sekretärin seine Gedanken. „Die sind mir immer aufgefallen, weil man die ja eben eigentlich hängt, aber da lagen immer sieben, acht Stück übereinander.“ „Und über den Inhalt …“ „… kann ich Ihnen nichts Genaues sagen, leider!“
„Gut, das ist ja immerhin schon etwas“, fasste Kellert zusammen und ließ den Blick durch das nüchtern und zweckmäßig eingerichtete Dienstzimmer des Dekans streifen. Dann wandte er sich an Prodekan Kösters: „Sie können den Raum dann reinigen lassen und wieder nutzen. Und vielleicht fällt Ihnen dabei ja doch noch etwas auf. Kommen Sie, gehen wir lieber zurück in Ihr Büro. Und Sie“, er drehte sich zu der Sekretärin herum, „brauche ich dann vorerst nicht mehr. Vielen Dank für alle Auskünfte. Ach, aber wenn Sie mir auch einen Kaffee bringen könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden.“
„So, und womit kann ich Ihnen noch dienen?“, fragte Prodekan Kösters, als die beiden Männer wieder in seinem Arbeitszimmer saßen. Ungeduldig hatte er auf die Uhr geschaut. Vielleicht bliebe ja doch noch wenigstens ein bisschen Zeit für seine Studien. Kellert hatte sich unterdessen im Zimmer umgesehen, deutete mit dem Daumen auf die kleineKinderzeichnung und fragte: „Von Ihrer Tochter?“ „Ja, schön, nicht wahr?“, antwortete der Professor und ein Strahlen trat in seinen Blick.
Dem Kommissar war aber nicht nach höflichem Geplauder zumute. Er blickte ihm scharf in die Augen. „Ich habe gehört, dass es vor zwei Wochen einen Konflikt in Ihrer Fakultät gegeben hat“, begann er, wurde aber von einem trockenen Lachen Kösters unterbrochen. „Haha, vor zwei Wochen? So was haben wir hier jeden Tag. Oder“, er dachte nach „hatten wir hier jedenfalls fast jeden Tag.“
„Ja, ich meine aber eine außergewöhnlich heftige Auseinandersetzung“, setzte Kellert nach, „zwischen dem Dekan und Professor Mühlhof.“ „Mühlsiepe heißt der, wenn Sie unseren Dogmatiker meinen!“ „Richtig, genau den!“ Kösters lehnte sich zurück, rollte mit den Augen und sagte dann: „Gut, also den Konflikt meinen Sie. Ja, der war tatsächlich außergewöhnlich.“ „Erzählen Sie schon!“, forderte der Kommissar ihn auf.
„Na ja, jetzt wo Gerstmaier tot ist … Das ist wirklich heikel. Aber Sie müssen auch mit Mühlsiepe selbst sprechen bitte! Was ich Ihnen erzählen kann, ist Folgendes. Also: Mühlsiepe vertritt eine Christologie von unten, falls Ihnen das etwas sagt.“ „Nein“, unterbrach Kellert, „ehrlich gesagt habe ich von Theologie und Kirche nicht viel Ahnung. Können Sie es so erklären, dass man das auch als Laie versteht? Und bitte nur das, was für unseren Fall wirklich wichtig ist.“
„Okay“, seufzte Kösters, „ich werde es versuchen. Also: Man hat im Christentum immer schon versucht, das Besondere an Jesus Christus zu erklären. In der Kirche hat sich – grob gesagt – die Tradition durchgesetzt, dass man das ‚von oben‘, sozusagen aus göttlicher Perspektive versucht hat. Alle zentralen Glaubensaussagen in den Bekenntnissen, zum Beispiel:Jesus Christus ist ‚wahrer Mensch und wahrer‘ Gott, lassen sich so verstehen.“ „Hmm, ja und?“, knurrte Kellert, der sich für diese Spitzfindigkeiten offenbar wenig interessierte. „Nun ja, und Mühlsiepe versucht – wie einige andere auch – den Zugang ‚von unten‘, also aus menschlicher Sicht, von der biblischen Basis und unserem heutigen Verständnis her. Mir als Neutestamentler ist das natürlich sehr sympathisch.“
Wieder unterbrach Kellert mit unverhohlener Ungeduld: „Ja, und wo ist nun das Problem?“ „Genau an diesem Punkt. Eher konservative Theologen unter den Bischöfen und unter unseren Kollegen denken, dass damit der Glaube verkürzt werde, die Tradition verfälscht, dass man damit die Substanz des Christentums verrät. Gerstmaier gehörte dazu, ja, er war ein Wortführer dieser Fraktion. Und, äh, verstehen Sie, er hatte einen besonders engen Draht zum Bischof.“ „Nein, das verstehe ich nicht. Worauf wollen Sie hinaus?“, fragte der Kommissar sichtlich ungehalten nach.
Kösters wand sich auf seinem Stuhl, räusperte sich, rang mit sich. „Nun, das hatte einige Konsequenzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn wir im Professorium – also dem internen Treffen aller Professoren – unsere inneren Angelegenheiten besprachen, konnten wir uns eigentlich immer darauf verlassen, dass das unter uns blieb. Nicht, dass es da große Geheimnisse zu hüten galt, aber es war einfach gut zu wissen, dass man da offen miteinander organisatorische wie inhaltliche Dinge bereden und klären konnte. Seit einiger Zeit war uns klar, dass der Bischof schon wenige Stunden nach unseren Sitzungen haarklein über alles informiert war, was wir intern besprochen hatten. Da wird man dann vorsichtiger und misstrauischer, wie Sie sich denken können.“
„Schon klar, ja“, antwortete Kellert, „aber woher wussten Sie, dass Gerstmaier die undichte Stelle war?“ „Dass die beiden häufig zusammenhockten, ist nun wirklich kein Geheimnis, das weiß man in hiesigen kirchlichen Kreisen. Friedensberg ist eben doch ein Dorf mit einer Universität. Und spätestens die Sache mit Mühlsiepe war dann der Beweis.“
„Jetzt sagen Sie doch schon, was da war!“ „Gerstmaier hat unseren Kollegen beim Bischof angeschwärzt. Damit, dass der eine nichtkatholische Theologie befürworte und folglich häretische Positionen, also kirchliche Irrlehre vertrete. Und das zielte darauf ab, dass man ihm seine Lehrtätigkeit und den Lehrstuhl entziehen sollte. Stellen Sie sich das vor, unter Kollegen!“
„Und wie stand die Fakultät dazu?“, wollte Kellert wissen. „Wir standen und stehen geschlossen hinter unserem Kollegen, das ist doch klar!“, beteuerte Kösters mit fester Stimme, um dann jedoch nachdenklich nachzuschieben: „Zumindest nach außen … Ob alle Kollegen im Inneren so denken, das weiß ich natürlich nicht. Und ob sie im Konfliktfall bei ihren Willensbekundungen bleiben würden, weiß ich auch nicht. Bei einigen habe ich so meine Zweifel.“
„Das heißt aber doch, dass dann die ganze berufliche Karriere Ihres Kollegen ruiniert wäre, oder?“, fragte Kellert nach, der hier natürlich sofort ein mögliches Tatmotiv witterte. „Ruiniert wäre Mühlsiepe nicht direkt, wenn es so weit käme“, gab der Prodekan zu bedenken. „Wir sind ja Beamte, entlassen kann man uns also nicht so einfach. Die Universität müsste im Extremfall einen Ersatzposten für ihn bereitstellen. So etwas gibt es an einigen anderen Universitäten schon: Ersatzstellen im Bereich Religionswissenschaft oder Ethik oder was immer sich im Einzelfall anbietet. Das macht natürlich keine Universität gern, aber dazu sind sie nun einmal verpflichtet. Für die wissenschaftliche Karriere von Mühlsiepe wäre es aber natürlich das Aus. Wer liest dann schon noch seine Bücher, wer publiziert Aufsätze, wer lädt zu Vorträgen ein?“
„Aber kann einem das nicht sogar noch mehr Aufmerksamkeit bringen?“, überlegte Kellert. „Nur kurzfristig“, gab Kösters zurück. „Es gibt zwar einige Stars der Szene, Küng und Drewermann zum Beispiel, deren öffentliche Bekanntheit durch den Entzug der kirchlichen Lehrerlaubnis sicherlich eher noch gesteigert wurde, aber im Normalfall versinkt man nach kurzer Zeit in der Anonymität.“
„Ganz schön heftig!“, meinte Kellert nach einigem Überlegen, massierte sich die rechte Schläfe, fügte dann aber hinzu: „Und wie steht es denn nun mit dieser, äh Denunziation, also mit diesem Verfahren?“
Kösters kratzte sich am Hinterkopf und runzelte die Stirn: „Das weiß man nicht so genau. Wissen Sie, in der Kirche läuft so etwas eher hinter den Kulissen. Da gibt es keine klaren öffentlichen Prozesse mit Anklage, Verteidiger und Richter. Soweit wir informiert sind, verhält sich unser Bischof zögerlich. Der ist kein Scharfmacher oder Polarisierer, eher ein ausgewogener und nachdenklicher Mensch. Entweder teilt er die Einschätzung des Dekans nicht, oder er will den Fall nicht hochkochen lassen. Unsere Fakultät hat ja auch einen guten Ruf zu verlieren. Doch, doch, wir gehören in Deutschland zu den führenden Fakultäten! Katholische Theologie aus Friedensberg, die kennt man in den USA und in Lateinamerika. Und das setzt man nicht so leicht aufs Spiel. Gerstmaier war jedenfalls nicht begeistert. Beim letzten Konflikt im Professorium – vorletzte Woche war das – hat er gedroht: ‚Dann wende ich mich eben direkt an Rom!‘“
„Und, kann er das denn?“ „Sicherlich kann er das! Er hat seine Kontakte, seine Netzwerke und Verbindungen. Mit welchen Aussichten – keine Ahnung … Aber welche Mittel einem Dekan ganz legal zur Verfügung stehen, dazu könnte ich Ihnen vieles sagen. So hat Gerstmaier dem Kollegen Mühlsiepe zum Beispiel letztes Jahr ein Forschungsfreisemester verweigert.“
Kellert blickte auf, drehte an seinem Kugelschreiber herum und unterbrach: „Ein was?“ „Ein Forschungsfreisemester!“, erwiderte Kösters. „Das muss ich Ihnen natürlich erklären! Bitte entschuldigen Sie! Es gibt so viele Begriffe, die für uns hier in der Uni so selbstverständlich sind. Kritiker sagen ja, die Universitäten sind wie Elfenbeintürme, ganz eigene geschützte Welten. Mit einer eigenen Sprache und mit Regeln und Gesetzen, die nur hier gelten.“
‚Von wegen, eigene Gesetze. Mord bleibt Mord!‘, dachte Kellert, unterbrach den Prodekan aber nicht, der fortfuhr: „Also das ist so: Jeder Professor hat die Möglichkeit, sich alle vier bis fünf Jahre für ein Semester von der Lehrverpflichtung freistellen zu lassen. Er muss also weder Vorlesungen noch Seminare halten.“ „Nett, warum gibt es so etwas bei uns nicht“, entfuhr es Kellert.
„Ja, das ist schon ein Privileg von uns Professoren, da haben Sie Recht“, räumte Kösters ein. „Andererseits sind wir an den Universitäten ja für zwei Bereiche zuständig: Lehre und Forschung. Und zu echter Forschung kommt man im laufenden Betrieb kaum. In dem Freisemester soll Raum für diese Forschung sein. Für Prüfungen und Verwaltungsaufgaben müssen wir aber auch da weiterhin zur Verfügung stehen, und allein das frisst enorm viel Zeit.“
„Und wie war das nun mit Gerstmaier und Mühlsiepe?“, wollte der Kommissar wissen. „Nun, Mühlsiepe war eigentlich mal wieder an der Reihe. Wir wechseln in regelmäßiger Abfolge durch, so dass jeder genau weiß, wann er an derReihe ist. So gibt es keinen Streit und keine Bevorzugung.“ „Ist doch fair, oder?“, fragte Kellert dazwischen.
„Genau!“, stimmte Kösters zu. „Deshalb haben wir diese Regelung ja auch so getroffen. Aber in diesem Fall hat Gerstmaier anders entschieden. Es ist so: Jeder von uns muss ein konkretes Forschungsprojekt benennen und skizzieren, das er in dieser Zeit bearbeiten will. Und der Dekan muss beurteilen, ob das valide ist oder nicht. Normalerweise ist dieser Vorgang nur ein formaler Akt. Man stimmt dem halt zu, egal, was man davon hält. Wir kennen uns ja auch nicht genau im Fachgebiet der anderen aus, können das also kaum kompetent bewerten. Und ob nun jemand die Freiheit zur Forschung nutzt oder das als ‚Semester frei von Forschung“ definiert, das steht letztlich im Belieben des Einzelnen.“
„Aber?“ „Ja, dieses Mal hat Gerstmaier die Zustimmung verweigert“, meinte Kösters, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und rückte seine Brille zurecht. „Und wie hat er das begründet?“ „Offiziell gar nicht!“, erwiderte der Professor. „Das muss er aber auch nicht. Inoffiziell hat er etwas verlauten lassen wie ‚Theologie der 80er Jahre. Das ist keine Forschung. Alles schon geschrieben. Wiederholungen brauchen wir nicht.‘ In diesem Sinne!“
Kellert grübelte nach und beugte sich vor: „Und Ihr Kollege Mühlsiepe? Wie hat er das alles hingenommen?“ Kösters stand auf und ging in seinem Zimmer auf und ab: „Mühlsiepe? Der war natürlich aufgebracht. Total sauer. Aber auch tief getroffen. Ich glaube, die Sache schlägt ihm ganz schön auf die Gesundheit. Aber bitte, das müssen Sie ihn wirklich selber fragen. Überhaupt, ich glaube, ich habe schon viel zu viel erzählt.“
„Nein, das denke ich nicht“, beruhigte ihn der Kommissar. „Denken Sie daran: Hier geht es nicht um die Aufklärung von Querelen und Intrigen unter Kollegen, sondern um Mord. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit!“ Mit diesen Worten stand er auf und verabschiedete sich von seinem Gesprächspartner: „Auf Wiedersehen. Und mit Ihrem Kollegen werde ich sprechen, keine Sorge. Bitte sagen Sie ihm aber vorläufig noch nichts von unserem Gespräch, ich würde gern seine unmittelbare und eigene Version hören.“
„Ach Herr Kommissar“, rief ihm Kösters nach, „noch eine Frage!“ Kellert blieb in der Tür stehen. Der Prodekan kam näher und sprach mit verhaltener Stimme: „Ist die Leiche von Gerstmaier eigentlich schon zur Bestattung freigegeben? Wir müssen uns dann ja um die Beerdigung kümmern, wissen Sie. Das wird sicherlich ein ziemlich großes Ereignis.“
Kellert schaute ihn fragend an. „Ach so? Nun, ich fürchte, Sie werden sich da noch ein wenig gedulden müssen. Ich habe heute Morgen die Information erhalten, dass er einen Organspende-Ausweis bei sich gehabt hat. Und das entsprechende Prozedere zieht sich noch ein wenig hin.“ „Wie, Gerstmaier hatte einen Organspende-Ausweis!?“ Kösters schaute wirklich überrascht. „Das sieht ihm aber gar nicht ähnlich. Nein, das hätte ich bei ihm nicht erwartet … Sagen Sie mir dann Bescheid, wenn er bestattet werden kann?“ „Das kann ich Ihnen gern zusagen.“