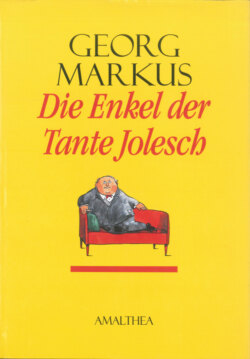Читать книгу Die Enkel der Tante Jolesch - Georg Markus - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»BIS DER BUB IN PENSION
GEHEN KANN« Die Nachfolger des Dr. Sperber
ОглавлениеZu den populärsten Figuren der »Tante Jolesch« zählt der Wiener Rechtsanwalt Dr. Hugo Sperber, dessen Werbeslogan geradezu Kultstatus erlangte:
»Räuber, Mörder, Kindsverderber,
Gehen nur zu Doktor Sperber.«
Sage mir keiner, es hätte nach dem Krieg in Wien keinen zweiten Doktor Sperber gegeben. Sperber II. hieß Dr. Michael Stern und ist heute fast so legendär wie das Original. Auch für ihn gab’s einen Werbespruch, der freilich von Karl Farkas stammte und von diesem in einer »Simpl«-Conférence verbreitet wurde:
»Bleibst du gern dem Häfen fern,
Nimm dir nur den Doktor Stern.«
Stern hat eine außergewöhnliche Biografie, war er doch einer von dreißig jüdischen Rechtsanwälten, die man nach 1938 weiter als »Rechtskonsulenten« in Wien arbeiten ließ. Dass er bis Kriegsende »nichtarische Klienten« vertreten durfte, verdankte Stern der Ehe mit seiner nichtjüdischen Frau Edith, die sich trotz des enormen Drucks, der auf sie ausgeübt wurde, standhaft weigerte, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen und ihn damit vor der sicheren Verfolgung schützte.
Nach dem Krieg erlangte Michael Stern Ansehen als Anwalt prominenter Klienten, aber auch in spektakulären Strafprozessen – allen voran gegen Adrienne Eckardt, die »Mörderin mit dem Engelsgesicht«. Wir aber wollen hier Dr. Sterns Talent nachgehen, seine Gesprächspartner durch Anekdoten aus dem Gerichtssaal in den Bann zu ziehen. So telegrafierte er einmal einem Mandanten nach Abschluss seines Prozesses: »Die gerechte Sache hat gesiegt.«
Worauf dieser antwortete: »Sofort Berufung einlegen!«
Mit seinem Aufstieg zum berühmtesten Advokaten des Landes stieg auch das Vermögen des alten Stern, das er sehr geschickt in Immobilien anzulegen verstand. Seine Villen in Grinzing und Zinshäuser in der Wiener Innenstadt führten dazu, dass man im Landesgericht für Strafsachen schon in den sechziger Jahren munkelte: »Wenn der alte Stern stirbt, trägt das Grundbuch Trauerflor.«
Er aber dachte lange nicht ans Sterben. Michael Stern wurde 92 Jahre alt. Der Tod ereilte ihn im Dezember 1989 – eben dort, wo er es sich gewünscht hatte: in seiner Kanzlei auf der Wiener Seilerstätte, in der er jeden Tag ab vier Uhr früh anzutreffen und bis zur letzten Stunde seines Lebens tätig war.
Als er hoch in den Achtzigern stand, schlief er schon mal während einer Verhandlung ein, wachte aber stets dann auf, wenn es darum ging, seinen Mandanten mit einem brillanten Plädoyer vor der sicher scheinenden Verurteilung zu bewahren. Zur Höchstform gelangte der als »Wunderrabbi des Gerichtssaals« bezeichnete Dr. Stern stets in der Schlussphase seiner Verteidigungsreden, wenn er die Geschworenen in eindringlichen Worten aufforderte, dem Angeklagten zu einem Freispruch zu verhelfen, da dieser garantiert schuldlos sei. Dies müsste man einem alten Anwalt glauben, dessen nächster Prozess sicher schon vor dem Jüngsten Gericht stattfinden würde, da er bereits mit einem Fuß im Grab stünde.
In diesem »stand« er gut zwanzig Jahre, und ebenso lang zog die Masche, die selbst geeichte Kiebitze zu Tränen zwang.
Auch in einem Terroristenprozess wies der damals 85-jährige Staranwalt wieder einmal auf sein demnächst zu erwartendes Ableben hin, um dann noch mit einem Blick zu seinem »erst« achtzigjährigen Kollegen Dr. Obendorfer – der einen Komplizen seines Mandanten vertrat – anzufügen: »Ich, meine Damen und Herren Geschworenen, bin nicht hier, um mein Honorar zu verdienen, wie dies bei meinem jungen Kollegen Dr. Obendorfer der Fall sein mag.«
Der neben ihm auf der Verteidigerbank sitzende »Jüngling« erstarrte derweilen zur Salzsäule.
Auf die Tränendrüse drückte der alte Stern auch im Fall einer der Abtreibung verdächtigten Hebamme. Obwohl viele Indizien gegen die »Engelmacherin« sprachen, gelang es dem Strafverteidiger mit dem ihm eigenen Geschick, einen Freispruch zu erwirken. Leider erklärte die Frau dem Richter zum Entsetzen ihres Advokaten nach der Urteilsverkündung:
»Vielen Dank, Herr Rat! Und ich werd’s auch bestimmt nimmer mehr machen!«
Die eben noch von den Kiebitzen im Gerichtssaal vergossenen Tränen wichen allgemeinen Heiterkeitsausbrüchen.
In Juristenkreisen hieß es mit Hinweis auf die Privilegien, die Dr. Stern beim Besuch von Strafgefangenen im »Grauen Haus« genoss, dass in Österreich vielleicht alle Bürger, nicht aber alle Anwälte vor dem Gesetz gleich wären. Die Bevorzugung des Staranwalts bestand auch außerhalb der Gerichtsmauern, etwa im Feinkostgeschäft Meinl am Graben, das – wenn der berühmte Strafverteidiger einkaufen wollte – seinetwegen schon um sechs Uhr früh aufgesperrt wurde.
Um ein Privileg ganz anderer Art bemühte sich der gewiefte Jurist, als er eines Morgens den nicht minder legendären Burgtheaterdirektor Ernst Haeusserman anrief.
Haeusserman, der damals Max Reinhardts traditionell ausverkaufte »Jedermann«-Inszenierung für die Salzburger Festspiele betreute, war Nachtmensch und infolgedessen Langschläfer. Keiner hätte es je gewagt, ihn vor zehn Uhr vormittag zu belästigen. Nur einer: der Morgenmensch Dr. Michael Stern, den man schon in seiner Kanzlei antreffen konnte, wenn Haeusserman noch durchs Wiener Nachtleben streunte.
Dennoch läutete eines sehr frühen Sommermorgens das Telefon in der Wiener Wohnung des Theaterprinzipals. Haeusserman wankte schlaftrunken zum Apparat. Es war knapp nach fünf Uhr früh!
Das Burgtheater musste brennen, anders war eine Störung zu dieser Stunde nicht erklärbar.
Doch der Grund des Anrufes war ein ganz anderer. »Hier spricht Dr. Stern«, verkündete die verdächtig munter klingende Stimme am anderen Ende der Leitung. Haeusserman ließ sich in einen nahen Fauteuil fallen und lauschte im Halbschlaf den brillant gesetzten Worten des Strafverteidigers.
»Mein lieber Hofrat Haeusserman«, hob der alte Stern an, »ich lasse gerade mein Leben Revue passieren. Und da fällt mir ein, dass wir uns jetzt schon seit so vielen Jahren kennen. Da hab ich mir gedacht, es wär doch nett, wir würden uns du sagen.«
Haeusserman war gerührt, fühlte sich geehrt – nur eines konnte er sich beim besten Willen nicht erklären: Warum, um alles in der Welt, musste die Verbrüderung ausgerechnet am Telefon erfolgen.
Und vor allem: zu dieser Stunde!
Wie auch immer, sie riefen einander »Servus, Ernstl« und »Servus, Michael« zu, und als Haeusserman endlich den Hörer auflegen wollte, um die gestörte Nachtruhe wieder aufnehmen zu können, fügte der alte Stern schnell an:
»Ach ja, lieber Ernstl! Weil wir grade so nett miteinander plaudern, hätt ich eine Frage an dich: Hast du noch zwei Karten für den ›Jedermann‹ am nächsten Sonntag?«
Ich lernte Dr. Stern in den siebziger Jahren kennen, als ich eine Zeit lang für den »Kurier« als Gerichtssaalreporter tätig war. Journalisten gegenüber war der alte Stern ausnehmend höflich und entgegenkommend, und natürlich immer darauf bedacht, dass »seine« Prozesse in den Medien den entsprechenden Niederschlag fanden (was dank seiner Prominenz auch meist der Fall war). Aus diesem Grund lud er mich das eine oder andere Mal zum Frühstück in seine Kanzlei ein, die eher einem Kontor aus einem Nestroystück denn einem Büro des 20. Jahrhunderts glich.
Für die Mitarbeiter der Kanzlei Stern war in jenen Tagen die elektrische Schreibmaschine noch nicht erfunden, und wer die Installierung eines Computers vorgeschlagen hätte, wäre vom Chef für verrückt erklärt worden. Der als geizig bekannte Dr. Stern hechelte ständig von einem Büroraum zum anderen, um darauf zu achten, dass sämtliche Lichter abgedreht würden. Ebenso war er darauf erpicht, Papier zu sparen. »Das Kanzleipapier«, lautete einer seiner unverrückbaren Grundsätze, »schneide ich immer in der Mitte durch, weil unten sowieso nichts steht.«
Knausrig war er auch, was das Salär seiner Angestellten betraf. Dabei kam ihm entgegen, dass es jungen Juristen zur Ehre gereichte, beim alten Stern als Konzipienten tätig zu sein, wobei tatsächlich viele seiner ehemaligen Mitarbeiter später berühmte Anwälte wurden, wie etwa der beim alten Stern in die »Lehre« gegangene Strafverteidiger Dr. Herbert Eichenseder.
Dieser war längst ein selbstständiger, überaus erfolgreicher Advokat, als eine Zeitung aus Anlass von Sterns achtzigstem Geburtstag ein Porträt über die Anwaltslegende veröffentlichte. In einem Nebensatz zwar, aber durchaus der Realität entsprechend, erzählte Eichenseder einem Reporter des Blattes, dass ihm sein früherer Chef seit Jahren einen Teil seines letzten Urlaubsgeldes in Höhe von 6783,- Schilling schuldig geblieben sei.
Nach Erscheinen des Berichts rief Dr. Stern seinen ehemaligen Konzipienten an, um ihm mitzuteilen, dass er die Sache selbstverständlich sofort zu bereinigen wünschte. Die beiden trafen einander im Verteidigerzimmer des Wiener Landesgerichts, in dem Eichenseder endlich den seit Jahren offenen Betrag zu erhalten dachte. Der alte Stern freilich ging auf ihn zu, nahm den bedeutend jüngeren Kollegen an der Hand und sagte:
»So, jetzt sind wir per du, und damit ist die Sache erledigt.«
Die für alle Zeiten offen gebliebene Urlaubszahlung änderte nichts daran, dass Stern und Eichenseder etwas später gemeinsam die Verteidigung eines wegen Mordversuchs angeklagten Unterweltlers übernehmen sollten.
Die Anwälte waren redlich darum bemüht, für ihren Mandanten einen Freispruch wegen Notwehr zu erwirken, hatten mit dieser Taktik aber keinen Erfolg. Nachdem er zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, begleiteten Stern und Eichenseder ihren sie wüst beschimpfenden Klienten vom Gerichtssaal zu seiner Zelle im Wiener Landesgericht.
»Zwa Anwält hab i ma g’nommen«, fluchte der Verurteilte. »Und was hat’s bracht’? In Häfen muass i.«
»Was regen Sie sich auf«, versuchte ihn der alte Stern zu beruhigen. »Sechs Jahre für einen Mordversuch, das ist doch ein gutes Urteil.«
Worauf der Gefangene einwandte: »Was heißt sechs – zwölf Jahr hab i kriegt!«
»Ja, aber pro Anwalt!«, erklärte Stern, ehe die Zellentür zwischen ihm und dem Täter ins Schloss fiel.
Ebenso wie für seine Klienten war Dr. Stern auch in eigener Sache rechtskundig tätig. Wegen einer akut aufgetretenen schweren Darmerkrankung ins Spital eingeliefert, verweigerte er gegen den ausdrücklichen Rat des Ärztekonsiliums die Operation und verlangte statt dessen auf dem Wege einer Diät wiederhergestellt zu werden (was in der Tat gelingen sollte).
Als ihn Wochen nach seiner Entlassung eine Rechnung des Lainzer Krankenhauses erreichte, lehnte er es ab, diese zu zahlen. Und er begründete das damit, dass
1.)die Position »Verpflegung« ungerechtfertigt sei, zumal er infolge seines Darmleidens ohnehin nichts essen durfte. Und, dass
2.)das von ihm belegte Einzelzimmer, was Größe, Ausstattung, Komfort und Widmung betraf, eher als Sterbekammer zu bezeichnen wäre, die freilich ihren Zweck insofern nicht erfüllte, als er immer noch am Leben sei.
Nach einem ausgedehnten Schriftwechsel gab sich die Gemeinde Wien geschlagen.
Dr. Stern hatte wieder einmal gewonnen.
Während eines Frühstücks, zu dem ich in die Kanzlei Stern eingeladen wurde, berichtete mir der Chef des Hauses von einer in seiner Glanzzeit, gleich nach dem Krieg, handelnden Geschichte. Damals verteidigte er im Wiener Landesgericht einen Dachdeckergehilfen, der seinen berufsmäßigen Zugang zu Wohnhäusern für ausgedehnte Diebstouren missbraucht hatte. Nachdem Dr. Stern vor Gericht eine Notlagesituation des Angeklagten zu konstruieren versuchte, die man als mildernden Umstand hätte werten können, fragte der Vorsitzende nach dem Wochenverdienst des Dachdeckers. Worauf dieser eine Summe nannte, die den Richter in Erstaunen setzte: »Na hören Sie, das ist ja mehr als mein Monatsgehalt!«
»Natürlich, Herr Rat«, argumentierte der Angeklagte, »aber i arbeit ja auch was!«
Das treffendste Stern-Zitat ist auf seinen Sohn Peter, den sogenannten »jungen Stern«, bezogen, der in jenen Tagen freilich auch schon um die sechzig war, sich aber, wie er selbst bekundete, »diametral vom Vater unterschied«. In Gerichtskreisen munkelte man, mit einem etwas mitleidigen Blick auf den Juniorchef der renommierten Kanzlei, dass »dem alten Stern das Zeugen vor Gericht« meist besser gelungen wäre als im Privatleben.
Als der nun schon 88 Jahre alt gewordene Michael Stern gefragt wurde, wie lang er denn noch als Anwalt tätig sein würde, antwortete er, sorgenvoll in die Zukunft blickend:
»Fünf Jahr muss ich noch arbeiten, bis der Bub in Pension gehen kann.«
Der alte Stern hat dieses Ziel um wenige Monate verfehlt, er lebte (und verteidigte) von da an noch viereinhalb Jahre. Nicht lang genug jedenfalls, um »den Buben in Pension« schicken zu können. Dr. Peter Stern brachte nach dem Tod des Vaters das Kunststück zuwege, die Kanzlei und die vom alten Stern erworbenen Immobilien zu verlieren.
Als einen weiteren »Dr. Sperber« unserer Zeit – wenn auch in ganz anderen wirtschaftlichen Verhältnissen lebend – könnte man den Wiener Rechtsanwalt Dr. Hans Gürtler bezeichnen, dessen Kanzlei nun schon in dritter Generation besteht. Auch viele seiner Konzipienten wurden später berühmte Anwälte, aber bis dahin hatten sie eine harte Schule durchzumachen. Denn während Gürtler seine gefürchtet langen Plädoyers hielt, harrten sie – im Gerichtssaal neben ihm sitzend – des Augenblicks, da er sie aufforderte: »Herr Kollege, bitte machen Sie weiter!«
Das konnte jederzeit und ohne jede Vorankündigung passieren. Wer den Umstieg verschlief, lief Gefahr, Gürtlers Gunst verloren zu haben.
Einer der solchermaßen von ihm geforderten Konzipienten war der spätere Wirtschaftsanwalt Dr. Erich Schröfl. Als dieser einen – zwischen zwei Prozessterminen fixierten – Besuch beim Friseur ankündigte, hielt Gürtler ihn unter Androhung disziplinärer Maßnahmen davon zurück: »Der Besuch eines Friseurladens ist während der Dienstzeit verboten!«
»Aber Herr Doktor«, protestierte Schröfl, »mir sind die Haare ja auch in der Dienstzeit gewachsen.«
Gürtler zeigte sich von der Verteidigungslinie seines Schülers beeindruckt und behielt ihn wohlwollend im Auge.
Neben der Jurisprudenz hatte sich Kanzleigründer Hans Gürtler schon Mitte der dreißiger Jahre ein zweites Standbein geschaffen, als er nämlich nach dem Tod der legendären Anna Sacher deren Hotel vis-à-vis der Wiener Staatsoper kaufte und vor dem Konkurs rettete. Seither befindet sich das Sacher im Besitz der Familie Gürtler.
Franz Sacher – der Erfinder der Sachertorte – hatte durch den Handel mit seiner weltberühmten Süßspeise so viel verdient, dass er jedem seiner beiden Söhne ein Hotel hinterlassen konnte: Eduard erhielt das Wiener Sacher, das später dann seine Witwe Anna führte. Und Carl, der jüngere Sohn, bekam ein in der mondänen Kurstadt Baden gelegenes Hotel. Zwar ist das Wiener Sacher, schon seiner exklusiven Lage wegen, das bekanntere der beiden Quartiere, dafür genießt aber das Badener Sacher den Vorzug, bis zum heutigen Tage im Besitz der Familie Sacher geblieben zu sein.
Das Hotel in Baden wurde in der Besatzungszeit von den Sowjets okkupiert, in entsprechend desolatem Zustand an die Familie zurück gegeben und 1956 als Hotel und Restaurant wieder eröffnet.
Dies aber war der Zeitpunkt, da sich Rechtsanwalt Dr. Hans Gürtler, der Besitzer des Wiener Sacher, zu Wort meldete, um im geschliffenen Juristendeutsch festzuhalten, dass er die Existenz zweier Hotels mit dem Namen Sacher nicht dulden würde. »Ich fordere Sie daher ultimativ auf«, schloss Gürtler seinen Brief an den Enkel des Firmengründers, »Ihrem Hotel in Baden einen anderen Namen zu geben, widrigenfalls ich mir rechtliche Schritte vorbehalte. Hochachtungsvoll Dr. Gürtler.«
Carletto Sacher, der Enkel, las den Brief, nahm ein Blatt Papier zur Hand und antwortete dem berühmten Anwalt: »Sehr geehrter Herr Doktor, auch mir erscheint es unerträglich, dass es zwei Hotels mit dem Namen Sacher geben soll. Ich fordere Sie daher auf: Nennen Sie Ihr Hotel ›Gürtler‹! Hochachtungsvoll Carletto Sacher.«
Seither sind fast fünfzig Jahre ins Land gezogen. Und wie man sieht, vertragen Wien und Baden durchaus zwei Hotels, die den Namen Sacher führen.
Ich selbst hatte mit Anwälten zu tun, als ich in den Vorweihnachtstagen des Jahres 1992 über den spektakulären Grabraub der Mary Vetsera berichtete. Ein Linzer Möbelhändler namens Flatzelsteiner hatte die »Kronen Zeitung« darüber informiert, im »Besitz« der Gebeine der 1889 in Mayerling tragisch verstorbenen Geliebten des Kronprinzen Rudolf zu sein. Der Rest der Geschichte ist Geschichte – der ich aber zwei hierher passende Episoden beifügen möchte.
Nachdem mir Herr Flatzelsteiner erzählt hatte, wie er zum Skelett der Baronesse Vetsera gekommen war, und ich in rund dreiwöchiger Recherche zu der Überzeugung gelangte, dass an der so absurd klingenden Geschichte tatsächlich etwas dran sein könnte, fuhr ich ins Wiener Sicherheitsbüro, um Anzeige wegen Verdachts der Störung der Totenruhe zu erstatten. Man schrieb den 21. Dezember 1992, und die erste Story über den Grabraub war noch nicht erschienen.
Nun lauschten meinen verwegen klingenden Ausführungen der Chef des Sicherheitsbüros Max Edelbacher und einige seiner Mitarbeiter. Ich erzählte von Herrn Flatzelsteiner und von seiner Version, wie er Marys sterbliche Überreste erhalten hätte.
Plötzlich stand ein junger Kriminalbeamter auf, um das Zimmer zu verlassen und nach wenigen Minuten mit einer Fahndungsliste in den Händen zurückzukehren.
»Herr Markus«, sagte er mit strengem Blick, »das ist ja alles schön und gut, was Sie uns da erzählen. Aber ich habe gerade im Polizeicomputer nachgeschaut: Eine Mary Vetsera ist gar nicht als abgängig gemeldet.«
Der junge und in den Geschichtswissenschaften nicht eben sattelfeste Polizeibeamte sollte anderntags aus der Zeitung erfahren, wer Mary Vetsera war. Und dass der Zeitpunkt ihrer »Abgängigkeit« schon ein paar Jährchen zurücklag.
Um aber zur eigentlichen Anwaltsgeschichte in der Causa Flatzelsteiner zu kommen: Fernsehteams und Zeitungsreporter aus ganz Europa waren nach Wien geeilt, um über die skurrile Story zu berichten, vor allem aber wurde der Fall zum Fressen für die österreichischen Medien, die zum Teil anzweifelten, ob Herr Flatzelsteiner tatsächlich nur Informant oder nicht doch der eigentliche Täter – der Grabräuber – gewesen sei.
Als wieder einmal in einer Zeitung ein sehr böser Artikel über Herrn Flatzelsteiner erschien, riet ich ihm, die Vorwürfe – sollte er wirklich unschuldig sein, wie er immer behauptete – nicht länger auf sich sitzen zu lassen. »Da müssen Sie schon Ihren Anwalt einschalten«, sagte ich.
Worauf mir Herr Flatzelsteiner mitteilte: »Das geht leider nicht!«
»Warum?«, fragte ich erstaunt.
Herr Flatzelsteiner gab nun eine Antwort, mit der am allerwenigsten zu rechnen war: »Weil sich mein Anwalt nicht aufregen darf.«
Tatsächlich war Flatzelsteiners Linzer Rechtsanwalt Dr. Johannes Worm herzkrank (und musste sich sogar einer Herztransplantation unterziehen).
Als sich später herausstellte, dass Herr Flatzelsteiner nicht ganz so unschuldig war, wie er bislang erklärt hatte, nahm er sich doch noch einen Rechtsanwalt.
Einen, der sich auch aufregen durfte.