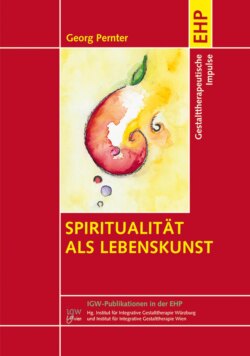Читать книгу Spiritualität als Lebenskunst - Georg Pernter - Страница 10
ОглавлениеEinleitung: Welche Farbe hat der Wind?
»Wir brauchen eine Therapie,
in der die Lebendigkeit gesucht und gefördert wird,
in der die Lebendigkeit geweckt wird«
(Willi Butollo 1996, 60)
»Nicht Wissen um des Wissens, sondern um des Lebenswissens willen,
um Einblick in die Grundstrukturen des Lebens und der Welt,
der geschichtlichen Herkunft und gesellschaftlichen Gegenwart zu gewinnen.«
(Wilhelm Schmid 2007, 437)
»Ich habe keine Lehre. Ich zeige nur etwas. Ich zeige Wirklichkeit,
ich zeige etwas an der Wirklichkeit, was nicht oder zu wenig gesehen worden ist.
Ich nehme ihn, der mir zuhört, an der Hand und führe ihn zum Fenster.
Ich stoße das Fenster auf und zeige hinaus.
Ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch.«
(Martin Buber 1962, 1114, zit. n. Zahrnt 1989, 120)
Spiritualität, ein »luftiges« Phänomen – für viele ist Spiritualität eine »terra incognita«. Eine Wüste. Ein Fass ohne Boden. Nicht greifbar. Vergleichbar ist Spiritualität mit dem »Wind, den man zwar spüren, aber nicht ergreifen kann« (Nye 1999, zit. n. Bucher 2007, 21). »Welche Farbe hat der Wind?« (Perls 1981, 118) ist jener Koan, den Fritz Perls, einer der Begründer der Gestalttherapie, von seinem Zenmeister erhalten hatte. Und dieser war hoch zufrieden mit Perls’ Lösung, als er nämlich den Meister einfach anhauchte und so wortlos ausdrückte: »Diese Farbe hätte der Wind …«.
Dem »Wind« mehr Farbe zu geben, ist das Anliegen dieses Buches: Farben, die erkennbar sind und nach mehr Leben schmecken … Vielleicht mag es für manche ein Wind werden, für andere bloß ein altes Lüftchen bleiben. »Aber ich weiß, dass unsichtbar nicht verschwunden heißt.« (Divakaruni, 2001, 85) Ein Gespräch möchte ich führen mit denen, die sich dafür interessieren. Keinen fertigen Monolog halten, auch wenn das bei einem Buch ein ganz eigener »Dialog« sein wird.
»Nichts Neues unter der Sonne« – so lautet ein altes romanisches Diktum. Muss man das Rad neu erfinden, wenn es bereits gute Erfahrungen gibt? Neu in diesem Buch kann man das Bemühen sehen, eine alltagsbezogene Spiritualität zu formulieren mit dem Anspruch, Menschen ehrlich zu begegnen und in ihrer Sprache jene Fragen zu formulieren, welche die alten Fragen der spirituellen Suche(r) sind. Das ist ein freundschaftlicher Austausch, eine gegenseitige Bereicherung. Mein Wunsch ist es, dass dabei die »Hymne an den unbekannten Gott« (Sam Keen) und an das Leben hier auf dieser Welt gelingt und Feuer nicht nur im Bauch, sondern auch im Kopf und in den Füßen entfacht wird.1 Ist das Leben – überspitzt formuliert – nicht zu kurz, um in jahrelanger mühevoller Arbeit auf dem Sitzkissen auszuharren und auf persönliche Erleuchtung zu warten?
Spiritualität ist Vielfalt. Ich bekenne vorab: Ich habe einiges an spirituellen Ausdrucksmöglichkeiten ausprobiert. Dabei habe ich viel gelernt: Die Fröhlichkeit und den Witz in »tiefgehenden«, auch ernsten religiösen Ritualen bei Indianern, das strenge Ausharren im Sitzen und die lauschende (nicht immer friedliche) Stille in der Kontemplation, die achtsame Awareness und Fokussiertheit auf den Augenblick im Zen, die Bewegung und Ausgerichtetheit bei den Sufis, die Wiederentdeckung der Natur, ihre erfrischende Belebung und Inspiration durch Franziskus, eine berührende Sinnlichkeit in einem umsichtigen Tantra, die Zentrierung und das körperlich-heilsame Eintreten in ein räumlich-leibhaftiges Mantra im Sacred Dance …
Es geht mir hier um ein Plädoyer für eine Ausprägung vielgestaltiger Formen von persönlicher Spiritualität. Eine solche hat das realistische Wachstum des Menschen im Sinne und lässt Persönlichkeitsentwicklung zu. In der Achtung vor der Vielgestaltigkeit menschlicher Lebenswege geht es um das Finden, Erkennen, Umsetzen von verschiedenen Ausdrucksformen: je nach Charakter, Lebensphase, Befindlichkeit, Anforderungen, Bedürfnissen.
Spiritualität, Therapie, Lebenskunst. Ein ungewöhnliches Trio? Das Projekt, Spiritualität und Therapie zusammenzubringen, steht vor dem prinzipiellen Problem, von Experten verschiedenster Fach-Disziplinen argwöhnisch oder skeptisch betrachtet zu werden. In meinem Falle werden das Psychologen sein oder Theologen oder selbsternannte »Spiri«-Gurus (vgl. Bucher 2007, 6).
Ich schlage hier einen gut begründbaren Weg ein. Beide, Therapie wie Spiritualität, haben meines Erachtens nämlich ein gemeinsames Ziel und Grundanliegen, unabhängig von den erreichten Bewusstseinsstufen und der Tiefe des Erlebten. Denn schließlich – auch dies ist ein Grundtenor seriöser spiritueller Ansätze – geht es um das Sein in dieser Welt. Spiritualität muss sich im Alltag, beim Einzelnen, in seinem Lebens-Zeit-Fenster bewähren. Dort hat sie ihren – wenn ich es theologisch ausdrücke – »Sitz im Leben«. In Therapie und Spiritualität geht es letztlich um Lebenskunst. Dies ist ein alter, nun wieder populär gewordener Begriff. Die Kunst, gut zu leben, hat u.a. Wilhelm Schmid, der Berliner Philosoph und philosophische Seelsorger (!), in seinen Büchern einem breiten Publikum ausführlich und kenntnisreich dargestellt (Schmid 1998 und 2007). Hier möchte ich anknüpfen.
Es geht mir um eine persönliche, um individuelle Spiritualität, die vom Begriff her nicht notwendigerweise oder a priori traditionelle Religion oder ein personales, konfessionell verankertes Gottesverständnis voraussetzt, wohl aber den Gedanken, die Annahme einer letzten, tragenden Macht, etwa im Sinne des »Numinosen« bei Otto Rudolf (1927) oder des »Ultimaten« bei Oser und Gmünder (1984) zulässt. Ich denke, dass sich mein Ansatz ebenso mit einer »Spiritualität ohne Gott« im Sinne des französischen Philosophen André Comte-Sponville (2008) gut verträgt. Spiritualität ist eine Lebenshaltung, die mit transzendenter Wirklichkeit rechnet bzw. auch darauf ausgerichtet ist oder auch nicht.
Das Buch beginnt mit ganz persönlichen, satirischen Gedankensplittern zum umfangreichen Themenkomplex »Psychotherapie – Gestalttherapie – Religion – Spiritualität«. Diese Fragmente spiegeln meinen ersten Reflexionsstandpunkt im weiten Feld von Spiritualität wider und fußen auf meinen Erfahrungen als ehemaliger Buchhändler (in einem ganz besonderen Laden) und als Mitarbeiter eines Zentrums, das sich der Integration von Spiritualität und Therapie verschrieben hat. Darauf folgt eine überblicksartige Einleitung zum Thema Spiritualität im postsäkularen Zeitalter.
Im zweiten Teil geht es um eine Kennzeichnung und »Definition« von Spiritualität und dann um eine inhaltliche Konkretisierung im Hinblick auf therapeutische Arbeit.
Den dritten großen Abschnitt widme ich verschiedenen Sichtweisen von Psychotherapie und Spiritualität sowie einigen Hinweisen auf empirische Studien. Spiritualität ist eine Ressource, wenngleich amerikanische Studien damit mitunter lediglich den Kirchgang messen und die Ausgangslage alles andere als übersichtlich ist. Daran anschließend kommen spirituelle Wirkfaktoren im therapeutischen Raum zur Sprache, die Hundt (2007) in einer empirischen Studie herausgearbeitet hat. Sie sollen aufzeigen, dass spirituelle Therapie ganz schlicht mit dem »Wunderbaren« (Schellenbaum) umgeht, dass kein Klamauk und Brimborium veranstaltet werden muss, nur weil von Spiritualität die Rede geht.
Der vierte Teil nähert sich der Gestalttherapie. Mit dem Begriff »Lebenskunst« glaube ich, eine gute Verbindung gefunden zu haben, ein gemeinsames Feld, in dem Spiritualität und Gestalttherapie sich finden und aufeinander treffen können. In der Kunst des Lebens, die sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht, treffen sich meines Erachtens beide Ansätze am besten.
Im fünften Teil ist der Fokus auf Gestalttherapie und eine offene Spiritualität gerichtet. Auch hier ist lange noch nicht alles ausformuliert. Es geht um die Richtung. Denn nicht das Ziel ist hier wichtig, sondern, wie es einmal der Wiener Gestalttherapeut Alfred Grillmeier sinngemäß formuliert hat, »in der Wüste muss nur die Richtung stimmen, da sich Ziele oft als bloße Fata Morgana erweisen und dir alles vorgaukeln können«.
Die Abbildungen stellen eine graphische Übersicht dar, die das Thema kurz zu umreißen versuchen und auf einer anderen Ebene das verdeutlichen, worum es geht. Sie sind bewusst vereinfachend; diesbezüglich gilt auch hier zu beachten, was Korzybski in ein Bonmot gefasst hat: »Die Landkarte ist nicht das Territorium.« (zit. n. Yontef 1999, 230)
Die vorangestellten Zitate aus unterschiedlichen Quellen sind zum einen Leitmotive für die betreffenden Absätze, zum anderen als Motto, das ich verfolge, gedacht. Manchmal sind sie einfach nur prägnante Sätze, die in ihrer Essenz das Thema aufreißen oder sich wie ein Kontrabass durchziehen.
»Sehnsucht nach Mehr leben – Sehnsucht nach mehr Leben.« So lautete das Manuskript, das als Vorlage für dieses Buch diente. Es ist nicht bloß in theoretischer, professoraler Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Literatur im stillen Kämmerlein entstanden, sondern stellte eine Reflexion meiner Praxisarbeit mit Klientinnen und Klienten und des Umfeldes dar, in dem ich gearbeitet hatte.
Klarzustellen ist: Spiritualität soll keinesfalls dafür herhalten müssen, die eigene therapeutische Unprofessionalität zu kaschieren. Ich hoffe, mögliche Bedenken von Kollegen und Kolleginnen zerstreuen zu können, dass durch den Einbezug von Spiritualität Gestalttherapie ihrer Vitalität und ihrer therapeutischen Effizienz beraubt wird. Von den relativ jungen Anfängen bis in die Gegenwart hinein wurde Gestalttherapie immer wieder mit Spiritualität verknüpft. Oftmals jedoch zu kurzsichtig. Der Verweis auf Fritz Perls, der irgendwann im Verlauf seines Lebens eine Zen-Shessin gemacht hat, genügt nicht, um Gestalttherapie und Spiritualität miteinander zu verbinden. Im Übrigen war seine Replik darauf äußerst abschätzig. In der mir vorliegenden gestalttherapeutischen Literatur wird Spiritualität eigentlich nie begrifflich definiert. Oft wird mit Spiritualität bedingungsoder kritiklos ein mystischer Weg verstanden. Das ist meines Erachtens nicht unbedingt notwendig bzw. ein gedanklicher Kurzschluss. Spiritualität ist mehr als ein konkreter spiritueller Weg. Andersherum: Der Begriff »Spiritualität« ist weiter angesetzt und nicht ausschließlich auf Mystik beschränkt bzw. bloß für diese reserviert.
Mein Anliegen ist es, eine ganz »alltäglich-gewöhnliche« Spiritualität aufzuzeigen, die Leben durchdringt und zu Ganzheit und Lebendigkeit inspiriert.
Abgrenzungen und Eingrenzungen. Spiritualität ist ein weites Feld, auch Gestalttherapie. Die Vielschichtigkeit und Komplexität des Themas erfordert für die Zukunft ein verstärktes interdisziplinäres Vorgehen. Ansätze sind bereits sichtbar: Kongresse, Buchprojekte u.a. Ich führe keinen expliziten Dialog mit philosophischen Bemühungen um Transzendenz-Erfahrungen, obgleich mir ein solcher Austausch fruchtbar erscheint, gerade im Hinblick auf den Ansatz von Spiritualität, den ich hier vorlege.
Während der Lektüre, nicht nur im Rahmen dieser Arbeit, haben Ausführungen über Spiritualität bei mir einen eigenen »Geschmack« hinterlassen. Sie mundeten nicht, weil zu kompliziert, zu abgehoben, zu lebensfremd und teilweise sogar lebensfeindlich.
Auch gebe ich keinen konkreten mystischen, spirituellen Weg vor. Es gibt »keinen« Weg. Anders ausgedrückt: Viele »Wege führen nach Rom«, wussten schon die Römer. Viele Wege führen zum »großen Geheimnis« (indianisch), zu Gott (jüdisch-christlich), zu Allah (islamisch), zum Nichts, in den Pantheon … Und daneben: Spiritualität ist immer auch ein individueller Weg zu mir, zur Umgebung, zu Menschen.
Danke. An erster Stelle danke ich meiner Frau Traudi, die das Buch im Hintergrund mitgetragen, ausgehalten und für die notwendige Lebenskunst im Familienalltag gesorgt hat. Ich danke dem IGW (Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg/Wien): Werner Gill für die Unterstützung und Ermutigung, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Ich hoffe, dass mein Buch ein wenig jene vielfältig-tiefe Weite atmet, die ich bei dir kennengelernt habe. Betrachte dich als Vater dieses Buches, du hattest die Idee dazu. Was daraus geworden ist, das geht auf meine Kappe … Danke auch an Almut Ladisich-Raine für den persönlichen Raum und den support in der Supervision in den vergangenen Jahren, auch für den Esprit sowie das Feedback samt Verbesserungsvorschlägen v. a. zu Kapitel 5, nicht zuletzt für das Gestalt-Archiv (Gestalttherapie-Zeitschriften) und das Vorwort. Anne Haberzettl für das Darauf-Pochen, fertig zu schreiben und Peter Toebe für die freundliche Aufnahme des ursprünglichen Manuskriptes (ein Fest nach langem Zittern). Für mündliche, wohlwollende Rückmeldungen sowie die einleitenden Worte schulde ich weiters dem Herausgeber Peter Schulthess ein Dankeschön.
Viele Menschen haben einen Beitrag zum Buch geleistet: Meine ersten Korrektorinnen und Seminarpartnerinnen: Ulrike F.M. Mair und Uta Platter, die die Rohfassung des Buches bereitwillig Blatt für Blatt durchnahmen und Jagd machten auf Stilunsicherheiten und inhaltliche Unklarheiten. Für kritische Durchsicht und Ordnung sorgte weiters meine Schwester Marianna Pernter (Kap. 1). Das Endlektorat besorgte mit viel Liebe und Engagement Petra Tappeiner (dich als Lektorin hat buchstäblich der Himmel geschickt!). Die Graphiken besorgten Michael Stauder und Claudia Frass, Profis und Freunde von »freigeist« in Bozen. Dem Zentrum Tau in Kaltern danke ich für etliche Bücher, die ich der Bibliothek entwendet habe. Euch allen und euch Ungenannten: Herzlich Danke in tiefer Verbundenheit. »Schreib ein lesbares Buch« – tönte es aus allen Ecken. Ich wünsche mir, dass dies gelungen ist.
Zu guter Letzt ein Danke dem Verleger Andreas Kohlhage. Ohne EHP gäbe es »Spiritualität als Lebenskunst« am Buchmarkt nicht. Danke für die Ermutigung, im Endstadium nicht locker zu lassen und die Bereitschaft, dieses Projekt umzusetzen.
»Müde bin ich, geh zur Ruh« – »Schutzengele mein«. Weit spannt sich der Bogen von meinen Kindergebeten über die katholische Erziehung, dem hoffnungslos überfordernden Bemühen im Bischöflichen Knabeninternat ein guter Christ zu werden …, weiter zum kreativen, ganzheitlichen Erlebnisraum Musical bis hin zu allerlei spirituellen Ausflügen und dann zur Gestalttherapie, immer im Bestreben nach MEHR Lebendigkeit, nach Leben und Verbundenheit.
Bozen, Herbst 2008