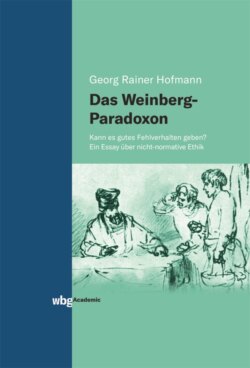Читать книгу Das Weinberg-Paradoxon - Georg Rainer Hofmann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Prolog motiviert und erläutert, wovon die Rede ist
ОглавлениеDie Frage „Was soll ich tun?“ ist die zentrale Daseinsfrage für den Menschen. Das Planen und die Sorge um das richtige und gute Tun sind für die praktische Lebensgestaltung äußerst bedeutsam.
Die Leserschaft weiß, dass die genannte Frage von der Disziplin der Ethik beantwortet wird, beziehungsweise beantwortet werden sollte. Die Ethik versucht seit Anbeginn der Zivilisation, das richtige und das gute Handeln (den oder das Ethos – aus dem Griechischen εθος „Wesen, Charakter“ und ηθος „Sitte, Brauch, Gewohnheit“) so in Normen zu fassen, dass man den damit definierten ethischen Vorgaben in der Lebenspraxis folgen kann.
Die normativen Vorgaben können explizit formuliert werden; es sind Verhaltensregeln, herrschaftliche Gesetze und religiöse Gebote. Oder es werden konkrete vorbildliche Personen identifiziert, deren Verhalten als implizite Orientierung für das sogenannte „richtige Tun“ dienen kann. Aktuell erscheinen ethische Normen auch in Gestalt von normativ wirkenden Maschinen und digitalen Automaten, Algorithmen und Prozessen, die den Menschen zum „richtigen“ Handeln anleiten – oder ihn gar dazu zwingen.
Wird gegen solche normativen Vorgaben verstoßen, so ist von „Fehlverhalten“ die Rede. Das Fehlverhalten erscheint im Alltag in vielfältiger Form: als Verbrechen, Missetat, Vergehen, Ordnungswidrigkeit, Frevel, Sünde, Lapsus, schlechtes Benehmen etc. pp.
Wir wollen uns nun der Problemstellung „Warum sich das gute Handeln nicht vollständig durch Gesetze und Gebote regeln lässt“ mit vier Leitfragen nähern, um quasi die „Grenzen“ der formalen Gesetze und Gebote für das gute Handeln zu erkennen. Diese Fragen sind:
1. Ist der Mensch in der Lage, gute Taten zu vollbringen?
2. Lassen sich als „gut“ erkannte Handlungen in ethische Normen fassen und beschreiben?
3. Kann das konsequente Befolgen einer „Norm des richtigen Tuns“ ungute Folgen haben?
4. Lassen sich die als „gut“ erkannten Handlungen durch Normen vollständig beschreiben?
Die beiden ersten Fragen haben ziemlich triviale Antworten, auch die Antwort auf die dritte Frage erschließt sich aus der Alltagserfahrung und der juristischen Praxis relativ schnell.
Die Antwort auf die vierte Frage ist nicht so ganz einfach – sie ist der Gegenstand unseres eigentlichen Interesses. Wir wollen zeigen, dass sich das gute Handeln nicht komplett durch Gebote und Gesetze fassen lässt. Die Frage „Was soll ich tun?“ ist – normativ – nicht abschließend zu beantworten.
Leitfrage 1: Ist der Mensch in der Lage, gute Taten zu vollbringen? Das ist trivialerweise zu bejahen: Der zivilisierte Mensch kann Hilfeleistungen für andere Menschen erbringen, Wohltaten leisten, Almosen geben, Nutzen stiften, einen ehrenden und respektvollen Umgang pflegen – diese und andere Handlungen wird man unbestreitbar als „gute Taten“ einordnen. Mathematisch gesprochen gibt es eine „Menge der guten Taten“ als eine Teilmenge aller Handlungen, die dem Menschen möglich sind.
Man mag einwenden, dass man die Eigenschaft „gut“ für die Elemente der „Menge der guten Taten“ zunächst genau definieren müsste, damit diese Menge eine präzise Gestalt erhalten könnte. Aber wir wollen uns zunächst lediglich auf den Aspekt konzentrieren, dass diese „Menge der guten Taten“ eine Teilmenge aller möglichen Taten ist. Das kann man mit der Situation vergleichen, wenn Grundschüler im Unterricht zur Mengenlehre aus einer Grundmenge von bunten Bauklötzchen die „Menge aller roten Bauklötzchen“ selektieren sollen. Es mag Streitfälle geben, ob violette und rosafarbene Klötzchen noch zu den „Roten“ zu zählen wären. Die Existenz einer Teilmenge „Menge aller roten Bauklötzchen“ als solcher ist trotzdem nicht zu bestreiten.
Leitfrage 2: Lassen sich als „gut“ erkannte Handlungen in ethische Normen fassen und beschreiben? Dies ist wiederum trivialerweise zu bejahen: Das richtige Tun wird durch Normen – wie Gebote, Gesetze, Verordnungen, Sitten, standardisierte Prozesse und dergleichen – beschrieben. Mit solchen Normen versucht der Mensch seit vielen Jahrhunderten, die „normativ richtigen Taten“ zu definieren. Die richtigen Taten sind das den ethischen Normen entsprechende Handeln.
Wir können von einer „Menge der normativ beschreibbaren guten Taten“ reden, die wiederum eine Teilmenge aller möglichen Handlungen ist.
Leitfrage 3: Kann das konsequente Befolgen einer „Norm des richtigen Tuns“ auch ungute Folgen haben? Die Alltagserfahrung und die juristische Praxis bejahen diese Frage. Ein der ethischen Norm und dem geltenden Gesetz entsprechendes – und dahingehend „richtiges“ – Verhalten kann anderen Menschen allerdings schaden. Dieser Umstand wurde bereits in der Antike erkannt und beschrieben. Bei Markus, Kapitel 12, Verse 38 bis 40, werden Angehörige des – der Norm genügenden – Establishments scharf kritisiert, wir lesen in deutscher Übersetzung:
[…] Hütet euch vor den Akademikern, die in feinen Kleidern herumlaufen und in der Öffentlichkeit jeden freundlich grüßen. Diese sitzen in der Synagoge ganz vorne und haben bei Empfängen immer die besten Plätze. Sie sprechen scheinheilig lange Gebete – aber sie fressen den Witwen die Häuser weg: Diese Leute werden über die Maßen verurteilt werden.
Diese Verurteilung adressiert den damaligen Akademiker (den Schrift- und damit Gesetzkundigen γραμματικος – grammatikos), als Angehörigen des herrschenden politisch-normativen Systems. Im Allgemeinen können Normen, die bedingungslos und unabhängig von ihren Konsequenzen formuliert wurden, in konkreten Situationen absurd oder gar schädlich sein. Beispielsweise trifft die juristisch korrekte Anwendung von massenhaften Abmahnungen zum Teil auf Unverständnis in der Gesellschaft. Klassisch ist auch das normative Verletzungs- und Tötungsverbot zu nennen, das zum Beispiel für Polizeikräfte relativiert werden muss, wenn es gilt, einen bewaffneten Verbrecher zu bekämpfen.
Auch automatische Prozesse, in bester Absicht konstruiert und realisiert, können in konkreten Situationen mit neu auftretenden Randbedingungen den Menschen schaden. Als Beispiel könnten Navigationssysteme und Autopiloten genannt werden, bei denen bestimmte Situationen im normativ wirksamen Programm nicht berücksichtigt wurden und die dadurch – im schlimmsten Fall – ein Flugzeug zum Absturz bringen könnten.
Man könnte sagen, dass die „Menge der normativ beschreibbaren guten Taten“ ihren Gegenstand nicht genau trifft, wenn die gut gemeinten Normen auch solche Taten zulassen können, die als alles andere als „gut“ zu bezeichnen wären. Die systematische Beantwortung der Frage 3 ist der Gegenstand der Normenkritik. Die Normenkritik hat die Aufgabe, negative Folgen von Normen aufzuspüren und zu eliminieren. Dazu erweitert und korrigiert sie bestehende Normen, oder sie schafft neue bessere Normen. Das Ziel der Normenkritik ist es, die „Normen des richtigen Tuns“ so zu verbessern, dass sie – künftig – möglichst keine unerwünschten „unguten“ Taten mehr umfassen oder zulassen. Wir werden sehen, dass die Normenkritik ihr Endziel – das Schaffen einer dahingehend perfekten ethischen Norm – nicht erreichen kann.
Leitfrage 4, eine Erweiterung von Frage 2: Lassen sich die als „gut“ erkannten Handlungen durch Normen vollständig beschreiben? Wir werden im Zuge unserer Überlegungen sehen, dass diese Frage in der Tat zu verneinen ist. Aufbauend auf der Erörterung des Weinberg-Paradoxons wollen wir zeigen, dass es kein komplettes und vollständiges Modell des Guten geben kann – das gute Handeln lässt sich nicht in seiner Gesamtheit normativ erfassen. Das Weinberg-Paradoxon ist allerdings kein singuläres Beispiel eines Widerspruchsbeweises, wir finden eine ganze Reihe weiterer ähnlicher Paradoxa in der Literatur und im Alltag. Die hypothetische Menge der „Normen des guten Tuns“ – jede normative Ethik – ist insofern unvollständig. Es gibt gutes Handeln, das sich einer Normierung durch Gebote und Gesetze entzieht.
Die Normenkritik versucht zwar einerseits, bestehende Normen zu verbessern und zu erneuern. Andererseits: Wenn notwendiges gutes Handeln von den Normen nicht vollständig beschrieben und erfasst werden kann, dann sehen wir die humanitäre Notwendigkeit einer nicht-normativen Ergänzung der Normen – das ist der Gegenstand einer nicht-normativen Ethik. Bei Matthäus, Kapitel 5, Vers 17 bis 20, lesen wir als zentrales Anliegen eines humanitären anthropozentrischen Programms, das Jesus von Nazareth selbst zugeschrieben wird:
Ich bin nicht gekommen das Gesetz zu zerstören, sondern vielmehr, um es zu ergänzen. Es wäre falsch, von mir anzunehmen, dass ich kam, um das Gesetz oder die Propheten anzuzweifeln. […] Nicht ein einziger winziger Buchstabe oder ein einziges Satzzeichen wird im Gesetz gelöscht werden. […] Ich sage euch aber: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weiter reicht als das Gesetz der Schriftkundigen und der Pharisäer, so werdet ihr das himmlische Reich hier auf der Erde nicht erleben.
Man sollte erkennen können: Der Ethos des guten Handelns ist nicht per definitionem normativ! Wir wollen in der Folge zeigen, dass die „Gesamt-Ethik“ einer anthropozentrischen humanitären Zivilisation über die Normen der Gebote und Gesetze des guten Tuns hinaus der Ergänzung – durch eine nicht-normative Ethik – bedarf.
Um die nicht-normative Ethik zu erläutern, greifen wir in unseren Überlegungen einige maßgebende – literarische und reale – Beispiele auf. Sie zeigen, dass das Phänomen des nicht-normativ fassbaren guten Handelns quasi „schon immer“ von Interesse war: Die griechische Tragödie kannte es bereits, und wir sehen Jesus von Nazareth als praktischen Philosophen, von dem die Parabel mit dem Weinberg-Paradoxon stammt.
Einige Bezüge der nicht-normativen Ethik zum Alltag und zur politischen Debatte der Jetztzeit sind absolut evident und werden ebenfalls dargelegt und erörtert.
Im vorliegenden Essay wird allerdings auf „wissenschaftliche Lesehemmnisse“ wie Zitate, Fußnoten, Originalzitate in Fremdsprachen etc. weitgehend verzichtet. Für Interessierte wird insbesondere auf die Abhandlung Impulse nicht-normativer Ethik für die Ökonomie verwiesen – sie und weitere wissenschaftliche Literatur zum Weiterlesen sind im Anhang aufgelistet; die Referenzen können leicht aus dem Text erschlossen werden.
Es ist zu hoffen, dass die Leserschaft das Bemühen um nachvollziehbare Formulierungen und separat lesbare Kapitel zu schätzen weiß. Die Ausführungen und Folgerungen sind eigentlich sehr selbstverständlich und naheliegend. Bei der Lektüre dürfte man sich durchaus an ähnliche eigene Gedanken erinnert sehen.