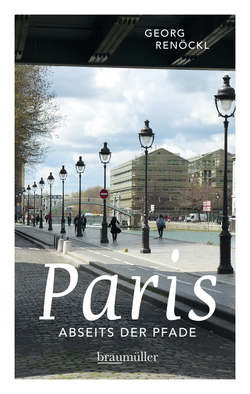Читать книгу Paris abseits der Pfade (Jumboband) - Georg Renöckl - Страница 10
JEAN-LOUIS WINNEBROOTS KABELJAU IN CHORIZO-SAUCE
ОглавлениеMan braucht für vier Personen ein etwa 15 Zentimeter langes Stück von einer weichen Chorizo-Wurst mit eher geringem Durchmesser (gut zwei Zentimeter – in Frankreich sehr gängig, bei uns etwas schwerer zu bekommen). Diese häuten und in feine Scheiben schneiden. In etwa einen halben Liter Obers geben und dieses auf die Hälfte reduzierend einkochen – ein einfacher Trick, der die Schärfe der Wurst mildert und eine würzige, dichte Sauce entstehen lässt.
Ein schönes Stück vom Kabeljaurücken mit Olivenöl beträufeln, salzen und mit etwas Fischfond und Weißwein zehn Minuten im Rohr garen. Keinesfalls zu lange im Rohr lassen – zerkocht wird der Fisch bröckelig und trocken, es wäre schade drum! Den Fisch mit der Chorizo-Sauce auf Tellern anrichten.
Dazu gab es Ratatouille und Karottenpüree, auch das geht nach Gefühl: Für die Ratatouille sechs der sieben typischen Gemüsesorten (Melanzani, Zucchini, Zwiebel, drei verschiedenfarbige Paprika) in Würfel schneiden und einzeln braten, bis sie weich sind. Zum Schluss mischen und geschälte, entkernte Tomaten dazugeben, aufkochen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Für das Karottenpüree braucht es Karotten, Butter, Milch, Salz und Pfeffer. Wie viel in etwa? Jean-Louis erklärt kryptisch: Keinesfalls mit der Butter sparen, die Milchmenge richtet sich danach, ob man es mit zarten Frühlings- oder zähen Winterkarotten zu tun hat. Ganz wichtig: Ausreichend pfeffern, sonst schmeckt es wie Babybrei. Im Gegensatz zu Kartoffelpüree, das mit dem Pürierstab gemixt zu Kleister wird, kann man hier ohne Probleme den Stabmixer verwenden.
Das war es schon. Der kleine Brotkorb, der in Frankreich wie auch Leitungswasser, Salz und Pfeffer von Gesetzes wegen gratis auf dem Tisch steht und auf Verlangen jederzeit nachgefüllt werden muss, erspart französischen Köchen die bei uns stets vorhandene „Sättigungsbeilage“.
Gut gelaunt spaziere ich in Richtung Saint-Eustache weiter, dieser riesigen, von außen immer etwas unfertig aussehenden, gotisch anmutenden Renaissance-Kirche am Rande des alten Marktplatzes. So schwer sie von außen zu fassen ist, so großartig ist diese Kirche von innen: Das Raumgefühl ist einzigartig, die behäbige Riesenkirche wirkt plötzlich wunderbar leicht, ihr helles Gewölbe – das höher ist als das von Notre-Dame – zieht einen förmlich nach oben.
Nach der Kirche geht es in der Rue Montorgueil weiter. „Hochmutsberg“ würde die deutsche Übersetzung in etwa lauten, ein schön selbstironischer Name: Der Hügel, zu dem die Straße führt, besteht aus nichts anderem als aus dem Müll, der sich einst vor der Stadtmauer türmte. Diese hatte König Philippe Auguste am Ende des zwölften Jahrhunderts zur Verteidigung der Hauptstadt anlegen lassen – Gefahr drohte von den Engländern, die auch über die nahe Normandie herrschten. Von Philippe Augustes Mauer sind heute noch einige Spuren im Pariser Stadtbild erhalten, und eben auch der mittelalterliche Müllberg, in dessen Richtung ich jetzt aufbreche. Die Rue Montorgueil zählt seit jeher zu den gastronomischen Lebensadern der Metropole: Über diese Straße, die weiter stadtauswärts Rue Poissonnière heißt, also Fischhändlerinnenstraße, wurden, als man die Engländer endlich aus dem Land geworfen hatte, Fisch und Meeresfrüchte von der etwa zweihundert Kilometer entfernten Küste der Normandie in die stets hungrige Hauptstadt transportiert.
Zwischen den zahlreichen Fischhändlern siedelten sich weitere „métiers de bouche“ an, „Mundberufe“, wie man so schön auf Französisch sagt: Fleischer, Obst- und Gemüsehändler, Bäcker … darunter auch Institutionen wie die Pâtisserie Stohrer, 1730 von einem polnischen Pâtissier eröffnet, der sein Handwerk im Elsass vervollkommnete, wo der polnische König Stanislaus nach der Teilung seines Landes im Exil lebte. Der Pâtissier folgte der Tochter seines Königs, als diese den französischen Thronfolger Ludwig XV. heiratete, nach Versailles und später nach Paris. Dort machte er das heute noch klassische Dessert „Baba au rhum“ bekannt (ja, nach dem in Rum getränkten Kuchen ist bei Asterix ein Römerlager benannt). 1864 wurde das Geschäftslokal von Paul Baudry so gestaltet, wie es heute noch aussieht. Man kann also kunsthistorisches Interesse vortäuschen, wenn man die legendäre Pâtisserie betritt, wird sie aber kaum wieder verlassen, ohne zumindest ein Éclair gekauft zu haben. Ich mochte diese länglichen, wegen ihrer Cremefüllung oft etwas „aufgeweichten“ Brandteigkrapfen früher nicht so, ließ mich aber längst durch ein Schokolade-Éclair von Stohrer bekehren.
Renaissance-Kirche Saint-Eustache
Zumindest eines der einst zahlreichen großen Fischgeschäfte liegt schräg gegenüber der Pâtisserie Stohrer, und auch das legendäre Restaurant Au Rocher de Cancale ist in Sichtweite, wenn mich auch die hellblaue Farbe und die frisch renovierte, viel zu glatte Fassade irritieren – das leicht verwitterte Äußere von früher fand ich passender. 1846 wurde das aktuelle Restaurant neu eröffnet, das viel ältere Vorgängerlokal gleichen Namens war von Balzac in zahlreichen Romanen verewigt worden. Ein Koch namens Langlais kreierte darin die „sole à la normande“, „normannische Seezunge“, ein Fischgericht mit vielen Meeresfrüchten und – wie alles, das mit dem Adjektiv „normannisch“ geschmückt wird – reichlich Obers. Wir verdanken das heute als typisch normannisch geltende Gericht dem romantischen neunzehnten Jahrhundert und seinem Bedürfnis nach Folklore, die es im Regelfall an Ort und Stelle gar nicht gab. So baute man allerorts Pseudoruinen, rekonstruierte verfallene Ritterburgen, erfand „uralte“ Trachten vom Schottenrock bis zum Steireranzug und dachte sich „typische“ Gerichte aus. Gegen Letzteres ist auch nichts einzuwenden.
Innen ist das Rocher de Cancale nach wie vor eine Augenweide – was das berühmte Rezept betrifft, verlasse ich das Lokal aber mit leeren Händen: Der aktuelle Küchenchef hat weder von der Geschichte des Hauses noch von normannischer Seezunge die leiseste Ahnung, ein Jammer.
Passage du Caire
Lohnend ist in diesem Viertel auch der eine oder andere Abstecher in eine der Nebenstraßen, etwa die Rue Tiquetonne, zu der ich nun zurückspaziere. Bei Hausnummer 56 befindet sich das 1951 gegründete Pâtisserie- und Küchenbedarfsgeschäft G. Detou, das heute noch wie ein Kaufmannsladen aus dieser Zeit aussieht, freilich wie einer für Experten, in dem es von Jahrgangssardinen über feine Senfsorten bis zur Chocolatier-Basisausstattung einfach alles gibt. Bei meinem Bummel in Richtung Osten komme ich an zahllosen winzigen Geschäftslokalen, Cafés und Restaurants vorbei, deren Enge ihre Inhaber zu kreativen Lösungen zwingt und in denen modernes Design, altes Gebälk und Mauerwerk reizvolle Kombinationen ergeben. Ich lande in der Passage du Grand-Cerf, an deren Stelle sich einst das Hôtel du Grand-Cerf befand, der zentrale Postkutschenbahnhof der Hauptstadt – unglaublich turbulent muss es damals zugegangen sein. Heute strahlt die Passage eher diskrete Eleganz aus, viele Designer-Büros sind hier zu Hause, ein schönes und teures Geschäft für afrikanische Möbel, Stoffe und Kunsthandwerk auf zwei Etagen, kleine Boutiquen. Bei einem Vintage-Laden finde ich Schuhspanner des österreichischen Bundesheers in einer Wühlkiste.
Die Passage bringt mich zurück zur Königsstraße. Bis vor Kurzem war sie gerade in diesem Abschnitt noch Tag und Nacht ein einziger lang gezogener Straßenstrich, doch davon ist so gut wie nichts mehr geblieben. Die Straße atmet sichtlich auf, Sex-Shops weichen Bio-Weinhandlungen, Gemüseläden und Frühstückslokalen. Zahlreiche Passagen mit teils schillernder Vergangenheit öffnen sich links und rechts der Rue Saint-Denis, zum Beispiel die Passage du Bourg-l’Abbé gleich gegenüber, in der sich einige Handwerker und ein hübsches Café angesiedelt haben, oder, ein paar Schritte stadtauswärts, die Passage de la Trinité, eine der engsten dieses Viertels.
Nach dem Überqueren der Rue Réaumur geht es weiter in die Passage du Caire, die wie vieles in diesem Viertel an Napoleons Ägypten-Feldzug erinnert. An dieser Stelle befand sich der von Victor Hugo im Glöckner von Notre-Dame ausführlich beschriebene „Hof der Wunder“ (Cour des Miracles), in dem Krüppel aller Art wie durch ein Wunder von ihren Leiden „geheilt“ wurden, wenn sie von ihren Betteltouren zurückkamen: Buckel wurden abgeworfen, Blinde konnten wieder sehen, Gelähmte wieder gehen … ein schillernder, aber auch gefährlicher Ort, glaubt man dem Romancier. Es lohnt sich, ein paar Schritte ins Innere der verzweigten Passage zu machen, in der es zahlreiche Schneiderläden gibt, man aber auch Schaufensterpuppen und ähnlichen Boutiquebedarf kaufen kann. Sehenswert sind die „ägyptischen“ Ornamente der Hausfassade am Hinterausgang.
Nicht unspannend geht es in der Passage Sainte-Foy weiter, deren diskreten Eingang in der Rue Saint-Denis 263 man leicht verpassen kann. Sie wurde direkt an die mittelalterliche Stadtmauer gebaut, weswegen sie einige Stufen und Unebenheiten aufweist. Diesem Weg („Sentier“) entlang der Mauer verdankt das ihn umgebende Viertel bis heute seinen Namen. An der Passage Sainte-Foy sind alle Neuerungen der jüngsten Zeit spurlos vorübergegangen. Eine Dame fortgeschrittenen Alters mit gewagtem Dekolleté, eine würdige Vertreterin ihres uralten Gewerbes, beschimpft mich, als ich den Fotoapparat zücke, um eine Schneiderwerkstatt in der Passage zu fotografieren, und beruhigt sich erst, als ich den Apparat in meiner Tasche verstaue. Prostitution und Schneiderwerkstätten – das macht den „alten“ Sentier seit jeher aus.
Einst arbeiteten hier vor allem Nordafrikaner, darunter viele sephardische Juden, später Türken, dann übernahmen die Chinesen den Pariser Textilsektor. Sie wurden wegen zunehmender Beschwerden in Richtung elftes Arrondissement verdrängt – die Rue du Chemin-Vert gilt nach wie vor als Hauptstraße des „neuen“ Sentier, doch auch dort waren die vielen Schneidereien nicht erwünscht. Inzwischen zeichnet sich eine definitive Lösung ab, die chinesische Kleiderproduktion ist in die Vorstadt Aubervilliers übersiedelt. Zu meinem Leidwesen muss ich ein zweites Mal an der Dame vorbei – das andere Ende der Passage, an dem ich eigentlich wieder hinauswollte, ist mittlerweile durch ein versperrtes Gitter verschlossen. Diesmal werde ich großzügig ignoriert.
Der Umweg, den ich wegen der geschlossenen Passage nehmen muss, ist aber auch lohnend. So kann ich einen kurzen Blick in die Passage des Dames-de-Saint-Chamond, Rue Saint-Denis 226, werfen, an deren Ende ein hübsches Stadtpalais liegt, das sich einst ein Minister Richelieus erbauen ließ. Auch dieses wurde vom Textilsektor übernommen. Man kann durch das Palais zum Boulevard Sébastopol durchgehen. Vorsicht, das Pflaster ist sehr uneben!
Ich kehre in die Rue Saint-Denis zurück, gehe links in die schräg bergauf führende Rue Sainte-Foy weiter, danach gleich rechts in die Rue Chénier und erklimme den ehemaligen „Mont Orgueilleux“, den Hochmutsberg. Hier ist das Herz des Sentier-Viertels, die Straßen sind noch immer von kleinen Boutiquen gesäumt, ständig überqueren mit Stoffballen bepackte Männer die Fahrbahn. In der Rue Beauregard angekommen, mache ich ein paar Schritte stadteinwärts, die mich an der kürzesten Straße von Paris vorbeiführen: Die Rue des Degrés besteht eigentlich nur aus ein paar Stufen. Dieses Viertel ist ein schönes und, von den paar Boutiquen-Straßen abgesehen, recht ruhiges Eck von Paris. An der Kreuzung mit der Rue de la Lune, der Mondstraße, wäre die „Blumenboutique“ Les 2 au coin eine Pause wert: eine Blumenhandlung, in der es auch eine Café-Ecke und ein kleines Mittagsmenü gibt. Sieht nett aus, mir kommt die unverhoffte Pausenlocation aber etwas zu früh. Außerdem sind die Tische ohnehin voll, ein gutes Zeichen.
Porte Saint-Denis
Von der Rue de la Lune, die ich nun hinunterspaziere, hat man einen schönen Blick auf die Porte Saint-Denis, eine zu Ehren des Sonnenkönigs Ludwig XIV. errichtete barocke Triumphpforte. Unter seiner Regierung wurde die aus dem vierzehnten Jahrhundert stammende, an dieser Stelle vorbeiführende Stadtmauer Karls V. abgerissen und durch die Grands Boulevards ersetzt. Noch heute markiert die Pforte, die an der Stelle eines gleichnamigen Tores der alten Mauer steht, eine Grenze: Auf der anderen Seite heißt die Königsstraße nun Rue du Faubourg Saint-Denis und wechselt den Charakter. Halal-Fleischereien dominieren ein verändertes, aber nicht minder sehenswertes Straßenbild. Zudem gibt es weitere Passagen zu erforschen, gleich nach dem Triumphbogen etwa die Passage du Prado mit einem sehenswerten Art-déco-Dach, unter dem sich vorwiegend afrikanische Männer in zahlreichen Barber-Shops rasieren lassen.
Zwischen all den nordafrikanischen Läden übersieht man leicht die Brasserie Chez Julien, was ein Fehler wäre, handelt es sich doch um ein prachtvolles ehemaliges „Bouillon“, ein Lokal, in dem einst vor allem gekochtes Rindfleisch und eben Suppe serviert wurden. Die opulent verzierte Belle-Épo-que-Speisehalle mit sehenswertem Glasdach beherbergt heute ein nicht billiges Restaurant, das aber trotzdem gut besucht ist.
Als Little India gilt die Passage Brady ein paar Schritte weiter, ein indisches Restaurant grenzt hier an das andere. Ich mag sie nicht besonders, weil man ständig von Kellnern mit Speisekarten angesprochen und hineingebeten wird, ein Spießrutenlauf.
Lohnender finde ich die ruhige Passage des Petites-Ecuries (auch ein hübscher Name: „Kleine-Pferdestall-Passage“), die einen starken Kontrast zur quirligen Rue du Faubourg Saint-Denis bildet. Einige Schritte in ihrem inneren liegt die Brasserie Flo, eine Pariser Gastronomielegende, im Jahr 1918 von einem Elsässer namens Floederer in einem alten Bier-Depot gegründet und heute das Flaggschiff eines wahren Brasserie-Imperiums. Das Ambiente ist gediegen, die Preise sind es auch.
Zurück auf dem Königsweg umfängt mich wieder das pralle Straßenleben. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sticht eine kleine, hübsche Kaffeerösterei heraus, daneben ein ausgezeichnet sortierter Traiteur, man bekommt kurdische Sandwiches, kann auf beiden Seiten in unzähligen Lokalen essen gehen – wieder einmal zeigt sich, dass auch untouristische Straßenzüge in Paris wahre Paradiese für Flaneure darstellen können, vor allem, wenn sich diese ein kleines bisschen für Gastronomie interessieren.
Ab der Rue de la Fidélité wird die Straße deutlich ruhiger. Die Halle des Marché Saint-Quentin lasse ich links liegen, einen anderen Abstecher möchte ich wiederum keinesfalls auslassen: den Nordbahnhof, eine dieser Kathedralen des Verkehrs, die die Begeisterung des neunzehnten Jahrhunderts für die Eisenbahn und für ihre ungeheuren Möglichkeiten würdig zelebrieren. Amsterdam und Brüssel sind zum Greifen nah, doch wozu in die Ferne schweifen: Die Brasserie Terminus Nord, wieder eine dieser altehrwürdigen Brasserien, von denen auf dieser Route kein Mangel besteht, liegt genau gegenüber. Zumindest einmal sollte man sich so ein Lokal in Paris auch gönnen, allein des Spektakels wegen. Mit einer „Brauerei“, was der Name eigentlich bedeutet, haben diese Gaststätten wenig zu tun: Zwar spielt das Bier hier eine wichtigere Rolle als im typischen Restaurant, eine Brasserie zeichnet sich jedoch durch ihre Größe, ihre einfachen, aber nahrhaften Gerichte, die eher ungezwungene Atmosphäre und durchgehende Küche aus. Als ich noch in Paris gelebt und Familienbesuche gelegentlich ins Terminus Nord geführt habe, war ich immer von den Kellnern fasziniert, die riesige Meeresfrüchteplatten oder Choucroute-Schüsseln zwischen den Tischen balancierten und auch dann freundlich blieben, wenn ihnen mein kleiner Sohn dabei beinahe zwischen die Füße geriet.
Nordbahnhof
Ab hier wird die Rue Saint-Denis wieder belebter und vor allem bunter: Ich nähere mich dem indischsten Stück von Paris. Die Auslagen sind voller Saris und Maharadscha-Anzüge, ich verstehe auf der Straße kein Wort mehr. Gut zweieinhalb Stunden bin ich nun unterwegs, Zeit für eine Pause. Das Restaurant Krishna Bhavan in der Rue Cail wurde mir empfohlen, preiswert und authentisch-indisch soll es sein. Etwas ratlos stelle ich fest, dass fast alle Restaurants in dieser Straße so heißen … Kurz entschlossen gehe ich ins Krishna Bhavan auf Nummer 24 – es ist gerammelt voll, doch ein winziger Tisch wird gerade frei. Manchmal hat es auch Vorteile, allein essen zu gehen. Eng ist es hier drin, wie so häufig in Paris, wo die Menschen gelernt haben, sich in einem Lokal, in dem eigentlich nicht einmal genug Platz ist, um sich umzudrehen, den Mantel auszuziehen, ohne dabei sämtliche Teller und Gläser von den nur wenige Zentimeter entfernten Tischen zu fegen. Jeder kann das hier, Tische werden ständig weg- und wieder zurückgeschoben, damit neue Gäste sich setzen können oder jemand aufs WC gelangen kann. Alles klappt reibungslos, auch die vielen Gespräche sind angeregt, aber niemand unterhält sich dabei so lautstark, dass sich jemand anderer gestört fühlen könnte. Bei gut gewürztem, aber nicht zu scharfem Kadai Vegetable Curry und einer Laddu-Kugel zum Dessert, hinuntergespült mit picksüßem Ceylon-Kaffee, genieße ich die Atmosphäre, bewundere meinen indisch aussehenden Tischnachbarn, der mit dem Handy in der linken Hand telefoniert, während er mit der rechten die verschiedenen Saucen und den Reis, den er auf einer großen Platte serviert bekommen hat, zu kleinen Bällchen formt und in den Mund bugsiert, ohne deswegen das Gespräch zu unterbrechen. Viel zu schnell vergeht an diesem Ort voller ungewohnter Gerüche, Klänge und Bilder die Zeit. Beim Bezahlen gebe ich mich weltgewandt und frage, aus welchem Teil Indiens die Küche stammt. Aus gar keinem, lautet die freundliche Antwort: Das ist ein sri-lankisches Lokal.