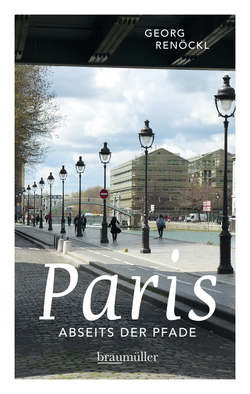Читать книгу Paris abseits der Pfade (Jumboband) - Georg Renöckl - Страница 7
Die Stadt als Droge
Оглавление„Ein Rausch kommt über den, der lange ohne Ziel durch Straßen marschierte. Das Gehn gewinnt mit jedem Schritte wachsende Gewalt; immer geringer werden die Verführungen der Läden, der bistros, der lächelnden Frauen, immer unwiderstehlicher der Magnetismus der nächsten Straßenecke, einer fernen Masse Laubes, eines Straßennamens. Dann kommt der Hunger. Er will nichts von den hundert Möglichkeiten, ihn zu stillen, wissen. Wie ein asketisches Tier streicht er durch unbekannte Viertel, bis er in tiefster Erschöpfung auf seinem Zimmer, das ihn befremdet, kalt zu sich einläßt, zusammensinkt.“
Wenn das keine Warnung ist! Sie stammt aus Walter Benjamins Notizen zu seinem unvollendeten Passagenwerk, in dem er sich auch mit dem im neunzehnten Jahrhundert in Erscheinung getretenen Flaneur beschäftigt.
Man muss das Flanieren aber gar nicht auf so extreme Weise betreiben, wie es Benjamin vorstellt – gerade die „hundert Möglichkeiten“, den Hunger zu stillen, lassen sich kaum an einem anderen Ort so unkompliziert und vielfältig ausprobieren wie in Paris –, um doch eine Ahnung vom Straßenrausch zu bekommen, dem man in dieser Stadt so leicht verfällt. Ist man einmal mitten drin in den selten rasterförmig angelegten, oft verwinkelten, überraschenden alten Straßen der französischen Hauptstadt, dann kann das Entdecken immer neuer romantischer Ecken, witziger Details, unerwarteter Ein- oder Ausblicke zu einer Sucht werden, gegen die es kein Gegenmittel gibt, solange die Füße mitmachen.
Mir genügt meist einer meiner ersten Wege in Paris, der mich zur Buchhandlung Gibert Jeune an der Place Saint-Michel führt, um mich von der Stadt förmlich eingesaugt zu fühlen. Gelegentlich versuche ich, die Gründe dafür herauszufinden. Mithilfe unzähliger Bücher kann man etwa die „Grammatik der Pariser Fassaden“ analysieren, den verbliebenen Spuren verschwundener Gebäude oder Straßenzüge folgen oder die vielen Details des typischen Pariser Straßenmobiliars besser verstehen lernen. Und doch gelingt es mir nicht, damit die Faszination dieses Ganzen wirklich zu erklären. Keineswegs ist der Reiz von Paris museal. Das architektonische Erbe ist überwältigend, doch mit viel Lust am Neuen werden innovative Bushaltestellen, Métro-Linien, Leihradstationen, neueste Methoden der Fassadenbegrünung, urbane Landwirtschaftsflächen und ganze Stadtviertel ins Gesamtkunstwerk Paris eingepasst. Vielleicht ist ein gewisser Ehrgeiz der gemeinsame Nenner, der die Stadtentwicklung vorantreibt: Man begnügt sich in Paris nicht damit, dass etwas funktioniert, es sollte schon Weltklasse sein oder wenigstens danach aussehen.
Ein Hang zur Perfektion bestimmt viele Bereiche des Pariser Lebens, ob es nun die unfassbare Vielfalt der Waren in den Einkaufsstraßen oder auf den Märkten ist, die ihre Verkäufer zu größter Sorgfalt bei der Präsentation zwingt, oder die Art und Weise, wie sich die meisten Pariser im öffentlichen Raum zu bewegen wissen: Wer nicht mithalten kann, hat es schwer. „Savoir vivre“ ist nicht etwa, wie viele glauben, die französische Spielart des italienischen „dolce far niente“, sondern ein hoher Anspruch: Es bedeutet schlicht und einfach, die gesellschaftlichen Spielregeln zu beherrschen. Mit Gemütlichkeit oder dergleichen hat das so wenig zu tun wie die typische Pariser Höflichkeit mit echter Freundlichkeit – auch wenn es einfach schön ist, in der Bäckerei mit „Monsieur“, „Mademoiselle“ oder „Madame“ angesprochen zu werden.
Verlasse ich die Buchhandlung, überquere ich gern die Seine in Richtung Île de la Cité. Wie alle anderen auch, gehe ich dabei meist bei Rot über die Straße, oft neben einem Polizisten, der das genauso macht. Auch das gehört zum Pariser Savoir-vivre: Über Kleinkariertheit ist man erhaben, und Polizisten haben Wichtigeres zu tun, als Fußgänger zu maßregeln. Vielleicht haben sie auch Respekt vor der Unbotmäßigkeit, die zur Natur der Bewohner dieser Stadt gehört: Sich aufzulehnen und um sein Recht zu kämpfen, hat hier eine ehrwürdige Tradition, nicht umsonst gelten die Pariser im übrigen Frankreich als „râleurs“, als „Raunzer“, mit denen man sich lieber nicht anlegt.
Dabei hat man manchmal, wenn man die Weltstadt zu Fuß erkundet, das Gefühl, von Dorf zu Dorf zu wandern. Auch wenn die Stadt die vielen alten Ortskerne an ihren ehemaligen Rändern geschluckt, überwuchert, ausgelöscht oder völlig verändert hat, spürt man sie oft noch, die unterschiedlichen Persönlichkeiten von Belleville und Ménilmontant, von Charonne oder der Butte aux Cailles, von Saint-Germain-des-Près, Grenelle, Auteuil, Passy, Batignolles oder Les Epinettes – teils klingende, teils kaum bekannte Namen.
Äußerlich angeglichen wurden sie im 19. Jahrhundert durch Baron Georges-Eugène Haussmann, ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten haben sie aber meist gewahrt, ob es sich nun ums aristokratische Auteuil, das intellektuelle Saint-Germain oder das proletarisch-migrantische Epinettes-Viertel handelt. In Letzterem entsteht während der Arbeit an diesem Buch ein völlig neuer Stadtteil, das Grand Paris der Zukunft beginnt langsam Gestalt anzunehmen. Doch auch mitten im Zentrum ist die gerade stattfindende Veränderung faszinierend zu beobachten: An den Ufern der Seine, wo gerade noch der Verkehr mit Hochgeschwindigkeit durchbrauste, hört man jetzt wieder das Wasser gluckern, seit die Schnellstraße durch das historische Zentrum von Paris zur Fußgängerzone gemacht wurde. Auf Plätzen wie Nation oder Bastille, die vor Kurzem noch und völlig zurecht als Verkehrshölle auf Erden galten, pflanzen heute Kindergartenkinder Blumenbeete. Die ehrgeizige ökologisch ausgerichtete Politik von Bürgermeisterin Anne Hidalgo verleitet manche Beobachter zum Vergleich mit Baron Haussmann. Das ständige Streben nach der Spitze und der unbedingte Ehrgeiz, zu den Vorreitern zu zählen, vereint nicht nur den deutschstämmigen Präfekten und die spanischstämmige Bürgermeisterin, sondern ist eben eine Pariser Konstante.
Auf mich wirkt die typische Pariser Unruhe, diese Unfähigkeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, im Grunde sehr beruhigend: Ganz gleich, wie gut man die Stadt kennt – man wird doch bei jedem Besuch am laufenden Band Neues entdecken. Wahrscheinlich meinte Hemingway, als er feststellte, dass Paris kein Ende habe, ja genau das.
Schönes Flanieren!