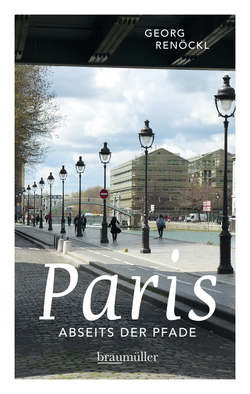Читать книгу Paris abseits der Pfade (Jumboband) - Georg Renöckl - Страница 17
Eine Couch für die Pariser Seele
ОглавлениеBitte nicht lachen: Hühner sind in Paris der letzte Schrei – in der Recyclerie, gleich bei der Métro-Station Porte de Clignancourt zum Beispiel, wo ich an diesem Samstag ausgiebig frühstücke, um fit für den größten Flohmarkt der Welt zu sein. Dieser befindet sich seit über hundert Jahren unmittelbar an der Pariser Stadtgrenze, in Saint-Ouen, nördlich der Hauptstadt. Die Recyclerie gibt es erst seit 2014, ihr Gebäude ist aber viel älter, es handelt sich dabei um einen ehemaligen Bahnhof der alten Bahnlinie „Petite Ceinture“, die die Stadt im neunzehnten. Jahrhundert umrundete. Der seit achtzig Jahren leer stehende Bahnhof ist heute ein Restaurant der eher ungewöhnlichen Sorte. Nicht so sehr, weil es ausschließlich mit Flohmarktmöbeln eingerichtet ist – das gibt es in Paris recht oft, wenn auch hier, wohl dank der Nähe zu Saint-Ouen, besonders schöne Stücke zu sehen sind, wie etwa eine gusseiserne Belle-Époque-Laterne, die über dem großen Saal hängt. Spezieller ist schon die Bastelwerkstatt im Eingangsbereich der Recyclerie. Wer sein auf dem Flohmarkt erstandenes Stück noch etwas ausbessern oder umbauen möchte, aber nicht genügend Platz oder Werkzeug zu Hause hat, kann sich stundenweise in der Werkstatt einmieten. Das wirklich Besondere ist jedoch der hofeigene Hühnerstall am Bahndamm, gleich beim Hinterausgang. Etwa zwanzig Hühner und ein paar Enten tummeln sich hier, und das nicht, um eines Tages im Restaurant serviert zu werden, wie mir Kellnerin Paula, die mich herumführt, sichtlich irritiert über meine Frage erklärt. Die Hühner sind vielmehr Teil des ökologischen Abfallkonzepts der Recyclerie: Bevor sie ihre leeren Teller zurückgeben, kippen die Gäste die Speisereste in eine große Tonne. Diese wandert – nachdem für Hühner Nicht-Geeignetes aussortiert und gesondert kompostiert wurde – in Richtung Hühnerstall. So gut wie keine Küchenabfälle müssen entsorgt werden, ein Traum für jeden Gastronomen. Gegen einen Mitgliedsbeitrag können Stammgäste regelmäßig Hühnereier abholen. Weiter unten in Richtung Bahngleise findet man noch einen Kräutergarten, vier Bienenstöcke, Obstgärten – alles in allem ein „urban farming“-Gelände von insgesamt tausend Quadratmetern. Sommers ist eine Art Beachbar geöffnet, daneben eine Pétanque-Bahn … und das zwar nicht ganz im Zentrum der Stadt, aber im doch sehr urbanen Setting der aufgelassenen Eisenbahnlinie.
Recyclerie
Die Pariser scheinen vom Konzept der Recyclerie, die auch am eher frühen Samstagmorgen gut besucht ist, begeistert zu sein. Nichts gegen Sonntag, wie mir Paula versichert: Beim Brunch ist wirklich viel los, aber ihr macht das Spaß so, und die Atmosphäre hat dann immer etwas von einem Volksfest. Jetzt muss sie aber zurück zu ihren Gästen und lässt mich mit den Hühnern alleine, denen beim Verzehr einiger Salatblätter und Gemüseschalen, die Paula auf dem Weg schnell mitgenommen hat, auch die eine oder andere Großstadtratte hilft. Eine Stadtfarm eben. Auf Schiefertafeln ist das reichhaltige Kursangebot ausgeschildert, das die Recyclerie außerdem noch bietet: Komposthaufen selbst anlegen, Führungen durch die „urban farm“, Garteln für Jung und Alt – ein Konzept, auf das dieser Bahnhof, den man zum Glück nicht abgerissen hat, und dieses Areal achtzig Jahre lang gewartet zu haben scheinen. Jetzt ist auch genau der richtige Zeitpunkt dafür: Die Weltklimakonferenz COP 21 im Herbst 2015 hat dem in Paris ohnehin schon schwer angesagten Öko-Trend noch einen kräftigen Schub verliehen, die Pariser begeistern sich für alles, was auch nur im Entferntesten nachhaltig, klimaschonend und ökologisch aussieht. Etwa die Liste der sieben ökologischen Maßnahmen für den Hausgebrauch – eine pro Wochentag –, die die NGO „Zero Waste“ bei der COP 21 präsentiert hat. Die Woche beginnt mit einem Smoothie aus Altobst und -gemüse, das vom Markteinkauf am Wochenende übrig geblieben ist, danach folgen Ratschläge zur Vermeidung von Plastikmüll im Büro und zu Hause. Mein Lieblingstipp kommt am Freitag dran: „Besorg dir ein Huhn!“ Die Maßnahme würde den Müllberg pro Haushalt um deutlich mehr als ein Viertel schrumpfen lassen, doch freilich sind die wenigsten Pariser Wohnungen für die Hühnerhaltung geeignet. Immerhin, in der Recyclerie kann man, Hühner fütternd, Müll reduzieren und bekommt auch noch Eier dafür. Am Samstag soll man laut „Zero Waste“ seine Kleidung dann nicht in einer Boutique, sondern im Secondhandshop kaufen (eine Tonne Kleidung, die wiederverwendet wird, spart 21 Tonnen CO2). Etwas Ähnliches habe ich nun vor, auch wenn ich weder Jacke noch Hose auf dem Radar habe: Ich bezahle und mache mich auf den Weg zum Flohmarkt.
In Richtung stadtauswärts überquere ich zunächst den Boulevard Ney, wo die ersten diskreten Händler gestohlener oder gefälschter Handys und Uhren stehen. Der Boulevard erinnert an den schillernden Marschall Michel Ney, von Napoleon „Tapferster der Tapferen“ genannt. Er war einer dieser Männer aus einfachsten Verhältnissen, die dank der Revolution den Aufstieg in einstige Adelsdomänen schafften und deren Leben einem bewusst machen, welches Potenzial die Menschheit jahrhundertelang wegen des sturen Ständedenkens vergeudet hat. Ney zeichnete sich auf Feldzügen von Spanien bis Russland als Stratege, aber auch durch persönliche Tapferkeit aus. An der Berezina rettete er die Reste der geschlagenen Grande Armée, deren Rückzug er deckte, in Waterloo ritt er persönlich der größten Kavallerieattacke der Militärgeschichte voran, bei der ihm fünf Pferde sprichwörtlich unter dem Hintern weggeschossen wurden. Die Schlacht verlor er freilich mit seinem Kaiser, weigerte sich danach, ins Ausland zu fliehen und wurde unter dem Bourbonenkönig Ludwig XVIII. wegen Hochverrats füsiliert. Jean Rolin, ein ehemaliger Kriegsberichterstatter, der zu den französischen Großmeistern der Reportage zählt, widmet dem Marschall, vor allem aber dem Boulevard, der seinen Namen trägt, eine lange Reportage mit dem schlichten deutschen Titel „Boulevard Ney“. Mehrere Monate mietete sich Rolin in einer billigen Absteige direkt am Boulevard ein, damals ein düsterer Ort des Verbrechens, der Drogen und der Prostitution. Heute ist die einstige „Zone“ zwar nach wie vor keine Flaniermeile, wurde aber fußgänger- und radfahrerfreundlich umgestaltet.
Das Wort „Zone“ hat im Französischen einen besonderen Klang, es bezeichnet mehr noch als den geografischen Raum ein Milieu der Gewalt, der Halb- und Unterwelt. Kaum noch jemand denkt daran, dass es aus der Zeit des Bürgerkönigs Louis Philippe I. stammt, der in den 1840er-Jahren den Bau eines Befestigungsrings um Paris beschloss. Dieser verlief in etwa entlang des nach verschiedenen Feldmarschällen benannten Boulevards, zu dessen Abschnitten der Boulevard Ney zählt. Bis zu 280 Meter außerhalb der Befestigungen erstreckte sich eine „Zone“, die nicht bebaut werden durfte.
Die Pariser frequentierten die Vorstädte außerhalb der neuen Mauern, die auch eine Zollgrenze darstellten, recht gern: Vieles war hier billiger, und der Weißwein, der in St. Ouen angebaut wurde, war sehr beliebt. Bald siedelten sich die ersten Gebrauchtwarenhändler mit ihren Ständen und Baracken in der „Zone“ an, wo sie genug Platz fanden, um ihre Fundstücke zu sortieren und zu reinigen. 1884 war ein hartes Jahr für die „Chiffoniers“, die Lumpensammler, die die Pariser Müllberge nach Brauchbarem durchwühlten. Ein Präfekt namens Poubelle verbot das Entsorgen von Müll auf der Straße und führte die Mülltonnen ein – das französische Wort für Mistkübel, poubelle, erinnert heute noch an den verdienstvollen Mann. Ob er sich über den zweifelhaften Ruhm gefreut hätte, ist eine andere Frage. Damals gab es 30 000 Lumpensammler in Paris, in St. Ouen waren sie am organisiertesten. Nachdem ihnen Monsieur Poubelle mit seinen Tonnen beinahe die Lebensgrundlage entzogen hatte, wurden sie unversehens durch eine Naturkatastrophe gerettet: Die Reblaus vernichtete die Weingärten von St. Ouen, die Gemeinde überließ ihnen die gesamte Zone, die man in Paris bald „Marché aux Puces“ zu nennen begann – der Begriff „Flohmarkt“ ging im späten neunzehnten Jahrhundert von hier aus um die Welt. 1920 begann ein gewisser Romain Vernaison damit, solide Marktstände anzulegen; dem heute noch bestehenden „Marché Vernaison“ folgten bald die nach ihren jeweiligen Eigentümern „Malik“ und „Biron“ genannten Märkte. Die Flohmärkte waren längst ein bedeutender Wirtschaftszweig geworden, die Vorstadtgemeinden stritten sich um die Gunst der gut organisierten Händler. Legenden um Sensationsfunde bedeutender Kunstwerke machten die Runde, tatsächlich beeinflussten die Flohmärkte ganze Kunststile wie die „art nègre“, die sich ohne die vielfältigen Anregungen, die sich Pariser Künstler auf dem Flohmarkt holten, niemals hätte entwickeln können.
Marché Vernaison
Auf dem Weg dorthin sollte man sich nicht ablenken lassen: Ein paar Meter hinter dem Boulevard Ney, nach einem Häuserblock voller Schuh-, Lederjacken- und Taschengeschäfte, beginnt ein erster „Flohmarkt“, der aber völlig uninteressant ist, eine Ansammlung von Ständen mit in China produziertem Ramsch und Textilien. Ich lasse diesen Markt rechts liegen. Erst nach der Ringautobahn Périphérique beginnt das eigentliche Vergnügen. Fotoapparat und Handy packe ich schon davor gut ein: Die Strecke, die unter dem Périph nach St. Ouen führt, wimmelt nur so von Schwarzhändlern, und bei manchen der dort diskret zum Kauf angebotenen Handys bin ich nicht sicher, ob ihr Vorbesitzer den Verlust überhaupt schon bemerkt hat.
Nun geht es los. „Der“ Flohmarkt von Saint-Ouen besteht aus einer Vielzahl kleinerer Märkte, die höchst unterschiedlich sind. Am „Marché Dauphine“ mit seinen Mini-Boutiquen gehe ich vorbei, ein paar Meter dahinter wartet rechter Hand der „Marché Vernaison“, der Älteste und für mich der Schönste, Verwirrendste und Authentischste der Märkte hier. Obwohl es kurz nach zehn Uhr ist, bin ich trotz gemütlichem Frühstück inklusive Hühnerstallbesichtigung früh dran, viele Stände sind erst am Aufsperren. Ich genieße diese menschenfreundliche Praxis in vollen Zügen – in Wien muss man angeblich um sechs Uhr morgens schon auf dem Flohmarkt sein, um die besten Stücke zu ergattern. Ich habe mir das zwar schon öfter vorgenommen, es dann aber doch nie geschafft, mich der Terrorherrschaft der Frühaufsteher anzupassen.
In St. Ouen kann man die Sache ungleich entspannter angehen. Ein bärtiger Händler mit Kapitänsjacke stellt gerade ein paar schöne Stücke vor seinem Stand namens Le doux logis auf, darunter ein hübsches Karussellpferd. Wir kommen ins Gespräch, merken nach ein paar Sätzen, dass wir beide keine Franzosen sind und sprechen auf Deutsch weiter: Oliver ist Deutscher und lebt seit 22 Jahren in Paris, eigentlich ist er Architekt. Schon als Jugendlicher hat er alte Schilder gesammelt, und auch sein Logo, „Le doux logis“, was man frei mit „Sweet Home“ übersetzen könnte, hat er einmal von einem längst geschlossenen Heimtextilienladen in seiner Nachbarschaft abgeschraubt und in den Keller geräumt, ohne zu wissen, was er damit anfangen sollte. Vor ein paar Jahren hat er dann beschlossen, aus seiner Sammelleidenschaft einen Beruf zu machen, und einen freien Stand in St. Ouen gekauft. Er schimpft etwas über die schwierigen Zeiten, weil die Leute angesichts der permanenten Krisen wenig Lust haben, Geld auszugeben, aber dieses Schimpfen könnte auch zur ganz normalen Pariser Folklore gehören. Ich begleite Oliver, der noch Wasser für seinen Kaffee holen muss, ein paar Schritte durch den Markt. Der Architekt, der damit beauftragt wurde, einen neuen Plan des Marktes zu zeichnen, geht mit einem anderen Blick durch die Stände als der Laie. Den Brandschutz findet er katastrophal, nicht von ungefähr sei in den 1960er-Jahren ein großer Teil des Marktes abgebrannt. Oliver urteilt streng, in den hübschen alten Buden sieht er nur morsches Holz unter zerknitterten Blechverkleidungen, die vom Rost zusammengehalten werden: „Mit Blech umwickelte Streichhölzer sind das!“ Noch mehr ärgert ihn das Kanalsystem, die Toiletten sind ständig verstopft, die Seifenspender brechen ab – und das bei einer nagelneuen Anlage … In meinen Ohren klingt seine Suada fast ein wenig zu pariserisch, oft sind Zuwanderer ja päpstlicher als der Papst beziehungsweise royalistischer als der König, wie man in Frankreich sagt.
Auf jeden Fall ist der Kaffee stark und heiß, eine Wohltat an diesem eiskalten Vormittag, an dem ein ständiges Lüftchen für zusätzliche Frische sorgt. Auch dafür ist St. Ouen bekannt. Oliver schimpft weiter wie ein Pariser Rohrspatz, er findet, dass viele seiner Kollegen sich nicht genug Mühe bei der Präsentation geben: „Schauen Sie sich das an, die Neonlampe ist für so einen Stand doch viel zu groß! Oder der hier, hat einen so schönen Kronleuchter und dann schraubt er Sparlampen rein, das verstehe ich einfach nicht.“ Er selbst legt großen Wert auf stimmige Beleuchtung und geschmackvolle Inszenierung seiner Ware, die er bei Wohnungsräumungen kauft, bei fliegenden Händlern in der Zone oder auch bei Kollegen, denen manche Stücke nicht ins sonstige Angebot passen. Schilder, Blechdosen oder Comic-Gläser aus seiner Sammlung bringt er oft in wenigen Minuten an den Kunden, dann ist der Stundenlohn gut – manchmal dauert alles viel länger, wie bei dem kleinen Spielzeugmuldenkipper, den ich zufällig in die Hand genommen habe. Zwei Stunden lang hat er bei einem auf altes Spielzeug spezialisierten Kollegen die Kiste mit den winzigen Ersatzteilen durchwühlt, damit der kleine Laster wieder auf vier halbwegs gleichen Reifen rollt. 15 Euro kostet er nun, das lohnt sich natürlich nicht. Ich lege das angesichts der darin steckenden Arbeit wertvolle Stück gleich wieder zurück, mein zweijähriger Sohn würde Olivers mühsame Sucherei wohl in wenigen Augenblicken zunichtemachen. Der zum „Pucier“ gewordene deutsche Architekt, der den Markt im Grunde leidenschaftlich liebt – „Wer heftig liebt, haut auch fest zu“, noch so ein französisches Sprichwort –, weiß viele Anekdoten vom Flohmarkt zu erzählen. Etwa von den Originalplänen des Kölner Doms, die im Jahr 1816 auf einem Pariser Flohmarkt auftauchten, woraufhin der eingestellte Bau wieder aufgenommen wurde. Es sind Geschichten wie diese, die für Oliver den Reiz des Marktes ausmachen. Es gibt die seltenen Perlen, die Stecknadeln im Heuhaufen, und auch wenn sich die Händler heute besser auskennen, werden nach wie vor echte Überraschungsfunde gemacht. Freilich braucht man eine gewisse Expertise, und das nicht nur, um eventuell doch noch eine Originalskizze von Leonardo da Vinci unter einem Stapel wertloser Drucke herauszufischen. Die Asterix-Gläser, die ich gerade noch zu kaufen überlegt habe, stammen aus dem Jahr 1968, Sammler erkennen das auf den ersten Blick. Für den morgendlichen Orangensaft der Kinder würde er die nicht nehmen, das sind echte Sammlerstücke, erklärt mir Oliver, nun wieder ganz in seinem Element, und die Frage nach der Geschirrspülerfestigkeit des hübschen Service, das ich schon auf unserem Frühstückstisch stehen gesehen habe, wage ich danach nicht mehr zu stellen. Als mir der deutsche Pucier stattdessen anhand einer Serie historischer Persil-Waschpulverschachteln, die er vor mir aufbaut, einen Vortrag über die vertrackte Geschichte dieser über hundertjährigen Marke hält, gelingt es mir nicht mehr, aufmerksam zuzuhören, so gut Oliver auch zu erzählen versteht – ich bin zu durchgefroren, um länger stehen bleiben zu können, und es zieht mich einfach in die Gassen des Flohmarkts, um auf eigene Faust meine Entdeckungen zu machen.
Oliver
Am liebsten mag ich die vielen originellen, aber auch funktionalen Gegenstände, mit denen man seine Wohnung ausstatten könnte, von formschönen Porzellanlichtschaltern bis zu den typischen französischen Messingtürknöpfen, die so gut in der Hand liegen. Von allem gibt es eine unglaubliche Auswahl. Komplette Baccarat-Kristallgläsersets von 48 Stück kann man für den etwas eleganteren Sektempfang kaufen, Möbel von der Hobelbank bis zur Wendeltreppe, verschnörkelte oder ganz schlichte Silberbestecke, schwere alte Korkenzieher, Schlüsselanhänger, Champagnerkorkensammlungen, alte Werbeplakate, Ledermöbel, Kaffeemühlen, Schaufensterpuppen, stapelweise Postkarten … ich beschließe, später wieder im Vernaison-Markt vobeizuschauen, noch bin ich nicht in Kauflaune und möchte zuvor ein paar andere Märkte sehen. Oliver hat mir beim Weggehen noch den Tipp gegeben, bei seiner Nachbarin Anne-France vorbeizuschauen, die als lebendes Flohmarkt-Lexikon gilt und illustre Figuren wie John Galliano zu ihren Stammkunden zählt.
In der Rue des Rosiers, schon wieder draußen aus „Vernaison“, gehe ich am Le Voltaire vorbei, einem Flohmarkt-Bistro, in dem ich schon oft gegessen oder einen Kaffee getrunken habe. Es ist zwar nicht billig, aber immer voll, das Essen von Brathuhn bis Mousse au chocolat einfach, aber gut, die Kellnerinnen sind energisch, aber nicht uncharmant. Schnell wird man irgendwo hingesetzt und landet, ist man allein unterwegs, mitten in einem meist fröhlichen Durcheinander aus Händlern, Touristen und Stammgästen, in dem man leicht mit seinen Tischnachbarn ins Gespräch kommt. Ich erinnere mich noch gut an eine chinesische Touristin, die alte Babyfotos sammelte und recht unzufrieden an ihrem zu durchgebratenen Steak kaute, das sie irrtümlich so bestellt hatte, weil sie „bien cuit“ für die Bezeichnung einer besonders hohen Fleischqualität hielt. Ich fand ihre Sammelleidenschaft anfangs seltsam, aber sie zeigte mir dann ihre Ausbeute: berührende Bilder, auf der Rückseite mit altertümlichen Schriftzügen in bräunlicher Tinte beschriftet, auf der Vorderseite süße Kinder, die inzwischen im Greisenalter oder längst verstorben sein mussten und eigentümlich fremd wirkten in den Kostümen und künstlichen Landschaften, die damals in Mode waren. Bilder aus einer zeitlich gar nicht so weit zurückliegenden und doch so unendlich weit entfernten Welt aus der Epoche vor den Weltkriegen.
Heute spaziere ich am Voltaire vorbei und bummle zwischen die Stände des ruhigeren, auf eher gehobene Antiquitäten spezialisierten Marché Biron. Hier gibt es viel Verschnörkeltes, aber auch zeitlos schöne Dinge, und nicht alles ist teuer: schlichte, aber elegant geschwungene Eichenstühle mit Strohsitzfläche aus der Zeit des Directoire zum Beispiel, um hundert Euro das Stück – schade, dass die nicht ins Handgepäck passen …
Auf der anderen Straßenseite, dem Markteingang gegenüber, bleibt mein Blick an den seltsamen Club-Ledersesseln eines Ladens namens Fleur de peau hängen. Sie sind viel kleiner und schmäler als die gewohnten, in Paris sehr beliebten Club-Möbel, dennoch sitzt man sehr bequem darin – sie sind eindeutig nicht für Kinder gemacht. „Sind nur Nachbauten, sagt der brummig-freundliche Händler, der gerade aus dem Laden tritt, während ich probesitze. Nachbauten wovon? Von U-Boot-Möbeln aus den 1950er-Jahren, erfahre ich. Offiziere hatten selbst in den engen Unterseebooten das Recht auf einen kleinen Salon mit Ledermöbeln, die eben dem spärlichen Platzangebot angepasst wurden. Auch eine Couch gibt es dazu, genauso bequem, wie ich mich überzeugen kann, aber eben viel kleiner als gewohnt. „In Paris verkaufen sich diese Möbel wahnsinnig gut“, erklärt mir der Händler. Die Pariser Wohnungen sind nun einmal winzig, die U-Boot-Modelle wie gemacht dafür. Was für eine Marktlücke!
Ich gehe an einem weiteren Flohmarkt-Bistro vorbei, der Chope des Puces. Es handelt sich um kein unbekanntes Lokal: Django Reinhardt trat hier auf, der Manouche-Gitarrist lebte im Haus dahinter. Noch heute finden am Wochenende von halb eins bis spätabends Konzerte mit Manouche-Musikern statt, doch am Vormittag ist es ruhig. Ich werfe einen Blick in das Lokal und wechsle ein paar Worte mit der Wirtin, die sich als Madame La Coupe (was man mit „Champagnerschale“ übersetzen kann) vorstellt. Eigentümer des Lokals ist der Jahrmarkt-Unternehmer Marcel Campion, eine skandalumwitterte, schillernde Figur des französischen Wirtschafts- und Gesellschaftslebens. Campion ist aber auch selbst Manouche-Musiker und möchte den Geist dieser vor allem in den 1930er-Jahren populären Musik, in der sich Jazz, Chanson, Klezmer- und Roma-Musik verbinden, in seinem Lokal am Leben erhalten.
Kurz nach dem Django-Reinhardt-Bistro, in dem gerade die ersten Apéros bestellt werden, biege ich nach links in die Rue Paul Bert, die zum gleichnamigen Markt führt. Die Straße säumen einige alte Häuser mit teils verwilderten Vorgärten, vor denen Antiquitäten stehen. Colonial concept heißt eines dieser Häuser. Ausgestopfte Pfaue, die ich im Vorbeigehen aus dem Augenwinkel wahrnehme, machen mich neugierig, ich betrete das Haus. Einmal mehr finde ich mich in einem Dekor wieder, das mir das Gefühl gibt, in einem Film oder einem Märchen gelandet zu sein, allerdings in einem gruseligen: Die Pfaue waren nur ein Vorgeschmack, in einem zweiten Haus hinter dem straßenseitigen Gebäude befinden sich noch viel mehr ausgestopfte Tiere. Eine in drei Stücke geteilte Giraffe zum Beispiel, deren nach unten geneigter Hals weit in den Raum hineinragt. Sie streckt die Zunge heraus, als würde sie dem Verkäufer, der in einem Lehnstuhl gleich darunter sitzt, über den gegelten Schopf schlecken wollen. Ein grotesker, auf seine Weise großartiger Anblick. Einige Zebraköpfe mit geblecktem Gebiss grinsen von der Wand, ein ausgestopfter kleiner Schwarzbär scheint mit einem Strauß von drei Gasballons, die er fest in der Pfote hält, davonzufliegen. Weiße Pfauen starren mich an, ein hübsches weißes Pferd sieht so lebendig aus, dass ich es unwillkürlich streichle.
Colonial Concept
François Daneck heißt der Eigentümer des Geschäfts, der sich mehr als Künstler denn als Präparator oder Händler versteht. Ein wenig dürfte er sich an Damien Hirst orientieren, mich überzeugen seine gruselig-kitschigen Kunstwerke aus verzierten Tier-Totenköpfen aber nicht. Dafür hat es etwas von einer morbiden Fantasiereise, zwischen den vielen ausgestopften Tieren und den mit Tierfellen und -häuten überzogenen Möbeln herumzuspazieren, mit denen das Häuschen auf drei Etagen bis unters Dach vollgeräumt ist. In der Nacht wäre ich lieber nicht hier drin, wobei mir da einfällt: Waren es nicht ganz ähnliche weiße Pfauen, die bei dem Fest F. Scott Fitzgeralds in Woody Allens „Midnight in Paris“ für das unwirklich-dekadente Dekor sorgten? Ich möchte Monsieur Daneck danach fragen, doch der ist gerade mit zwei eleganten Pariserinnen in engen Lederhosen ins Gespräch vertieft, die ernsthaft überlegen, sich einen Zebrakopf mitzunehmen, und ich will nicht indiskret danebenstehen und bei den Preisverhandlungen zuhören. Letztendlich ist es auch egal, ob Woody Allen die Dekoration für den Film hier oder in einem ähnlichen Laden besorgt hat. Beim Verkäufer unter der Giraffenzunge erkundige ich mich im Hinausgehen nach den Preisen: 26 000 Euro kostet die Giraffe, die es nur im Ganzen zu kaufen gibt, 9500 das weiße Pferd, 14 500 der Bär mit den Ballons.
Während ich versuche, gedanklich wieder in meine Realität zurückzufinden, stehe ich schon im Nebenhaus, Les Merveilles de Babellou. Alte Statuen, Steinbrocken, die wie von Kirchtürmen abgebrochen aussehen, allerlei Vasen und Säulen stehen im Erdgeschoß herum. Der eigentliche Höhepunkt des Hauses ist der verträumt verwachsene Garten, dem antike Ruinenteile und alte Gartenmöbel den Anschein einer verwunschenen Märchenlandschaft geben – sehr gekonnt inszeniert ist das. Auf dem Rückweg über ein paar Stufen ins Geschäft fällt mein Blick auf die lange Tafel im Kellergeschoß, offenbar hat die gesamte Belegschaft gerade zu Mittag gegessen, man hört fröhliche Gespräche und das Klappern des Geschirrs, das gerade weggeräumt wird. In einem eleganten Stuhl inmitten ihrer antiken Schätze sitzt unverkennbar die Chefin des Hauses und plaudert mit einer Mitarbeiterin über das Rezept, das sie heute Mittag ausprobiert hat. Es ist ein Klassiker der gutbürgerlichen französischen Küche: Poule au Pot, die berühmte Henne, die nach dem Wunsch des guten Königs Henri IV. jeder Franzose sonntags in seinem Suppentopf haben sollte. Ich kann nicht widerstehen und spreche Madame auf das Rezept an. Tatsächlich hat sie es heute selbst gekocht, für ihre Mitarbeiter und einige befreundete Antiquare. Sie hat das Rezept von ihrer Mutter übernommen, hier ist es: