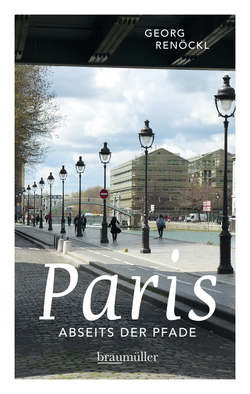Читать книгу Paris abseits der Pfade (Jumboband) - Georg Renöckl - Страница 23
Zu Besuch bei den alten Damen
Оглавление„Ich heiße Alfons, kann nichts dafür“, lässt die franko-kanadische Sängerin Lynda Lemay eines ihrer Chansons beginnen. Für die Place de la Bataille-de-Stalingrad gilt Ähnliches: Man hüte sich vor Rückschlüssen von seinem schaurigen Namen auf die Qualität dieses Platzes. Vor 1945 hieß er schlicht Rond-Point de la Villette, doch auch das ist keine unblutige Bezeichnung: „La Villette“ war von den 1860er- bis zu den 1970er-Jahren ein Synonym für den zentralen Pariser Viehmarkt und den gleich daneben liegenden Schlachthof, die zeitgleich unter Baron Haussmann errichtet wurden und sich im Nordosten der Stadt über ein Terrain von 54 Hektar erstreckten. Etwa 4000 Rinder, 22 000 Schafe, 4000 Kälber und 7000 Schweine wurden dort um das Jahr 1900 täglich geschlachtet. Der Canal de l’Ourcq, eine im frühen neunzehnten Jahrhundert angelegte Wasserstraße, die vor allem die Trinkwasserversorgung der Hauptstadt verbessern sollte, trennte die beiden Einrichtungen: Am östlichen Ufer befand sich der Viehmarkt, von dem heute noch die imposante Rinderhalle steht, am westlichen Ufer die Schlachthäuser, auf deren Gelände nach ihrer Schließung das sehenswerte Technikmuseum „Cité des Sciences et de l’Industrie“ sowie ein Imax-Kino errichtet wurden. Ein weitläufiger Park umgibt und verbindet die verschiedenen Komplexe, die früher einmal „Cité du sang“, Blut-City, genannt wurden. Boris Vian widmete den „fröhlichen Fleischern“ von la Villette einen Tango mit dem Kehrreim „Faut qu’ça saigne“ – „Blut muss fließen“.
Place Stalingrad
Irgendwie passt die Geschichte des Viertels zu meinem heutigen Spaziergang: Ich treffe hier am frühen Nachmittag Dominique Manotti, die Grande Dame des französischen Roman noir, die seit Jahrzehnten im neunzehnten Pariser Arrondissement lebt und sich bereit erklärt hat, mich durch ihr Viertel zu führen. Eine kleine Runde unternehme ich zuvor schon auf eigene Faust: Schließlich habe ich selbst zwei Jahre in unmittelbarer Nähe gewohnt und möchte mein altes Viertel, in dem sich ständig Neues tut, zunächst noch für mich selbst wiederentdecken.
Place Stalingrad also. Das runde Gebäude zwischen den Métro-Stationen Stalingrad und Jaurès, bei dem ich meine Tour beginne, diente früher als Zoll-Hauptquartier. Entlang der heutigen Métro-Linie verlief einmal eine der stets weiter hinausgeschobenen Pariser Stadtgrenzen. Kurz vor der französischen Revolution wurde sie durch eine Mauer geschützt, die nicht so sehr der Verteidigung diente, sondern vielmehr den grassierenden Schmuggel unterbinden sollte. Die Pariser hassten die Mauer, die nicht lange stehen blieb. Heute ist die einstige Zoll-Rotunde ein Restaurant mit schönem Innenhof und noch schönerer Terrasse, die sich zu einem großzügigen Platz öffnet, den die Verkehrsberuhigung des Viertels vor zwanzig Jahren dem Boulevard abgetrotzt hat. Ich gehe links am gegenüberliegenden Brunnen vorbei und spaziere vor dem Kino Quai de Seine am Wasser entlang. Wie ein Spiegelbild sieht das Kino Quai de Loiré auf der anderen Seite aus – beide waren früher einmal Speichergebäude, als das Bassin de la Villette noch ein wichtiger Handelshafen war, geplant wurden sie vom Architekturbüro Gustave Eiffels. Besonders nett finde ich die Idee, dass man mit einer gültigen Kinokarte ein kleines Fährboot benützen darf, das regelmäßig zwischen Quai de Seine und Quai de Loire hin- und herfährt – man könnte natürlich auch zu Fuß gehen, aber das macht nur halb so viel Vergnügen. Die Kinos zeigen nicht nur Filme, sondern beherbergen auch gute Buchhandlungen und Cafés unter ihrem Dach. Kaum zu glauben, dass sich hier vor wenigen Jahren noch einer der wichtigsten und gefährlichsten Crack- und Heroinumschlagplätze der Stadt befand, ein Ort, dem man besser großräumig auswich.
Kino Quai de Seine
Statt Drogendealern und ihrer Kundschaft haben heute „ganz normale“ Pariser das Bassin de la Villette als Freizeitareal für sich erobert. Die Stimmung an beiden Ufern dieser größten künstlichen Wasserfläche der Stadt ist entspannt, man spielt Tischtennis und Boule, badet in einem der im Sommer 2017 eingeweihten Schwimmbäder ein paar Schritte Richtung stadtauswärts oder borgt sich ein Boot beim kleinen Bootsverleih Marin d’eau douce aus, an dem ich gerade vorbeigehe. Ein verlockender Gedanke, auch ohne entsprechenden Führerschein nach kurzer Einschulung für ein paar Stunden Kapitän zu spielen, auf dem Kanal aus der Stadt hinauszutuckern und irgendwo im Grünen zu picknicken …
Bei der Brücke, die ich nach wenigen Minuten erreiche, biege ich nach links ab, überquere dann die Rue de Flandre und stehe wenig später in der Rue Curial vor meinem ersten Ziel für heute: dem „Centquatre“. 120 Jahre gehörten die beiden Hallen aus Ziegeln, Gusseisen und Glas, die ich nun betrete, der Pariser Bestattung. Stallungen für dreihundert Pferde befanden sich im Untergeschoß, Dutzende Trauerkarossen, später über zweihundert motorisierte Leichenwägen waren eine Etage höher geparkt. Trauerzüge wurden in den Hallen zusammengestellt, in zahlreichen Geschäften gab es alles zu kaufen, was man dafür an Zubehör brauchte. In den 1990er-Jahren endete mit dem städtischen Begräbnismonopol auch die Aktivität der Betriebe in der Halle, die 2008 nach jahrelangen Umbauten als Kulturzentrum wiedereröffnet wurde. Während ich den großzügigen Raum auf mich wirken lasse, laufen zwei junge Menschen aus zwei gegenüberliegenden Ecken aufeinander zu und beginnen einander heftig abzuküssen. Ich bin unsicher, ob ich das nun rührend oder doch etwas übertrieben finden soll, da lösen sie sich plötzlich aus der Umarmung, wechseln ein paar recht nüchtern klingende Worte, gehen wieder zu ihren Ausgangspunkten zurück und wiederholen das gleiche Ritual. Als ich ihnen nachschaue, springen zwei andere, die gerade noch auf Liegestühlen mitten in der Halle gesessen sind, plötzlich auf und beflegeln sich heftig. Wie die beiden anderen brechen sie nach wenigen Sekunden ab und fangen wieder von vorne an. Endlich begreife ich: Hier machen Schauspielschüler ihre Hausaufgaben. Weiter im Inneren üben Zirkusschüler, zwei jonglieren mit Keulen, eine studiert eine Akrobatiknummer mit Hula-Hoop-Reifen ein. Die kommen fast jeden Tag, erklärt mir die Buchhändlerin, in deren Laden ich zwischendurch ein wenig stöbere. Die Schule befindet sich zwar nicht im Centquatre, aber die Schüler haben die Hallen als Proberaum für sich entdeckt. Ich durchquere den Komplex und verlasse ihn in Richtung des Parks Jardins d’Éole, der entlang der Rue d’Aubervilliers angelegt und gleichzeitig mit dem Centquatre eröffnet wurde. Der einladend blühende Park ist behindertengerecht und als ökologisches Vorzeigeprojekt gestaltet: Rampen machen die verschiedenen Niveaus auch für Rollstuhlfahrer zugänglich, die Wiesen werden per Sense gemäht. Der einst tristen Ausfallsstraße entlang eines nicht mehr genützten Betriebsgeländes der Eisenbahn, als die ich die Rue d’Aubervilliers in Erinnerung habe, hat der schöne Park ein völlig neues Gesicht verliehen. Noch dazu tun sich ungewohnte Blicke in Richtung Sacré-Cœur auf, das sich direkt hinter den Gleisen der Nordbahn zu erheben scheint. Ich spaziere im Park einige Schritte Richtung stadteinwärts und sehe mir dann die Graffiti auf der Brücke an, die über die Gleise führt – ein ehemaliger Un-Ort ist in ein gelungenes Stück öffentlicher Raum verwandelt worden. Zurück im Centquatre bleibe ich im Café Caché hängen, einem tatsächlich etwas versteckten, hübschen, kleinen Lokal rechts nach dem Eingang. Wahrscheinlich ist die Kellnerin daran schuld: Ich habe noch nie zuvor eine unter sechzigjährige Frau in einer Kleiderschürze aus Omas Mottenkiste gesehen und schon gar keine unter dreißigjährige, aber sie steht ihr.
Speicher
Vorbei an den Zirkus- und Schauspielschülern, die ungerührt von den Passanten vor sich hin proben, gehe ich über die Rue Riquet zurück zum Bassin de la Villette, das optisch von den symmetrischen Gebäuden der Magasins généraux, ehemaligen Mehl- und Getreidespeichern, abgeschlossen wird. Das Gebäude auf „meiner“ Seite hat zwar die gleiche Form wie sein Zwilling gegenüber, der aus dem neunzehnten Jahrhundert stammt, ist aber ein moderner Bau: Ein Brand zerstörte das originale Gebäude in den 1980er-Jahren. Es war nicht nur eine materielle Katastrophe: Die Speicher waren in den Jahren zuvor von Künstlern genützt worden, die sich dort mit Einverständnis der Stadtverwaltung Ateliers eingerichtet hatten. Jahrelang hatten sie auf den schlechten Zustand der Gebäude aufmerksam gemacht, bis es eines Tages zu spät war. Das Feuer vernichtete die Ateliers und zahlreiche Kunstwerke. Die Künstler, von denen manche bei dem Brand ihr Lebenswerk verloren hatten, sind nicht wiedergekommen. Der moderne Bau am Quai de la Seine ist heute eine Jugendherberge, sein Zwilling gegenüber ein Studentenheim. Ein paar Schritte mache ich noch stadtauswärts am Wasser, das nun nicht mehr Bassin de la Villette heißt, sondern bereits Canal de l’Ourcq. Mir ist ein Lastkahn aufgefallen, der offenbar eine Buchhandlung ist, eine Kombination, die ich so noch nie gesehen habe. Was kein Wunder ist, wie mir ein paar Augenblicke später Didier Delamare erklärt, der hier seit zwei Jahren mit seinen Büchern vor Anker liegt. Außer in London gibt es so etwas nämlich nicht in Europa. L’eau et les rêves („Das Wasser und die Träume“) nennt er seinen alten Kahn, in dem vor allem die Reise- und die Krimiabteilung gut ausgestattet sind, mir fallen auch die schönen Kinderbücher auf.
Zugbrücke
Es wird Zeit, das Ufer zu wechseln. Über die letzte Pariser Zugbrücke, ein längst denkmalgeschütztes Kleinod aus dem neunzehntes Jahrhundert, spaziere ich zum Quai de la Loire. Es lohnt sich, falls gerade ein Boot auf die Brücke zufährt, kurz zu warten und zuzusehen, wie das gut in Schuss gehaltene technische Denkmal nach wie vor seinen Dienst tut, doch ich will nicht zu spät zu meinem Rendezvous auf der Terrasse der Paname Brewing Company kommen, eines Bierlokals gleich beim Studentenheim: Dominique Manotti erwartet mich dort. Die beinahe zerbrechlich wirkende Autorin gewinnt mit ihren ungemein dichten, harten, in rasantem Tempo erzählten Büchern Preis um Preis. Sie führt ihre atemlosen Leser in ein dunkles, gewalttätiges Universum, in dem nur heftige Liebe und deftiges Essen für sinnliche Lichtblitze sorgen. Happy End geht sich meistens keines aus, da ihre Ermittler oft an gut vernetzte Großmeister des Verbrechens geraten und nicht selten unmittelbar vor der Enthüllung von ihren Fällen abgezogen werden. Manotti schreibt zwar fiktionale, aber keineswegs unrealistische Geschichten. Die detailreich geschilderten Hintergründe der Fälle sind penibel recherchiert. Die Romanautorin warbis zu ihrer Pensionierung Universitätsdozentin für Wirtschaftsgeschichte und verfügt über ein stupendes Wissen um die wirtschaftlichen Hintergründe, die das Zeitgeschehen entscheidend beeinflussen. So auch in „Schwarzes Gold“, ihrem jüngsten Buch, über das wir bei einem kleinen Schwarzen mit herrlichem Blick über das Bassin de la Villette plaudern. Sie verknüpft in dem in Marseille spielenden Roman die erste Ölkrise zu Beginn der 1970er-Jahre mit dem organisierten Drogenhandel der „French Connection“ und den Morden des Mossad, der damals die „Liste Golda Meir“ abarbeitete und weltweit palästinensische Terroristen liquidierte. In dem fesselnden Roman erzählt sie sozusagen im Nachhinein den ersten Fall ihres bewährten Kommissars Théo Daquin, eines schwulen Hünen, der sich auf die Auswahl des genau zum jeweiligen Anlass passenden Hemds genauso gut versteht wie auf das nötigenfalls mit dem Schlagring geführte Verhör.
Dominique Manotti
Auf die Idee, einen homosexuellen flic ermitteln zu lassen, kam Manotti bei den Vorarbeiten zu ihrem ersten Roman Sombre Sentier („Hartes Pflaster“). Dieser spielt im ausschließlich männlichen Milieu der damals vor allem aus der Türkei stammenden Schneider, die den Pariser Textilsektor am Laufen hielten. Manotti war als junge Dozentin auch Spitzengewerkschafterin und setzte sich für die Rechte der türkischen Migranten ein. Mittérrands Wahlsieg 1981 bedeutete für sie einen Schock: Als ihr klar wurde, dass der Sieg der Linken keineswegs der Sieg ihrer Ideale war und sie von den smarten, machtbewussten Leuten Mittérrands um die Früchte ihres Einsatzes betrogen werden sollte, schmiss sie in der Gewerkschaft alles hin und begann, ihren Roman zu schreiben. Ein Glück für ihre Leser, doch für sie war die Verwandlung von der kämpferischen Gewerkschafterin zur Autorin mit einer schweren persönlichen Krise verbunden – immerhin war ein Gutteil der Achtzigstundenwoche, die sie damals hatte, ihrem sozialpolitischen Engagement geschuldet. Sie arbeitete sich dann als Autorin an den Mittérrand-Jahren ab, die in ihren Romanen von Machtmissbrauch und den Verlockungen des schnellen Geldes gezeichnet sind. Als literarische Rache will sie ihre Bücher aber nicht verstanden wissen: „Ich habe ganz einfach zu erzählen begonnen, um nicht alles zu verlieren.“
Dominique Manotti ist, anders als ihre Bücher, eine heitere Frau, die voll positiver Energie steckt. Sie scheint zu bedauern, dass wir uns zum Kaffee treffen: „Das Bier, das die hier brauen, ist so gut!“, und schwärmt von ihrem Viertel. Die Rotonde etwa, die wir von der Terrasse aus gut sehen können, war in den 1970er-Jahren noch völlig versteckt: „Das war ein Busbahnhof für portugiesische Arbeiter, man sah das Gebäude so gut wie nie, weil stets Busse rundherum parkten“, erzählt sie. Für sie waren es vor allem die 2005 eröffneten Kinos, die die Verwandlung des Viertels einleiteten. Marin Karmitz, dessen Initialen auf den Kinos stehen, ein einstiger Maoist, ist heute einer der vier großen Pariser Kinobetreiber. Der Sohn rumänisch-jüdischer Migranten und erfolgreiche Filmproduzent verstand es, mit den Bürgerinitiativen und Vereinen, die es damals bereits im vom Drogenhandel geplagten Viertel gab, zusammenzuarbeiten, sodass er sein Projekt umsetzen konnte, ohne auf Widerstand zu stoßen – für Dominique Manotti, die die Lust der Pariser am Widerspruch kennt wie kaum jemand, keine Kleinigkeit.
Wir brechen auf und verlassen das Hafenbecken durch die Rue de Crimée. Beim Überqueren der Avenue Jean Jaurès bin ich wieder einmal über die Schlangen erstaunt, die es in Paris vor den Bäckereien gibt, und über die Vielfalt des Angebots, die schönen Auslagen, das pralle Straßenleben. „Das verdanken wir Haussmann“, erklärt die Wirtschaftshistorikerin. „Napoléon III. wollte seine Hauptstadt als Spektakel inszeniert haben. Haussmann hat das umgesetzt, und darum sind die Häuser aus dieser Zeit nach wie vor so gut zum Präsentieren geeignet. Aber es gibt auch das Leben hinter den schönen Fassaden.“ Was Manotti damit meint, zeigt sie mir in der Rue de Crimée Nummer 93. Wir gehen durch ein unscheinbares Tor in einen unscheinbaren Innenhof – und stehen vor einer prächtigen Kirche aus Holz und Backsteinen, deren Existenz man von der Straße aus nie erahnt hätte. Es handelt sich um eine russisch-orthodoxe Kirche, die vor dem Ersten Weltkrieg von deutschen Lutheranern erbaut wurde. Manotti, die nicht mehr gerne Stufen steigt, lässt mich allein das Innere betreten. Die Kirche ist opulent geschmückt, die Luft mit Weihrauch gesättigt, ein Priester mit Rauschebart in schwarzer Soutane und eine Frau sind ins Gespräch vertieft. Ich will nicht stören und ziehe mich wieder zurück.
In der Rue Manin erklärt mir die Historikerin anhand der Häuser auf unserem Weg einige Unterschiede zwischen den verschiedenen Baustilen des neunzehnten Jahrhunderts und die strengen Vorschriften, mit denen unter Haussmann dafür gesorgt wurde, dass die großen Schneisen, die er durch die alte Stadt schlagen ließ, ein einheitliches, der „Hauptstadt des neunzehnten Jahrhunderts“ würdiges Bild boten. Um auch mitreden zu können, werfe ich ein, dass es bei den haussmanschen Avenuen und Boulevards doch auch darum ging, ein freies Schussfeld für Polizei und Militär bei der Niederschlagung von Aufständen zu haben, wie man häufig in Büchern über Paris lesen kann. Ich hätte mein Bücherwissen wohl besser für mich behalten, die sonst so charmante Autorin wird plötzlich sehr scharf: „Freilich, das kann man überall lesen, aber das ist doch völlig idiotisch! Man kann von Napoléon III. halten, was man will, aber der hätte doch niemals aufs Volk schießen lassen! Und wer hat sehr wohl aufs Volk schießen lassen?“ Da ich etwas betreten schweige, fährt sie fort: „Die Republik! Und das gleich zweimal: im Juni 1848 und bei der Niederschlagung der Kommune. Und danach haben sie diese Eseleien verbreiten lassen. Geschossen haben aber sie und nicht etwa Napoléon III. Der wollte, dass die Pariser über schöne Avenuen ins Theater spazieren können, sonst nichts.“ Erstaunlich, wie heftig die stramm linke Historikerin den durch einen Staatsstreich an die Macht gekommenen Kaiser verteidigt, aber Gegenargument fällt mir keines ein.
Buttes Chaumont
Während ich mein Geschichtsbild und meine Meinung über den Baron Haussmann meinem neuen Wissensstand anpasse, spazieren wir den Park der Buttes Chaumont entlang, auch dieser – für mich der schönste – Pariser Park geht auf die Regierungszeit Napoléons III. beziehungsweise das Schaffen Haussmanns zurück, der den durch langjährigen Gipsabbau von Stollen durchlöcherten Hügel aufwendig zu einem Landschaftsgarten nach englischem Vorbild umgestalten ließ. Mich versetzt der Anblick des prächtigen Parks mit seinen Baumriesen, seinem Wasserfall und seinen Belle-Époque-Laternen, dem Ententeich und dem kleinen Kindervergnügungspark, der Kasperlbühne und dem sonntäglichen Ponyreiten immer in nostalgische Stimmung – unzählige wunderschöne Stunden habe ich hier mit meinem in Paris geborenen ältesten Sohn verbracht.
Wir sind bei einer langen Stiege hinter dem Rothschild-Spital angelangt, die wir langsam erklimmen. Oben angekommen, sind wir nicht mehr in Paris, sondern in einem Dorf, dessen Existenz man von unterhalb der Stiege nicht vermuten würde. Es ist die Butte Bergeyre, wie der benachbarte Park ein vom Gipsabbau ausgehöhlter Hügel, dessen abenteuerliche Geschichte mir die Autorin erzählt. Der legendäre Betrüger Alexandre Stavisky, der in die größten Wirtschaftsskandale der Zwischenkriegszeit in Frankreich verwickelt war, soll seine Hände bei der Parzellierung im Spiel gehabt und mit dem Verkauf der ersten Grundstücke, die einen fantastischen Blick über die Stadt boten, eine schöne Stange Geld verdient haben, ehe Gebäude errichtet wurden, die genau diesen Blick verstellten. Mir ist nicht ganz klar, ob die Geschichte stimmt oder ein Gerücht ist. Immerhin stiftete der polnischstämmige Meisterbetrüger Stavisky selbst über seinen Tod hinaus Verwirrung: Er brachte es zustande, sich angesichts seiner drohenden Verhaftung zwei Kugeln in den Kopf zu jagen, was ernsthafte Zweifel an der These weckte, es habe sich dabei um Selbstmord gehandelt.
„Roter Glamour“ (Nos fantastiques années fric) heißt der Krimi, den Dominique Manotti teilweise in dem Viertel angesiedelt hat, das sie selbst bewohnte, bevor sie vor ein paar Jahren – als ihr die vielen Stufen zu mühsam wurden – in eine Wohnung mit Lift direkt am Bassin de la Villette zog.
Wir bleiben vor einem Haus in der Rue Rémy de Gourmont stehen, auf Nummer 7: Heute ein reines Wohnhaus, doch als Manotti als blutjunge Universitätsdozentin aus dem heimatlichen Savoyen hierher zog, war das Erdgeschoß noch ein Gemischtwarenladen. Sie fand es damals rührend, wenn sich die alten Leute, die entweder fast nichts mehr sahen oder nie lesen gelernt hatten, vom Besitzer des Ladens ihre Post vorlesen ließen. Erst viel später begriff sie, dass die freundlichen alten Damen, von denen das Viertel wimmelte, sonntags ihren Stammtisch im Hinterzimmer des Ladens hatten und dort flaschenweise Whisky tranken. „Sonntag für Sonntag besoffen sie sich da drin gepflegt mit Whisky, und ich habe nichts gemerkt“, lacht Manotti heute. Und nicht nur das: Ihre unmittelbare Nachbarin führte ein winziges Wirtshaus, in dem es zu Mittag nur ein einziges Gericht gab. Hier traf sich die gesamte Nachbarschaft zum Mittagessen, doch eines Tages war Schluss damit: Mit 71 beschloss die Wirtin, ihren Lebensabend auf Korsika zu verbringen, woher sie stammte. Ihre Sorgen angesichts ihres Nachfolgers vertraute sie ihrer jungen Nachbarin an: „Kochen kann er ja. Aber ich glaube nicht, dass er das mit den Mädchen hinkriegen wird.“ Erst in diesem Moment begriff Manotti, dass die freundliche alte Dame die Nachbarschaft nicht nur mit Gerichten aus Großmutters Kochbuch versorgte, sondern nebenbei auch ein Geheimbordell betrieb.