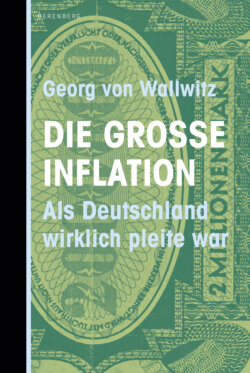Читать книгу Die große Inflation - Georg von Wallwitz - Страница 10
Der Griff in die Darlehenskasse
ОглавлениеMoney in its significant attributes is, after all, a subtle device for linking the present to the future.
John Maynard Keynes, »General Theory« (1936)
Deutschlands finanzielle Probleme hatten schon in den Wochen vor dem Kriegsausbruch begonnen. Die Industrie des Reiches zeigte sich leistungsfähig wie kaum eine andere und produzierte beinahe alle kriegswichtigen Güter schnell und in großer Menge. Allein die Geldbeschaffung, ein entscheidender Faktor in jedem Krieg, gestaltete sich schwierig, denn Deutschland fehlte ein international vernetzter und liquider Finanzplatz, der es mit London oder Paris hätte aufnehmen können. Seine Banken waren zwar groß, aber meist auf den Binnenmarkt ausgerichtet. Um die Forderung der Generalität zu erfüllen, Geld dürfe für die Kriegsanstrengung keine Rolle spielen, nutzten die Berliner Beamten den langen Sommermonat zwischen dem Attentat von Sarajewo und dem Kriegsbeginn, um die Kassen so prall wie möglich zu füllen. Bereits am 4. August 1914 verabschiedete der Reichstag ein ganzes Bündel von Gesetzen zur Finanzierung des Krieges. In einem Nachtragshaushalt genehmigte er kriegsbedingte Sonderausgaben von fünf Milliarden Mark – dies entsprach knapp einem Zehntel der Wirtschaftsleistung Deutschlands, die 1913 bei 52 Milliarden Mark gelegen hatte. Also begab das Kaiserreich im September eine Kriegsanleihe in Höhe von 4,5 Milliarden Mark, die erste von insgesamt neun großen Anleihen, die als patriotisches Opfer vermarktet wurden und bei der sparenden Bevölkerung generell lebhaften Absatz fanden.
Die Mark war zu dieser Zeit dem Goldstandard unterworfen. Es galt das Prinzip der Dritteldeckung, wonach für jede Goldmark im Tresor der Reichsbank nur drei Papiermark ausgegeben werden durften. Das sollte die im Umlauf befindliche Geldmenge begrenzen und den Tausch in andere, ebenfalls auf Gold bezogene Währungen erleichtern. Woher sollten unter diesen Umständen die Milliarden kommen, die der Staat für einen Krieg gegen fast alle Großmächte dieser Welt benötigte? Im System des Goldstandards war ein so großer zusätzlicher Geldbedarf nicht vorgesehen. Das Gold ließ sich nicht magisch vermehren und damit auch nicht die darauf bezogene Mark.
Um mehr Geld schöpfen zu können, musste folglich nach geltendem Recht möglichst viel Gold seinen Weg in die Reichsbank finden. Viele Patrioten folgten demonstrativ den öffentlichen Aufrufen, der Reichsbank Schmuck und Münzen gegen Papiergeld anzudienen. Aber entweder gab es nicht genügend Patrioten oder sie hatten zu kurze Arme für ihre tiefen Taschen, jedenfalls kam nicht genügend Edelmetall für die Kriegsanstrengung zusammen.
Der Geldmangel des Reichs blieb auch dem Volk auf der Straße nicht verborgen, und Ende Juli hatten sich bereits lange Schlangen von misstrauischen oder ängstlichen Bürgern gebildet, die den umgekehrten Weg gehen und ihr Papiergeld bei den Banken in Goldmünzen tauschen wollten. Das zeugte zwar von vaterlandsloser Gesinnung, wie die Zeitungen nicht müde wurden zu schreiben, aber es beruhigte die Nerven für den unwahrscheinlichen Fall einer Niederlage. Nichts zog so unwiderstehlich Nachahmer an wie Schlangen schwitzender Menschen vor Bankschaltern, hinter denen sich nervöse Angestellte fragten, wie lange dieser Zustand noch gut gehen mochte. Niemand wollte vor verschlossenen Türen stehen, hinter denen Ersparnisse plötzlich wie in einem Schwarzen Loch versanken, während sich der Nachbar, der die Zeichen der Zeit schneller gedeutet hatte, zufrieden und entspannt einen Haufen Goldstücke unter die Matratze legen konnte. Daher schlossen am 28. Juli, dem Tag der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien, die Geschäftsbanken ihre Schalter, um dem Land den peinlichen Anblick langer Reihen besorgter Bürger zu ersparen. Am 31. Juli, einem Freitag, zog die Reichsbank nach. Das Papiergeld ließ sich nicht mehr in Gold tauschen, der Goldstandard war praktisch am Ende.
Die Regierung griff nun auf einen Trick zurück, der sich schon im Krieg gegen Frankreich bewährt hatte. Was einmal funktioniert hatte, musste man in der Eile nicht neu erfinden. Die Fiktion der goldgedeckten Mark sollte aufrechterhalten bleiben, die Menge des umlaufenden Geldes musste gleichwohl erheblich vergrößert werden. Wenn die Papiermark sich nicht beliebig vermehren ließ, so lag die Lösung des Problems darin, eine zusätzliche Währung zu schaffen, welche die Bedürfnisse des Krieges und der Wirtschaft erfüllte. Dadurch blieb die Mark sauber und ans Gold gekoppelt, während die Zweitwährung die nötige Liquidität schaffte.
Parallelwährungen waren damals kein ungewöhnlicher Gedanke. Es war nicht lange her, da zirkulierten die verschiedensten Währungen der deutschen Länder, und auch nach der Reichsgründung wusste sich der Staat, wenn er klamm war, mit sogenannten Reichskassenscheinen zu behelfen, die nichts anderes waren als klein gestückelte Schuldscheine des Reichs, die es herausgab, wenn gerade keine Papiermark greifbar war. Um den Geldbedarf zu befriedigen, gab die »Reichsschuldenverwaltung«, das hierfür zuständige Amt innerhalb des Finanzministeriums, Reichskassenscheine zu 5, 10 und später auch 20 oder 50 Mark heraus, die formell Schulden des Reiches waren, aber wie Reichsbanknoten für tägliche Geldgeschäfte benutzt und (mit der wichtigen Einschränkung: je nach Kassenlage) in Gold eingetauscht werden konnten. Dieser enge Bezug zum Gold bedeutete, dass die Reichskassenscheine nicht ohne weiteres vermehrt werden konnten und daher zur Finanzierung des Krieges nur begrenzt taugten.
Die Parallelwährung, die am 4. August 1914 aus der Taufe gehoben wurde, musste flexibler sein. Der Reichstag errichtete »zur Abhilfe des Kreditbedürfnisses, vornehmlich zur Beförderung des Handels und des Gewerbebetriebs« ein System von »Darlehenskassen«. Diese gaben Kredit gegen ein buntes Allerlei von Sicherheiten, wie etwa Rohstoffe, Wertpapiere und unverderbliche Fertigwaren. Sie unterschieden sich zudem von gewöhnlichen Sparkassen dadurch, dass sie ihre Kredite nicht in Mark oder etwa Gold vergaben, sondern als »Darlehenskassenscheine«, welche (wie die Reichskassenscheine) dieselbe Funktion hatten wie Papiergeld, offiziell aber keines waren. Diese Darlehenskassenscheine waren, ebenfalls wie die Reichskassenscheine, nicht mehr durch Gold gedeckt, wie es die Mark nach offiziellen Angaben noch blieb. Zunächst war das Volumen der Darlehenskassenscheine auf 1,5 Milliarden Mark gedeckelt, aber es bedurfte keiner großen Phantasie, um vorauszusehen, dass dieser Deckel später durch eine einfache Änderung im Gesetz auch angehoben werden konnte.
Ein solches System hatte es bereits 1870 im Norddeutschen Bund gegeben, zur Finanzierung des Krieges gegen Frankreich. Und damals war alles gut gegangen. Eine entscheidende Änderung gegenüber 1870 war die Gleichstellung der Darlehenskassenscheine mit den Reichskassenscheinen. Da im Bankgesetz von 1875 in § 17 zu lesen stand, dass die Reichskassenscheine so gut wie Gold waren, sobald sie sich im Besitz der Reichsbank befanden, waren auch die Darlehenskassenscheine in deren Besitz aus juristischer Perspektive nicht mehr von Gold zu unterscheiden.
Um es anschaulich zu machen: Ein Darlehenskassenschein im Nennwert von 50 Mark, welcher in den Besitz der Reichsbank kam, konnte von dieser genutzt werden, um die dreifache Summe, 150 Mark, an frischem Geld zu emittieren – denn der Darlehenskassenschein im Besitz der Reichsbank hatte den Status von Gold. Mit diesem Geld im Nennwert von 150 Mark konnten beispielsweise Staatsanleihen gekauft werden, die wiederum als Sicherheit für Darlehenskassenscheine dienten. Wenn diese 150 Mark an die Reichsbank gelangten, durfte sie laut Gesetz erneut das Dreifache an Geld ausgeben, diesmal 450 Mark. Und so weiter: ein Mechanismus zur unendlichen Geldvermehrung.
Der Bankier Friedrich Bendixen, hellsichtiges Vorstandsmitglied der Hypothekenbank in Hamburg, bemerkte dazu in einem 1917 erschienenen Aufsatz: »Die Reichsbank ist also in ihrer Emissionsbefugnis an einer lebhaften Inanspruchnahme der Darlehnskassen interessiert. Je größer deren Darlehen, umso mehr steigt die Notenreserve der Reichsbank. Das heißt: das Geldbedürfnis erzeugt den Geldüberfluss.«18 Es gab für die Geldmenge keinen limitierenden Faktor mehr, weder den Umfang der Goldreserven noch eine Zentralbank, die von sich aus willens gewesen wäre, bremsend einzugreifen.
War das Absicht oder ein Versehen? Ist der administrative Grundstein der Hyperinflation von einem klugen, vorausschauenden Strategen gelegt worden, der dem Reich einen unbeschränkten Zugang zu Geldmitteln in schwerer Zeit verschaffen wollte? Oder handelt es sich nur um ein schlecht gemachtes Gesetz, um ein bürokratisches Versehen, das der Mark den goldenen Boden unter den Füßen wegzog? Wer formulierte im August 1914, als Europa in den Abgrund starrte, das Darlehenskassengesetz? Ist wirklich niemandem im Finanzministerium oder im Reichstag die Merkwürdigkeit aufgefallen, dass nicht einmal Anleihen der Bundesstaaten zur Deckung der Währung taugten, wohl aber die offensichtlich minderwertigen Darlehenskassenscheine? Wusste der zuständige Finanzstaatssekretär Hermann Kühn davon, ein braver, blasser Jurist, der kaum Spuren in den Geschichtsbüchern hinterlassen hat? Wer auch immer das Darlehenskassengesetz formuliert hat, ein harmloser Beamter oder der arglose Minister oder ein trickreicher Experte in spekulativer Staatsfinanzierung, er hat das Fundament für die Große Inflation gelegt. Er ist, das lässt sich mit kalkulierter Übertreibung sagen, der unbekannte dunkle Held dieser ganzen Geschichte.
Die Deutschen hatten in diesen ersten Kriegsmonaten andere Sorgen, als sich darüber Gedanken zu machen, in welchem Sinne die verschiedenen Scheine, die sie in ihren Taschen vorfanden, Geld waren. Die Frage Was ist Geld? wird selten gestellt, und das ist meistens auch gut so. Es gehört zur Infrastruktur eines Landes und es ist Zeichen für sein Funktionieren, wenn man sich eben genau darüber nicht den Kopf zerbrechen muss. Sobald wir das Geld in der täglichen Praxis hinterfragen, ist in der Regel etwas faul.
Dabei lohnt sich die Beschäftigung auf abstrakter Ebene: Geld ist eine raffinierte Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft (Keynes), ein Machtinstrument (Tolstoi formuliert in unvergleichlicher Prägnanz: »Wer Geld besitzt, hat diejenigen, die keins besitzen, im Sacke.«) und »der Herzen Prüfstein« (Shakespeare in Timon von Athen), an dem sich der Charakter eines Menschen beweist.
Heute definiert die Mehrheit der Ökonomen Geld von seiner Funktion her. Es ist eigenschaftslos, es kann jede Form annehmen. Es ist eine Quantität ohne Qualität, im täglichen Leben so vertraut, dass sein Gebrauch nicht mehr auffällt. Seine Verwendung liegt unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, weil es nur so als Tauschmittel am Markt tatsächlich brauchbar ist. Dieses Tauschmittel muss gewisse Eigenschaften mitbringen, etwa die Fähigkeit, die Kaufkraft über die Zeit zu bewahren. Daher sind alle vergänglichen Gegenstände – wie etwa Äpfel oder Fische – für die Geldfunktion ungeeignet. Geld muss allgemein akzeptiert, liquide und transportabel sein, um möglichst jederzeit und überall zu funktionieren. Geld sollte schließlich noch als Recheneinheit taugen, denn wenn es keinen allgemein anerkannten Wertmaßstab gibt, wird es schwierig, die relative Knappheit eines Gutes zu bestimmen.
Edelmetalle erfüllen viele dieser Anforderungen, weshalb sie in der Geschichte lange Zeit als Geld oder, in der Zeit des Goldstandards, als dessen Referenzpunkt gedient haben. Gold sticht unter diesen heraus, weil es über die Jahrhunderte wertbeständig geblieben ist. Es ist, wie die anderen Edelmetalle, nicht auf der Erde entstanden und kann dort auch nicht gemacht werden (weil es hier nicht genügend Energie gibt: schlechte Nachrichten für Alchemisten).19 Da Gold sich zudem nur schwer aus der Erde extrahieren lässt, erfüllt es das Kriterium des harten Geldes. Bei hartem Geld gibt es zu dem existierenden Bestand verhältnismäßig wenig Zufluss von neuem Geld. Je höher das Verhältnis von Bestand zu Zufluss, desto härter die Währung. Gold zu schürfen erfordert viel Aufwand, und in den letzten 150 Jahren hat die Menge an »frischem« Gold durch alle Preisschwankungen hindurch erstaunlich konstant nur um 2 % des existierenden Bestands zugelegt (das heißt, die Preiselastizität des Goldangebots ist gering).
An dieser Stelle setzten die Quantitätstheoretiker des Geldes an. Die in einem bestimmten Zeitraum umgesetzte Geldmenge ist gleich dem in Geld bewerteten Güterumschlag. Als Formel ausgedrückt: M × V = P × Y, wobei M für die Geldmenge, V für die Umlaufgeschwindigkeit, P für das Preisniveau und Y für die Menge der gehandelten Güter steht. Geht man davon aus, dass Umlaufgeschwindigkeit und Gütermenge sich nicht stark ändern (was nicht selbstverständlich ist), muss eine steigende Geldmenge zu steigenden Preisen führen. Ist in einer Volkswirtschaft hartes Geld im Umlauf, bleibt also auch M einigermaßen konstant, so ist Preisstabilität zu erwarten.
Wenn Geld zu weich ist, kommt es oft zu einer Inflation. Wenn es, wie beispielsweise Gold, zu hart ist, kann eine Deflation die Konsequenz sein, was in der Regel dazu führt, dass das Geld gehortet wird und dem Wirtschaftskreislauf nicht mehr zur Verfügung steht20 – mit allen negativen Konsequenzen, wie etwa zur Zeit der Weltwirtschaftskrise zwischen 1929 und 1933. Die Kunst der Zentralbanken besteht also darin, das Geld nicht zu hart und nicht zu weich zu machen.
Auch mit dieser Theorie meint es die Realität aber nicht immer gut. Das Anwachsen der Geldmenge in Japan, den USA und der EU seit den 1990er Jahren hat dort nicht zu einer spürbaren Erhöhung des allgemeinen Preisniveaus geführt. Es ist, als müssten die Notenbanken gegen eine unersättliche Sparneigung andrucken, die das frische Geld ungenutzt in Horten verschwinden lässt.
Kaum jemand beschäftigte sich zu Anfang des Krieges mit der Frage, ob und nach welcher Theorie Reichskassenscheine oder Darlehenskassenscheine Geld waren. Die Hauptsache war, dass sie für die täglichen Einkäufe akzeptiert wurden. Die neu geschaffenen Scheine fanden schnell Verbreitung und wurden zu einem alltäglichen Phänomen. An ihre zweifelhafte Herkunft dachte in einer Zeit, in der Europa ganz andere Sorgen hatte, niemand. Waren sie nicht nach dem Krieg von 1870/71 schnell wieder verschwunden, dank der Reparationszahlungen aus Frankreich? War nicht die Teuerung der frühen Kriegsjahre moderat (gegenüber dem Dollar verlor die Mark zwischen Ende 1914 und 1916 nur etwa ein Fünftel) und war nicht vielmehr die Knappheit der Güter auf die Seeblockade der Alliierten zurückzuführen (und nicht etwa auf eine Verschlechterung des Geldes)? So gelangten die neuen Scheine gedankenlos in Umlauf und oft genug wieder in die Kassen der Reichsbank, wo sie den Status von Gold annahmen. So glaubte das Deutsche Reich, einem Rumpelstilzchen gleich, aus Stroh Gold zu spinnen.
Die Geldmenge ist nicht die einzige Determinante der Härte und Qualität einer Währung. Auch in der Zeit des Goldstandards hing die Glaubwürdigkeit einer Währung nicht allein an der Menge des Goldes in den Kellern der Notenbank, sondern mindestens so sehr am Glauben an die Wirtschaftskraft eines Landes. Banknoten wurden an der Stelle von Gold angenommen, solange man der Regierung vertrauen konnte, dass sie im Zweifelsfalle für ihr Versprechen geradestehen würde, Papiergeld in Gold zu tauschen. Ihr Versprechen konnte sie entweder einhalten, indem sie jede ausgegebene Note vollständig mit Gold hinterlegte oder indem sie über Steuereinnahmen verfügte, die es erlaubten, die nötige Menge Gold herbeizuschaffen. Je stärker die Wirtschaft und je solider der Haushalt eines Staates waren, desto weniger Edelmetall musste er auch in Zeiten des Goldstandards vorhalten, um dennoch eine über allen Zweifel erhabene Währung zu haben.
Die Geldmenge stieg in Deutschland während des Ersten Weltkriegs deutlich an. Die Geldbasis wuchs zwischen 1914 und 1918 von 10 auf 43 Milliarden Mark.21 Wenn dennoch kaum jemand einen Anlass sah, die Härte der Mark zu bezweifeln, so lag dies an der Stärke der deutschen Wirtschaft, die es ermöglichen würde, nach dem Ende des Krieges schnell zum Goldstandard zurückzukehren und alle finanziellen Versprechen einzulösen. Während der Anteil Großbritanniens an der Weltwirtschaft zwischen 1880 und 1913 von 38,2 auf 30,2 % schrumpfte, wuchs der deutsche Anteil von 17,2 auf 26,6 %. Deutschlands Industrieproduktion hatte die britische überholt. Die Stahlproduktion übertraf diejenige Russlands, Frankreichs und Englands zusammengenommen. Die Kohleproduktion lag mit 277 Millionen Tonnen knapp hinter derjenigen Großbritanniens, übertraf aber die französische bei weitem.
Im Umkehrschluss bedeutete dies, dass ein Land mit zerrütteter Wirtschaft und schwacher Steuerbasis selbst unter den Bedingungen des Goldstandards keine starke Währung haben konnte. Kaum jemand sah die wirtschaftliche Achillesferse des Kaiserreichs, die in den kurzen Kriegen des 19. Jahrhunderts unsichtbar geblieben war: Die Steuerbasis von Bismarcks Koloss in der Mitte Europas war bereits in Friedenszeiten bestenfalls tönern. Das Reich lebte von einigen marginalen Steuern und von Zöllen (und war in dieser Hinsicht der heutigen EU vergleichbar), während die Länder, jedes für sich, eine eigene Steuerpolitik betrieben und sich in einen Wettbewerb um die niedrigste Belastung begaben. Deutschland war vor dem Ersten Weltkrieg, nach heutigen Maßstäben, eine Steueroase. Hat man aber je gehört, dass eine Steueroase einen Krieg gewonnen hätte? Eine wesentliche Voraussetzung nicht nur für eine stabile Währung, sondern auch für einen erfolgreichen Waffengang war der effiziente Zugriff auf Einkommen und Vermögen der Bürger und das darauf basierende Vertrauen eines weiten Kreises von Kreditgebern. Davon konnte 1914 keine Rede sein. Lediglich 3,5 % der Einnahmen des deutschen Staates kamen 1913 aus direkten Steuern, gegenüber 47,5 % in Großbritannien, welches bereits über eine moderne Steuerverwaltung verfügte. Die öffentlichen Ausgaben betrugen vor dem Krieg lediglich 15 % des Volkseinkommens. Bei allem Wohlstand, den Deutschland sich erarbeitet hatte, fehlte die finanzielle Infrastruktur für einen langen und verlustreichen Krieg. Woher das Geld nehmen, wenn der Gegner sich nicht besiegen ließ und seine Kassen außer Reichweite blieben? So stark Deutschland äußerlich erschien, die Kombination aus goldgebundener Währung, schwachem Steuerstaat und unterentwickelten Kapitalmärkten zwang die Regierung zu Kreativität bei der Finanzierung des Krieges. Die Ausweitung der Geldmenge war die logische Konsequenz. Das allein hätte aber auch nicht ausgereicht, um aus einer schleichenden Inflation eine trabende oder gar galoppierende zu machen.
18Die Zitate von Friedrich Bendixen finden sich in: Währungspolitik und Geldtheorie im Lichte des Weltkrieges, S. 27.
19Der Stein der Weisen, so viel ist heute sicher, befindet sich nicht in greifbarer Nähe. Gold kann nicht auf der Erde entstanden sein, ja nicht einmal in unserem Sonnensystem. Die größten hier verfügbaren Kräfte, die etwa im Inneren der Sonne wirken, setzen weniger als 10 MeV pro Nukleon (Proton oder Neutron) frei, was hinreichend ist für die Entstehung von Eisen, nicht aber für alle schwereren Metalle wie Blei oder die Edelmetalle. Die schwereren Elemente entstehen in einem r-Prozess (»r« steht für »rapid«), in welchem bei extrem hohen Temperaturen Neutronen eingefangen und zu neutronenreichen Atomkernen aufgebaut werden, die dann rasch, sehr rasch in die stabilen neutronenreichen Elemente wie Gold (oder instabile, aber langlebige Isotope wie Uran) zerfallen. Ein r-Prozess kommt durch eine Explosion mit sehr vielen Neutronen ins Laufen, aber wo und wie mag es dazu kommen? Astrophysiker gehen heute davon aus, dass die Kollision zweier Neutronensterne oder die Kollision eines Neutronensterns mit einem Schwarzen Loch die nötigen Energiemengen freisetzt. Durch einen galaktischen Zufall werden die so geschaffenen Elemente, als seien es Sternentaler, auf die Erde geschleudert und dort, seit es Menschen gibt, hochgeschätzt. Vgl. dazu Stephan Rosswog: »Out of Neutron Star Rubble Comes Gold«. In: Physics 10, 131, Dez. 2017.
20Wie so oft im Zusammenhang mit monetären Phänomenen lässt sich auch hier oft nicht sagen, wer die Henne ist und was das Ei. Das Horten von Geld kann die Folge, aber auch die Ursache einer Deflation sein.
21Deutsche Bundesbank: Deutsches Geld- und Bankwesen in Zahlen 1876–1975, S. 14, 16, 37f.