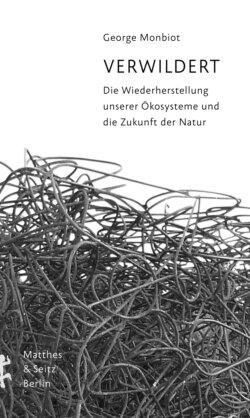Читать книгу Verwildert - George Monbiot - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3)Vorahnungen
ОглавлениеAls jung die Welt, mahnt’ schlau Natur zur Hast
Es reifte früher und machte länger Rast
John Donne, Vom Fortschritt der Seele
Alles fing damit an, dass mein Freund Ritchie Tassel mich anrief. »Da gibt es etwas, was du dir ansehen solltest. Wie schnell kannst du hier sein?«
»Ich bin am Strand. In einer Stunde vielleicht?«
»Das reicht.«
Ich warf meinen Neoprenanzug ins Auto und machte mich auf den Weg um das Mündungsgebiet. Wenn Ritchie, der fast alles gesehen hatte, der Meinung war, die Sache würde sich lohnen, dann war es auch so.
In den Marschen links und rechts des Pfads zirpten und sirrten die Schilfrohrsänger. Schwalben schwirrten über den Gräben und flatterten um die Köpfe der Schafe. Der Duft des Gagelstrauchs – Honig und Kampfer – hing in der Luft, eine Reminiszenz an viktorianische Zeiten. Ritchie hatte mir ein Fernglas geborgt. Wir warteten.
»Da ist er!«
Bei der Entfernung hätte es sich für mein untrainiertes Auge um einen Bussard oder eine Mantelmöwe handeln können. Als der Vogel aber den Flussarm hinaufflatterte, mit einem seltsam linkischen Flügelschlag, bemerkte ich zwei Dinge. Erstens, dass etwas unter ihm baumelte und schwebte. Zweitens, dass er für eine Möwe zu dunkel und für einen Bussard zu weiß war. Ich brauchte eine Weile.
»Jesus Maria auf dem Fahrrad!«
»Habe ich doch gesagt, oder.«
»Ich kann gar nicht glauben, was ich da sehe.«
»Er ist seit drei Tagen hier. Wenn er sich ansiedelt, dann ist das das erste Mal seit dem siebzehnten Jahrhundert.«
Der Vogel flog auf uns zu. Etwa zwanzig Meter, bevor er den Pfad erreichte, wendete er, zeigte sein Profil und flog langsam vorbei. Er trug einen großen Plattfisch. Nach etwa hundert Metern landete er auf einem Zaunpfahl und begann an dem Fisch zu rupfen.
Indirekt war dafür Ritchie verantwortlich. Er hatte überlegt, dass die Fischadler, die seit 1954 wieder in Schottland brüteten, auf ihrem Weg nach und von Afrika die Küste entlangwandern würden und in den Mündungsgebieten und Seen pausieren und fressen würden – und war zu dem Schluss gekommen, dass die Jungvögel nach Revieren suchen würden. Er hatte die höchste Fichte auf seiner Seite des Tals ausfindig gemacht, sich aufgeseilt, die Spitze abgeschnitten und 15 Meter über dem Boden eine hölzerne Plattform gebaut. Er hatte sie mit Zweigen bedeckt und mit weißer Farbe bespritzt, damit es wie Vogelkot aussah: offenkundig die beste Methode, Fischadler zum Bleiben zu bewegen.
Auf der anderen Seite des Tals hatte ein eifriger Naturschützer diese Maßnahmen beobachtet. Es dauerte nicht lange, und er hatte den örtlichen Naturschutzbund davon überzeugt, eine eigene Plattform zu bauen. Also wurde ein Telegrafenmast neben das Eisenbahngleis gepflanzt und eine Sperrholzplatte auf ihre Spitze genagelt.
»Eigentlich ein Selbstläufer«, meinte Ritchie. »Der Vogel konnte zwischen einem kleinen, tief im Wald gelegenen hübschen Anwesen oben auf einem Baum mit Blick über den gesamten Flussarm wählen und einem exponierten Pfosten direkt an der Eisenbahnlinie. Und was tut der Blödmann? Er hat sich natürlich für das Angebot des Naturschutzbunds entschieden. Nicht, dass mich das ärgern würde oder so was.«
Ich hörte nur mit halbem Ohr zu. Es fiel mir noch immer schwer zu glauben, was ich gerade gesehen hatte. Mein Herz pochte. Ein wildes Verlangen überkam mich von der Art, die mich jedes Mal anfiel, wenn ich aus dem immer wiederkehrenden vorpubertären Traum aufwachte, in dem ich, meine Füße ein paar Zentimeter über dem Teppich, die Treppen hinabschwebte. In den letzten Jahren hatte ich ihn nur noch einmal geträumt; tatsächlich nur ein paar Monate, bevor ich den Fischadler zu Gesicht bekommen hatte.
Wie etwa alle vierzehn Tage hatte sich bei mir wieder einmal eine alarmierende Abwesenheit jenes Überlebensinstinkts gezeigt, mit dem andere Leute gesegnet sind, als ich am Strand der Ortschaft Pwlldiwaelod mein Kajak bei drei Meter hohem Wellengang ins Wasser stieß. Das Boot, das auf seiner Bahn durch die Wellen zurückgeschleudert wurde, überschlug sich über mir und ich knallte mit dem Kopf auf den Kies. Ein Glück, dass ich nicht ohnmächtig geworden war. Es erübrigt sich zu sagen, dass ich die Sache wiederholte. Aber beim zweiten Mal schaffte ich es durch die Wellen und paddelte auf das Meer hinaus. Nachdem ich ein paar Fische gefangen hatte, wollte ich wieder an Land zurückkehren. Die Flut stand höher und hässliche, chaotische Sturzseen donnerten gegen die Ufermauer. Etwa zweihundert Meter vor der Küste kam ich ins Grübeln. Selbst von meiner Position aus konnte ich sehen, dass die Wellen braun waren von dem groben Kies, den sie aufwirbelten. Ich hörte ihn gegen die Mauer krachen und prasseln. Ein kalter Angstschauder kroch über meine Haut. Ich suchte das Ufer nach einer besseren Landestelle ab, konnte aber nichts entdecken.
Hinter mir hörte ich ein monströses Zischen: eine Riesenwelle, die über meinen Kopf rollen würde. Ich duckte mich und presste das Paddel auf das Wasser. Nichts. Ich drehte mich um. Die Wogen rollten gleichmäßig heran: hoch, mit weißen Kämmen, aber in dieser Entfernung zum Ufer noch nicht bedrohlich. Verdutzt wendete ich das Boot in alle Richtungen und suchte nach einer Erklärung. Sie tauchte neben dem Boot aus dem Wasser auf: eine graue hakenförmige Flosse, narbig und verschrammt, deren Spitze direkt unter dem Paddelschaft vorbeistrich. Ich wusste, was es war, aber der Schock darüber verstärkte meine aufkeimende Angst und ich geriet fast in Panik. Ich sah nach links und nach rechts und glaubte schon, angegriffen zu werden.
Dann geschah etwas Bemerkenswertes. Ich hörte vom Heck kommend ein anderes Geräusch: ein Klatschen und Aufspritzen von Wasser. Ich wendete den Kopf und ein riesiges Delfinmännchen sprang in die Luft und fast über meinen Kopf. Beim Vorbeifliegen fixierte er mein Auge. Unsere Blicke kreuzten sich, bis er ins Wasser schlug. Ich starrte auf die Stelle und hoffte, er würde wieder auftauchen, aber er ließ sich nicht mehr blicken. Stattdessen spürte ich ein herzergreifendes Hochgefühl, das mich, einen Augenblick lang, klarer sehen ließ. Ich musterte den Uferwall und bemerkte etwas, das ich zuvor nicht gesehen hatte. Etwas entfernt nahm eine Schiffsrampe den Wellen die Kraft. An ihrer Leeseite gab es zwei, drei Meter ruhigeres Wasser.
Ich stach durch die Wellen, bis ich mich etwa 40 Meter vor dem Ufer ihrer Laufrichtung überließ und die Bootspitze auf den Fleck ruhigeren Wassers ausrichtete. Er tauchte alle paar Sekunden auf, wenn ein Brecher zurückrollte, dann, bei der nächsten Attacke auf den Uferwall, wurde er wieder weggefegt. Durch das Tosen der Wellen hörte ich die Kiesel gegen die Befestigungsanlagen prasseln wie Kartätschenkugeln, während die See am Mauerwerk saugte und schmatzte. Ich tauchte das Paddel ein und hielt aufs Ufer zu. Einen Moment zögerte ich noch, bis eine Welle vorbeigerollt war, und flog dann in die Lücke. Als das Boot in die Leeseite der Schiffsrampe glitt, sprang ich hinaus und erklomm, kurz bevor das Kajak gegen den Uferwall geschmettert wurde, den Betonkeil. Beim Aufprall zersplitterte meine Angelrute in tausend Stücke. Die Behauptung, der Delfin habe mir das Leben gerettet, mag etwas hergeholt erscheinen, aber ohne die Verlagerung des Blickwinkels würde ich jetzt wohl einen Teil des Strandguts ausmachen.
Zweimal in einem Jahr vernahm ich diesen Ruf, diesen hohen, wilden Ton der Begeisterung – nach einer Empfindungsdürre, die sich seit der frühen Erwachsenenzeit bemerkbar gemacht hatte; eine Dürre, die ich als dem Alter geschuldet akzeptiert hatte wie den Verlust der hohen Frequenzen beim Hören.
An diesem Abend, nach einem Bier mit Ritchie und einem langen Verweilen im Garten – ich hatte dabei zugeschaut, wie das Licht aus dem Himmel wich und über den Bergen die ersten Sterne aufblitzten –, traf mich ein Gedanke, der mir bislang nie gekommen war. Plattfische leben auf dem Meeresboden. Fischadler fangen ihre Beute kurz unter der Wasseroberfläche. Das passte nicht wirklich zusammen.
Sobald ich in der folgenden Woche wegkam, fuhr ich mit dem Boot in das Mündungsgebiet. Ich hoffte, den Vogel noch einmal zu sehen, aber auch herauszufinden, was es mit den Fischen auf sich hat. Den Fischadler habe ich nicht mehr angetroffen. Nachdem ich aber ein oder zwei Stunden an den Säumen der Sandbänke herumgestochert hatte, war meine Frage beantwortet. Ich war auf eine Stelle gestoßen, an der die Flundern sich so zahlreich versammelt hatten, dass sie nicht auf dem Sand, sondern übereinander lagen. Sie befanden sich in einer Wassertiefe von weniger als 30 Zentimetern und schwammen über meine nackten Füße. Wenn ich mich rührte, schraken sie in Sandwolken gehüllt davon.
Jenen Abend brachte ich in der Garage damit zu, in Kisten herumzuwühlen und Farbdosen, Blumentöpfe, Flintsteine, Fossilien und Samentütchen beiseitezuschieben. Ich hatte schon nicht mehr daran geglaubt, aber dann fand ich es unter Flaschen, die ich als Kind in einer ehemaligen Müllkippe ausgegraben hatte. Es war ein kleines, schmales Paket, eingeschlagen in vergilbtes, mit Rost- und Ölflecken übersätes Zeitungspapier. Ich las:
A reunião aconteceu na Secretar-
– plicou o comandante de Polícia Fe-
– ará, no próximo dia II de Junho, d-
Beim Auswickeln zerfiel das Papier unter meinen Händen und ich hatte den kostbaren Gegenstand in meiner Handfläche. Das erste Mal, dass ich ihn wieder vor Augen hatte, nachdem ich ihn vor achtzehn Jahren auf einem Markt am Rio Solimões erworben hatte. Handgeschmiedet und schön aufbereitet hatte er mich weniger als ein Pfund gekostet.
In der überwachsenen Hecke eines Freundes fand ich einen drei Meter langen, gerade gewachsenen Haselstecken. Mit feiner Schnur band ich die Waffe an den Stock und schärfte mit einem Stein die Spitzen. Das hätte sich erübrigt: Der Dreizack war noch immer spitz wie eine Nadel. Zur besseren Befestigung der Schnur war der Schaft kantig und unbearbeitet geblieben, aber die Spitzen waren rund, poliert und perfekt zugespitzt. Jede hatte vier Widerhaken, die identisch angewinkelt und angeschrägt waren. Das Instrument war für das Harpunieren von Arapaimas geschmiedet worden – Arapaimas zählen zu den größten Süßwasserfischen –, aber ich würde mich auch mit kleinerer Beute zufriedengeben.
Zwei Wochen vergingen, bis ich wieder ans Wasser konnte. Ich paddelte an die Stelle, wo die Plattfische gewesen waren. Aber in dem Ästuar mit seinen beständig wechselnden Sanden gibt es kein »Wo«. Keinen festen Punkt, an den man zurückkehren könnte. Ich suchte vorwärts und rückwärts wie ein Hund, der seine Duftspur verloren hat, zog das Boot auf den Strand, durchwatete die seichten Stellen, überquerte die Kanäle und kreiste in den Tümpeln. Außer den silbrigen Meeräschen, die bei der Annäherung des Kajaks davonjagten, konnte ich nichts entdecken. Die Flundern waren verschwunden; das Plattfisch-Forum war unter einer Sandbank begraben worden.
Drei Jahre, nachdem ich das erste Mal den Fischadler gesehen hatte, wollte ich es wieder versuchen. Am Strand war ein dezenter Trubel: ein Eiswagen, eine Handvoll Autos, ein paar Kinder plantschten und wateten in den schmalen Rinnen, die zwischen den Sandbänken eingeschlossen worden waren, als die Flut den Stöpsel zog. Hinter den Autos bekam ich ein wunderbares Schauspiel zu Gesicht. Eine sehr alte Dame mit einer verspiegelten Skibrille auf der Nase und einer Decke über den Knien fuhr auf ihrem elektrisch betriebenen Rollstuhl volle Kraft voraus. Sand spritzte von den Reifen. Sie schlitterte durch enge Kreise, holperte vorwärts und schleuderte über die von den Autos gegrabenen Furchen. Da schlug noch ein Herz.
Ich blickte über die Flussmündung. Es war tiefste Ebbe. Auf See würde man das Stillwasser nennen, aber hier im Mündungsgebiet gibt es kein stehendes Wasser: das Wasser läuft den ganzen Gezeitenzyklus hindurch in unerwartete Richtungen. Zwei breite Kanäle und ein Netz aus Prielen, manche miteinander verbunden, manche Sackgassen, schneiden durch eine Wüstenei aus Sand. Jenseits des Wassers fiel die Sonne auf die pastellfarbenen Schatten von Drefursennaidd. Die auf der Reede neben dem Hafen ankernden Boote sahen so rosig aus wie Badespielzeug. Auf halber Strecke über dem Ästuar hing ein Wettervorhang: Die Hügel dahinter waren hinter silbernen Regenwänden verborgen. So verhält es sich die meiste Zeit im Jahr: Drefursennaidd bekommt nur halb so viel Regen ab wie Llanaelwyd 15 Kilometer landeinwärts; Llanaelwyd wiederum hat nur mit der Hälfte des Regens zu rechnen, der in Mwrllwch acht Kilometer weiter nördlich fällt.
Ich schnallte den Speer an die Seite des Boots, bastelte mir einen Anker, knotete einen wasserdichten Beutel an eine der Klampen neben der Heckvertiefung, füllte die Taschen meiner Schwimmweste mit einem Messer, einem Notizblock, Polaroids sowie einer Garnrolle und zog das Kajak zu einem Graben, in dem noch ein kleines Rinnsal floss.
In dieser Rille sah es aus, als ob eine Schlacht wütete. Sandgrundeln schossen mit kleinen Rauchwolken, wie aus Artilleriegranaten, davon. Baby-Plattfische ließen Bahnen von Flakfeuer entstehen, wenn ihr Schwanz beim Weghuschen alle paar Zentimeter den Schlamm traf. Schwerbewaffnete Bataillone trudelten seitwärts, Scheren schwenkten sich in meine Richtung. Doch bald war das Wasser tief genug, um das Boot zu tragen, und ich paddelte stromaufwärts los.
Nichts rührte sich. Das Wasser lief in Kräuselwellen vom Kajak weg und schreckte an den Rändern des Kanals riesige Meeräschen auf. Sie pflügten in Halbkreisen durchs Wasser und schossen mit einem plötzlichen Aufspritzen davon. Beringte Regenpfeifer trippelten mit einem seltsam kehligen Trällern am Ufer entlang und segelten mir auf Sichelschwingen voraus. Ich roch den verfaulenden Seetang und hörte die merkwürdige Musik der Wattlandschaft: das Zischen und Knacken Millionen kleiner Geschöpfe, die sich in ihren Röhren bewegen. Auf den Sandbänken lagen die Trümmer von Baumstämmen und Ästen, die die letzten Fluten herangetragen hatten.
Ein Knutt in ziegelrotem Brutgefieder lief über den Sand, senkte seinen Kopf und flog mit einem langgezogenen abfallenden Pfeifen auf. Eine Hummel, die auf dem Oberflächenfilm gefangen war, sendete hektische Barcode-Wellchen aus: sichtbar gemachter Klang. Ich ließ das Paddeln sein und trieb stromaufwärts in das Labyrinth hinein.
Mich den Ästuar hinaufbewegend testete ich immer wieder das Wasser auf seinen Geschmack. War es salzig, bedeutete dies, dass ich in eine Sackgasse trieb, war es süß oder brackig, dass ich einem Kanal folgte, der mit dem Fluss verbunden war. An den meisten Tagen funktionierte das. Es war aber in der letzten Woche so viel Regen gefallen, dass das Wasser fast überall leicht nach Süßwasser schmeckte: Die Gezeiten mussten es hin und her bewegt haben. Ich kenne keine andere Methode, im Labyrinth der Kanäle zu navigieren. Es gibt keine visuellen Anhaltspunkte. Selbst wenn man aus dem Boot aussteigt und auf den Sandbänken steht, sieht man nur die großen Einschnitte. Die Rinnen, die einen halben oder einen Meter tiefer liegen als die aufgewölbte Sandfläche, bleiben unsichtbar, bis man beinahe direkt über ihnen steht.
Ich paddelte blind weiter und gelangte bald in ein Netz von Bayous, mit von Strömungen ausgewaschenen Gräben, die nur durch kleine Rinnsale miteinander verbunden waren. Ich schlüpfte aus dem Boot und begann es durch diese Gerinnsel zu schleppen. Wo immer ich in tieferes Wasser kam, spürte ich Krabben gegen meine Füße stupsen. Sie bewegten sich wie ein Film, dem die meisten Einzelbilder abhanden gekommen waren: Sie tauchten auf, verschwanden, tauchten ein paar Zentimeter weiter wieder auf, schnellten mit so raschen Bewegungen mal da-, mal dorthin, dass man ihnen unmöglich folgen konnte. Auf der Sandbank ließ ein Kormoran seine Flügel trocknen.
Das Wasser war warm und trübe, es hatte die Farbe von dünnem Tee. Der Sand hatte sich in einem Rippelmuster abgelagert, in den Trögen dahinter hatte sich eine Lache dunklen Humus gefangen. Die Rippelkämme formten blasse Halbmonde, so regelmäßig angeordnet wie auf einer Tapete. Bald wurde der Wasserlauf wieder befahrbar, aber jetzt strömte er mir entgegen. Ich arbeitete dagegen an, schmeckte, paddelte, spähte über die Seite. Strandkrabben zogen sich mit ihren orangenen Beinen in den Sand zurück, wenn der Bootsschatten über sie hinwegzog. Dicke Herzmuscheln (cockles) zeigten zwischen ihren leicht aufklaffenden Schalen einen Rüschenrand rosafarbenen Fleisches. Cockle. Das Wort rollte durch meinen Kopf: rund, mit einem Scharnier versehen, sich öffnend und wieder schließend wie das Tier, das es bezeichnete.
Ein Brachvogel überquerte die Gezeitenödnis vor mir und schickte seine traurigen Schleiftöne über das Wasser. Hier im Watt war mir jedes Gefühl für Orientierung und Größenordnung abhandengekommen. Als ich um eine Biegung des Wasserlaufs herumfuhr, war ich verblüfft, zwei Menschen auf der Sandbank stehen zu sehen. Als ich mich ihnen näherte, breiteten sie die Flügel aus und flatterten davon. Am hinteren Rand der Salzmarschen bewegten sich Schafe im Gänsemarsch.
Die sumpfigen Stellen flossen zu einem weiten niedrigen Becken zusammen. Als ich hindurchwatete, spürte ich etwas über meine Füße huschen. Ich drehte mich um und sah einen braunen Diamanten davonschwimmen. Er stoppte ein paar Schritte weiter und grub sich in den Sand. Ich merkte mir die Stelle, band rasch meinen Speer los, entfernte die Korken an seinen Spitzen und ließ das Boot treiben. Dann ging ich an die Stelle, wo sich der Fisch niedergelassen hatte. Eigentlich dürfte er sich nicht fortbewegt haben, denn sonst hätte ich noch Schlammwölkchen im Wasser hängen sehen müssen. Doch er war verschwunden. Ich probierte es an einigen vielversprechenden Aufwölbungen, aber der Speer sank nur in den Sand. Die Flunder war verschwunden wie ein Geist, der durch die Mauer geht. Ich werde mich wohl in der Stelle geirrt haben, dachte ich, und suchte alles ab, der Fisch aber war spurlos verschwunden.
Ich ankerte das Boot, zog meine Schwimmweste und meine Regenjacke aus und zog einen Gegenstand aus der Trockentasche, den man auf einem Kajak nur selten zu sehen bekommt: ein weißes Hemd. Ich hatte ein paar Tage zuvor bemerkt, dass bei den meisten Vögeln, die sich von Fischen ernähren – Möwen, Tölpel, Sturmtaucher, Lummen, Reiher, Fischadler – der Bauch weiß gefärbt ist, was sie gegen den Himmel unsichtbar macht. Ich stakste, den Speer über der Schulter, den Kanal hinauf und versuchte meine großen Füße so ruhig ich konnte ins Wasser zu setzen. Ich muss eine schräge Figur abgegeben haben.
Schon bald schreckte ich einen Plattfisch auf – zu klein, um ihn zu spießen – und sah zu, wie er sich wieder im Schlamm niederließ. Da begriff ich, was zuvor geschehen war. Anstand im Sand einen Buckel aufzuwerfen, schmiegte er sich an einen Rippel und passte sich nicht nur perfekt der Farbe, sondern auch der Form des Bodens an. Selbst wenn ich mich über die Stelle beugte, war der Fisch nicht zu sehen. Er schoss erst davon, als ich fast auf ihn trat.
Mittlerweile hatte ich den Wettervorhang durchquert. Der Wind peitschte das Wasser und der Regen vernarbte seine Oberfläche. Fische auszuspähen wurde noch schwieriger. Ein, zwei ansehnliche Flundern stoben davon, allerdings in tieferes Wasser, wo ich nichts mehr sehen konnte. Ich ging zurück und holte das Boot. Als ich flussaufwärts paddelte, sah ich die großen schlürfenden Mäuler von Meeräschen aus dem Wasser lugen. Ich war zwar versucht, den Speer nach ihnen zu werfen, wusste aber, dass es nichts bringen würde. Schon bald verlandete die Wasserrinne, der ich folgte, in einer Ödnis aus Sand und leeren Muschelschalen. Eine Stunde mindestens würde es dauern, bis die Flut sie wieder mit dem Hauptkanal verbinden würde. Das Wetter verschlechterte sich und so kehrte ich um.
Die Strömung hatte wieder gewechselt: In beiden Richtungen war ich nun gegen die Strömung gefahren. Ich kehrte an die Stelle zurück, an der ich mitten im Watt einen kaputten, verlorengegangenen Hummerkäfig gesehen hatte; jetzt umspülte ihn schon das Meer. Der Wind frischte auf; ich kämpfte gegen Luft und Wasser an. Die Flut zog an mir vorbei und ich wunderte mich über ihren Ordnungssinn. Es gab Kanäle mit Zweigen, die sich über einen Kilometer hinzogen, Bänder mit Seetang, dann eine Drift vollgepackt mit etwas, das ich zunächst für tote Garnelen gehalten hatte. Es waren Millionen: Einen Augenblick hatte ich die Befürchtung, es handele sich um eine Seuche oder um eine Vergiftung. Aber als ich ein paar auflas, sah ich, dass es sich um abgeworfene Hüllen handelte: kleine perfekte Waffenröcke mit einem Handschuh für jeden Pleopod und Fühler. In der Garnelenstraße konnte ich keinen einzigen Zweig, zwischen dem Tang keine einzige Garnelenhülle entdecken; die Strömung hatte für sie jeweils einen andere Rinne ausgesucht.
Eine Woche später versuchte ich es noch einmal, vielleicht das letzte Mal. Ich ließ das Boot am Ausgang des Ästuars ins Wasser. Mein Plan war es, die Flundern auf ihrem Weg aus den Prielen, die in die Flussmündung spülten, abzuschneiden. Hier trafen die schläfrigen Sommerweiden auf vom Wind blankgefegte Flächen. Geschützt hinter Deichen und Böschungen standen die Kühe in den hohen Juliwiesen und wedelten mit dem Schwanz. Zwei Zwergtaucher tauchten, als ich mich annäherte, ins Wasser ab; ein Eisvogel flitzte an der Sandbank entlang.
Ich stieß auf die Mündung eines Bachs, die zwischen Schilfwänden versteckt lag. Dort fuhr ich hindurch, vom raschelnden Dickicht abgeschnitten von anderen Geräuschen und Aussichten. Das Schilf wich wilden Uferböschungen voller Brombeeren, Wasserdost, Flockenblumen und Wicken. An einer Stelle war eine Eiche über das Wasser gefallen. Ich verstaute mein Paddel, legte mich rücklings ins Boot und zog mich unter den Ästen hindurch. Das Wasser war so klar, dass ich durch Luft zu treiben schien. Ich konnte jeden Fleck, jede Faser auf dem Bachgrund erkennen. Kein einziger Fisch kam mir zu Gesicht, aber auch kein anderes Leben war zu sehen: keine Käfer, Wasserläufer, Insektenlarven oder Garnelen. Weder patrouillierten Libellen an den Ufern entlang, noch tanzten Köcherfliegen oder Eintagsfliegen über dem Wasser. Vielleicht war dieser Bach irgendwo durch alte Bleiminen geflossen? Blei ist hier seit römischen Zeiten abgebaut worden und selbst Minen, die schon seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb sind, produzieren noch Ausfällungen, so giftig, dass in dem davon betroffenen Wasser fast nichts überlebt. In einem Dorf in der Nähe meines Wohnorts fließen zwei Bäche zusammen. Der eine wimmelt vor Forellen und Groppen, der andere ist tot. Ein Freund, der in dem Dorf lebt, erzählte mir, dass eines Tages die dort gehaltenen Enten von ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort an dem lebenden Bach in den anderen stromerten und dort für eine Weile gründelten. Später seien alle mit dem Bauch nach oben geschwommen.
Ich glitt den Bach hinab bis zurück in das Ästuar. Als ich um die letzte Biegung des Flüsschens fuhr, schüttelte mich der Wind hin und her. Ich konnte meilenweit über das Wasser bis hinaus aufs Meer sehen. Hier, innerhalb der Wolkenfestung, die die Hügel überschaute, war das Land ocker, oliv- und chromgrün. Jenseits des Wettervorhangs, in der Sonne entlang der Küste, glänzten die Felder, von Düngemitteln aufpoliert, in der Sonne und schienen fast zu fluoreszieren. An der Mündung des Ästuars sah es aus, als trieben die Dünen völlig losgelöst von ihrer Umgebung. Vom Vordergrund durch einen schimmernden silbrigen Streifen getrennt, schwebten sie wie die Insel Laputa aus Gullivers Reisen über dem Watt.
Eine Schar Kanadagänse, die auf der Sandbank ihre Hälse in die Höhe reckten und senkten, flog auf und ließ ein Durcheinander ausgegangener Federn zurück, die nun über das Watt gaukelten. Gänsesägerküken schlugen das Wasser auf, als sie ihrer Mutter nachflatterten, die sie ganz ungalant verlassen hatte und im Mündungstrichter ihre Kreise zog. Die Tide brauste nun nach draußen. Als sie auf den Wind traf, türmte sie sich zu stehenden Wellen auf, in denen das Boot wie auf dem Wasser festgeklebt schien: Ich musste mich nach vorne lehnen und das Paddel fast am Bug einstechen, um überhaupt vorwärtszukommen. Ich fuhr in Wasserläufe hinein, die so eng waren, dass ich umkehren musste, sobald ich auf ein Hindernis stieß. Ich fuhr die Uferbänke des Hauptkanals entlang, starrte ins Wasser und sah nichts als Schlamm und zerbrochene Äste.
Schon bald zog mich die Strömung an den Schlammbänken vorbei ins Leere Viertel, in jene weite Sandfläche, die ich zuvor erkundet hatte. Doch als ich dieses Mal den Hauptkanal entlangfuhr, traf ich auf dick mit Sand und Laub angereicherte Geysire, die völlig unerwartet mitten im Fluss aufstiegen, mitunter mit einer Kraft, dass ich beim Darüberfahren spürte, wie das Boot gestoßen und angehoben wurde. Eine Boje, die in diesem brodelnden Wasser halb untergegangen war, schien wie ein großer von einem Hai gezogener Schwimmer flussaufwärts zu pflügen.
Mit erhobenem Speer driftete ich an einer Sandbank entlang und suchte an den Rändern, wo das Wasser klar war. Die überall sichtbaren, aber kaum zu fangenden Meeräschen stoben davon. Ich störte zwei große Flundern auf, aber beide waren davongewedelt, bevor ich die Harpune werfen konnte. Ein Trupp Austernfischer in schwarzweißen Uniformen, die Flügel eng an die Seiten geklemmt, machte, als ich mich näherte, wie ein einziger Körper kehrt und marschierte über den Sand. Als ich auf dem Wasser die Spiegelung des Speers wahrnahm, überraschte mich ein Gedanke, der mir zuvor noch nicht gekommen war: Ich war dabei, das Kajak wieder seiner ursprünglichen Funktion zuzuführen. Die ihm zugrunde liegende Technologie und sein Name sind – wie Anorak und Parka – von arktischen Völkern entlehnt. So wie ich mit meiner Harpune an den Rändern der Sandbank entlangpirschte, patrouillierten sie die Ränder der Eisschollen. Hier allerdings wären sie verhungert.
Die Einheimischen hatten mir berichtet, Flundern seien einst so zahlreich durch das Mündungsgebiet gezogen, dass man mit Schubkarren ins Wasser gefahren sei und die Fische mit Grabgabeln aufgespießt habe, bis die Karren voll gewesen seien. Nach meinem letzten, zu späten Versuch aber kam mir zu Ohren, dass die Krebsfänger kürzlich damit begonnen hätten, die Flundern unmittelbar vor der Einmündung des Ästuars mit Netzen zu fischen, um sie als Köder zu benutzen. Sie haben sie mehr oder weniger abgeräumt. Wenn die Geschichte stimmt, ist dies eine so verschwenderische und unnötige Praxis (angesichts der Unmengen an totem Fisch samt Köpfen und Gräten, die die Fischereiindustrie wegwirft), dass wir uns offenbar kaum von jenen Tagen entfernt haben, als die englischen Kolonisten in Nordamerika riesige Hummer aus Felsentümpeln klaubten und sie ihren Schweinen zum Fraß vorwarfen. Wir sollten in diesen mageren Zeiten zumindest davon ausgehen, dass alle gefangenen Fische auf den Tellern der Menschen landen.
Ich ließ das Boot auf einer Sandbank zurück und watete einen guten Kilometer über das zerfurchte und gerippte Bett eines leerlaufenden Kanals. Das Wasser hatte sich geklärt: Selbst wo ich bis zur Hüfte im Wasser stand, konnte ich jetzt den Boden sehen. Ich ging schwebenden Schritts, fast schwerelos, über das Flussbett. Kleine Plattfische schnellten aus dem Sand.
Ich pirschte den Kanal aufwärts, den Speer wurfbereit über dem Wasser, und fühlte mich so angriffslustig und zielbewusst wie ein Reiher. Jede einzelne Zelle schien gespannt, wie eine Saite, auf die Welt gestimmt, durch die ich mich bewegte und in den wechselnden Harmonien von Wind und Wasser die richtige Note zu treffen suchte. Meine Konzentration steigerte sich in ein überhöhtes Bewusstsein, sodass ich jedes Körnchen unter meinen nackten Zehen spürte, jedes Wasserkräuseln an meiner Taille, jede Bewegung des Benthos, wie verschwindend klein sie auch sein mochte. Plötzlich war ich weg.
Es ist nicht leicht zu erklären, was geschehen war. Womöglich war es die hypnotisierende Wiederholung der Rippel im Sand, womöglich eine eskalierende Anspannung der Aufmerksamkeit, die mich durch die Barriere der Gegenwart stieß, jedenfalls war ich zu jenem Augenblick von dem Gedanken – dem Wissen – angerührt, dass ich genau dies schon einmal getan hatte.
Außer den beiden bereits angeführten Fischzügen war das aber nicht der Fall gewesen. Ich glaube nicht an Reinkarnation oder das Fortbestehen der Seele, nachdem der Körper gestorben ist. Ich spürte aber, dass ich etwas durchmachte, was ich schon tausend Mal getan hatte; dass ich diese Arbeit so sicher zu tun wusste, wie ich meinen Weg nach Hause fand.
Bereits einmal zuvor hatte ich einen ähnlichen Gefühlsansturm erlebt. Unterwegs in einem Wald in Süd-England sammelte ich Kräuter und Pilze und zwängte mich durch eine dichte Wand von Blättern und Zweigen, als ich neben einem kleinen Bach einen ingwerbraunen Hügel entdeckte. Es war ein Muntjak, einer der bellenden Hirsche aus China, die sich in der Gegend ausgebreitet hatten, seitdem sie im frühen zwanzigsten Jahrhundert vom Duke of Bedford freigelassen worden waren. Das Tier dürfte lediglich ein paar Minuten vor meiner Ankunft gestorben sein. Seine Augen waren noch klar, sein Körper warm. Es war keine Wunde zu sehen, kein Blut. Seine Fänge, die großen gebogenen Reißzähne, mit denen die Böcke sich bekämpfen und Hunde zerreißen können, ragten über den Unterkiefer heraus.
Das war eine Beute von etwas anderer Größenordnung als die, die zu finden ich mich aufgemacht hatte. Und so zögerte ich, als ich die schlanke Röhre des Körpers, das kleine korallenartige Geweih und die winzigen Hufe ansah, einen Moment lang. Doch dann nahm ich das Tier bei den Läufen und lud es mir auf die Schultern.* Der Hirsch schmiegte sich um meinen Nacken und den Rücken, als sei er eigens auf mich zugeschnitten worden; sein Gewicht schien perfekt auf meinen Gelenken zu lasten. Die Wirkung war bemerkenswert. Als ich die Wärme auf meinem Rücken spürte, wollte ich losbrüllen. Meine Haut rötete sich, meine Lungen füllten sich mit Luft. Genau deshalb bist du hier, sagte mein Körper. Genau dazu bin ich geschaffen worden. Die Zivilisation fiel so leicht von mir ab wie ein Bademantel.
In beiden Fällen, so glaube ich – auch wenn ich die Wahrheit einer solchen Vorstellung durch nichts belegen kann –, hat sich bei mir eine genetische Erinnerung bemerkbar gemacht. Während der längsten Zeit, in der der Mensch existierte und in der er noch der natürlichen Auslese unterworfen war, ist er von Imperativen geformt worden – der Notwendigkeit, sich zu ernähren, sich zu verteidigen und zu schützen, sich auszutauschen und zusammenzuarbeiten, Nachwuchs zu zeugen und für seine Kinder zu sorgen –, was dazu führte, dass bestimmte Verhaltensmuster instinktiv wurden. Das Denken mag sie unterdrückt haben, aber wie die angeborene Reaktion, die selbst einen Rentner noch eine anderthalb Meter hohe Mauer überspringen lässt, bevor ein Lastwagen ihn erfasst, entwickelten sie sich, um uns neben den langsameren Prozessen des bewussten Verstands (geformt durch Lernen und Erfahrung) zu leiten. Diese genetischen Erinnerungen – eine Art unbewusster innerer Drang – sind unseren Chromosomen eingeschrieben und bilden eine unauflösliche Komponente unserer Identität.
Manche dieser stereotypen Reaktionen – wie die instinktive Art, in der wir uns um unsere Kinder kümmern – sind noch immer angemessen und notwendig. Andere – wie die Instinkte, die einmal hilfreich waren, um uns und unsere Familien gegen Raubtiere und konkurrierende Clans zu verteidigen – können, einmal entfesselt, in bevölkerungsreichen und technisch aufgerüsteten Gesellschaften zu Katastrophen führen. Wir mussten Eindämmungstechniken erlernen, um unser brüllendes Blut in ruhigere Bahnen zu lenken. Wo uns diese inneren Zwänge vertraut sind, hat uns die Erfahrung gelehrt, sie zu unterdrücken oder umzuleiten. Diese Empfindung jedoch war etwas Neues. Ich hatte sie gar nicht assimilieren können, denn von ihrer Existenz hatte ich – bis ich den Hirsch aufhob – keine Kenntnis gehabt. Sie war überwältigend, roh und wild. Ich wusste nicht, wohin damit; aber ich wusste, dass sie zu mir gehört wie die Sehnen, die mir beim Beugen meiner Finger helfen.
An der walisischen Küste des Severn-Mündungsgebiets haben Archäologen mit Hilfe von Güllepflügen, wie sie auf Bauernhöfen verwendet werden, 8000 Jahre Schlamm abgeräumt, um eine fossile Salzmarschenfläche freizulegen, die so gut erhalten war, dass man beim Anblick von Fotografien der aufgefundenen Fußspuren unwillentlich nach den Tieren und Menschen sucht, die sie hinterlassen haben. Die Ausgrabungen von Goldcliff erzählen eine Geschichte aus einer Welt, die der unseren vorausging, zu der wir aber noch gehören.1
Manche der in lockerem Schlamm hinterlassenen Abdrücke sind groß und verwaschen; andere sauber und scharf. Man kann die Zehenballen sehen und den Schlamm, der zwischen ihnen hindurchquoll: Die Spuren sehen so frisch aus, als seien sie nach der letzten Tide entstanden. An manchen Stellen waren die Menschen gerutscht und geschlittert, die Spuren zeigen nach außen verrutschte Fersen und gespreizte Zehen, um Balance zu halten. Ein Ansammlung von Abdrücken hält einen Jagdzug von heranwachsenden Jungen fest, sie halten an, kehren um, ändern gemeinsam das Tempo. Die Schlammschicht, über die sie laufen, ist von Rothirschfährten gesprenkelt.
Andere Spuren lassen auf eine Schar kleiner Kinder schließen, die im Schlamm herumtollen: Sie rennen in Kreisen, schlittern, treten. An einer anderen Stelle aber bewegten sich die Kinder – unserer Urgroßeltern hoch 300 – systematischer. Sogar Vierjährige haben sich offenkundig schon an der Nahrungssuche beteiligt. »Für uns mag es schwierig nachzuvollziehen sein«, stellen die Archäologen fest, dass so kleine Kinder schon auf Sammeltour gingen, »herrscht doch in der westlichen Welt eher die Einstellung, den Nachwuchs übermäßig zu beschützen.«2 Die Spurenverläufe von Erwachsenen lassen vermuten, dass ihre Verursacher womöglich Vögel jagten oder Fallen leerten.
Die menschlichen Fußabdrücke werden von anderen gekreuzt oder umrundet: von Rothirschen und Rehen und der monströsen vollgelaufenen Spur eines gewaltigen Auerochsen. Zwei Fährten lassen sich sofort zuordnen: Hunde. Doch es sind keine. Hunde des Mesolithikums besaßen die Größe von Collies. Wo sie gehalten wurden, sind die Plätze mit zerkauten Knochen gepflastert. Diese Abdrücke sind zu groß und weder mit menschlichen Spuren noch anderen eindeutigen Hinweisen assoziiert: Die Befundlage lässt auf Wölfe schließen.
Die Spuren allerdings, die mir wirklich Gänsehaut verursachten, gehörten nicht zu den Säugetieren, die noch immer in unseren Alpträumen heulen und bellen, sondern zu einer völlig anderen Kreatur. Über den kleineren Abdrücken von Reihern, Austernfischern und Möwen spreizten sich krähenfußartige, dreizehn Zentimeter große Spuren, die in den versteinerten Schlamm eingekerbt waren wie Maurerzeichen. Die Spuren zeigen, wie die Forscher berichten, dass das Tier, das sie hinterlassen hat, »zur Zeit des Neolithikums ein äußerst häufiger Brutvogel in dem Mündungsgebiet war«. Kraniche. Als ich das las, lehnte ich mich in meinen Stuhl zurück und schloss die Augen. Beinahe konnte ich ihre Kornettrufe über das Watt schallen hören und sie zu hunderten in die Marschen ziehen sehen, mit mantelartig ausgebreiteten Flügeln, die wie Paragleiter schräg in der Luft hingen, wenn sie zur Landung ansetzten.
Diese Tiere – 1,20 Meter groß, mit einer Flügelspannweite von fast zweieinhalb Metern, und, in 4000 Metern ziehend, die am höchsten fliegenden Vögel der Erde –, die wie an Schnüren in der Luft hängen und den Himmel mit Lauten erfüllen, die so klar und ätherisch sind wie die Räume, die sie durchfliegen, die zur Balz, mit Dolchschnabel und Kokardenschwanz gerüstet, ihre Hälse zurückwerfen und tanzen, mit ausgebreiteten Flügeln vom Boden aufhüpfen und langsam, scheinbar so leicht wie Luft herabschweben, bevölkerten einst in Massen die Mündungsgebiete und Sumpflande. Sie lebten in Britannien in so großer Zahl, dass George Neville 1465 bei einem Fest anlässlich seiner Ernennung zum Erzbischof von York 204 davon auftischen ließ.3 Das mag unter anderem erklären, warum sie vor 400 Jahren hier ausgestorben sind. Aber seit 1979 kommen sie langsam zurück. Vom Kontinent kommende Vögel bildeten eine kleine Brutkolonie in Norfolk und ermutigten Naturschützer, sie auch anderswo wieder ansässig zu machen. 2009 wurde eine Gruppe in der Küstenebene Somersets ausgesetzt.4 Sie werden sich gegebenenfalls, wie ihre Mentoren hoffen, durch das Tal des Severn hinauf bis in die Moore und Sümpfe des restlichen Britanniens ausbreiten. Die Ausgrabungen in Goldcliff waren ein gutes Vorzeichen für die erste Phase ihrer Wiederansiedlung.
Zwischen den Fährten fanden die Archäologen die Überreste mesolithischer Mahlzeiten. Knochen von Hirschen, Rehen und Wildschweinen, verkohlt und von Steinäxten gekerbt und die enormen Rippen und Wirbel eines Auerochsen, deren einer von einer Pfeiloder Speerspitze beschädigt war; ein paar Otter- und Entenknochen, verkohlte Haselnüsse, Herzmuscheln und Krebspanzer. Zwei Mikrolithen – die kleinen Steinklingen, die die Spitzen von Speeren und Pfeilen bildeten – waren vom Feuer oxydiert, was nahelegt, dass sie noch in Fleisch steckten, das hier gegart wurde. Aber der weitaus größte Teil der Überreste stammte von Fischen: Lachs, Franzosendorsch, Barsch, Meeräsche, Plattfische und vor allem Aale. Ihre schiere Zahl und die Größe lassen darauf schließen, dass die Menschen sie in flachem Wasser fingen, in mondbeschienenen Sturmnächten um die Tagundnachtgleiche im Herbst, wenn sich die Aale auf ihren bis auf die andere Seite des Atlantiks führenden Wanderzug begaben. Drei angespitzte Pflöcke, die in einem fossilisierten Kanal freigelegt wurden, könnten einst als Stützen für Korbreusen gedient haben.
Ich erinnere mich an solche Bewegungen aus meiner Kindheit: Ich stehe in Norfolk oder in den südlichen Counties am Rand eines klaren Bachs und beobachte eine schwarze Rinne voller Aale, die manchmal eng wie Flechtwerk ineinander verwunden waren und sich ihren Weg bachabwärts wälzten. Heute wäre man glücklich, vielleicht ein halbes Dutzend am Tag zu sehen. Der große Karawanenzug bestand von der Mittelsteinzeit bis in die 1980er Jahre, bevor er zusammenbrach.
Zwischen den über den fossilen Marschen verstreuten Steinklingen, Mahlsteinen und Dechseln, den aus Knochen gefertigten Ahlen und Schabern, den Geweihen, die als Hacken benutzt wurden, befanden sich Artefakte, die an Plätzen dieses Alters nur selten zu finden sind: aus Holz hergestellte Werkzeuge. Die Ausgräber fanden einen Spatel, eine hölzerne Nadel, einen Grabstock. Doch ein Werkzeug faszinierte mich am meisten, ein y-förmiger Stock, der an der Innenseite der Gabel geschmirgelt war, vielleicht mit Sand. Die Forscher sind der Ansicht, das Gerät könnte womöglich dazu gedient haben, im Sediment verborgene Aale zu fangen und am Boden festzuhalten, bis man sie packen konnte. Ich dachte an die Menschen, die mit ihren Zinken die Kanäle entlangstaksten, langsam gingen, damit ihre Bewegungen nicht durch das Wasser fortgepflanzt wurden, ihre Füße in den Sand setzten und das Bachbett nach den unscheinbaren Spuren von Schleim oder den serpentinenartigen Erhebungen absuchten, die auf ihre Beute schließen ließen. Den Stock anheben, ihn der Brechung entsprechend ausrichten und hinabstoßen. Der Aal schlägt um sich, kringelt sich, windet sich nach der Hand, die ihn ergreift. Die Finger graben sich in das schleimige Fleisch hinter den Kiemen, drücken es heraus, schlagen den Schwanz, um die Rückengräte zu brechen, gegen den Pflock. Dann schiebt die Hand eine entrindete Weidenrute durch die Kiemen und zum Maul wieder hinaus und bindet den Aal zu der anderen Beute an den ledernen Riemen, den die Jäger um ihre Hüfte geschlungen haben.
Im Schlamm fanden sich Überreste, die darauf hinweisen, dass diese Menschen auf den Salzmarschen in Tipis kampierten. Eine Struktur mit etwa drei Metern Durchmesser, über deren Pfosten Häute oder Schilf gelegt wurde, hätte vier Menschen beherbergen können. In der Mitte stand ein Herd, an dem sie sich aufwärmten und ihr Essen brieten oder räucherten. Dem Wind und dem Regen an der walisischen Küste ausgesetzt, in dem harschen Klima nach dem Rückzug der Gletscher, müssen sie so zäh gewesen sein wie die Lammkoteletts, die man in Autobahnraststätten vorgesetzt bekommt.
Über das Leben auf den Britischen Inseln im Mesolithikum, in jenen annähernd 6000 Jahren (zwischen 11 000 und 6000 vor unserer Zeit), wissen wir nur wenig, auch deshalb, weil heute ein Großteil des Landes, durch das damals die Menschen streiften, unter Wasser liegt. Am Ende der letzten Eiszeit lag der Meeresspiegel 30 Faden oder 55 Meter tiefer als heute.5 Als das Mesolithikum einsetzte, etwa 4000 Jahre bevor die in Goldcliff entdeckten Lager errichtet wurden, gab es keinen Bristolkanal, keine Cardigan Bay, keine Liverpool Bay. Sogar Lundy Island, die Insel, die das westliche Ende des Bristolkanals markiert, gehörte zum Festland. Doch der Meeresspiegel stieg rasant an. Nachweise für die Besiedlung der Goldcliff-Stätte setzen ein (vor etwa 7000 Jahren), als das Meer das erste Mal an sie heranreicht. Damals lag bereits ein Großteil der Cardigan Bay unter Wasser und der Meeresspiegel stieg weiter, etwa anderthalb Mal so schnell wie heute.
Wie so viele Küstenstriche kennt auch Mittel-Wales einen Atlantis-Mythos, der womöglich in der Ausbreitung des Meeres nach der Eiszeit und dem Untergang von Siedlungen seinen Ursprung haben dürfte, auch wenn er zweifellos durch die mündlichen Erzählungen aktualisiert und schließlich schriftlich festgehalten wurde. Die walisische Erzählung berichtet von den Cantre’r Gwaelod – den Hundert Tieflanden –, die von einem Stammesfürsten namens Gwyddno Garanhir regiert wurden. Durch eine Reihe von Deichen wurden sie vor der See geschützt. Gwyddnos Gefolgsleute hatten die Aufgabe, die Deiche und ihre Sperren und Schleusen in Ordnung zu halten. Einer der Adligen war der notorische Trunkenbold Seithenyn. Er tat Dienst in einer Nacht, in der eine schreckliche Sturmflut wütete – mit vorhersehbaren Konsequenzen. Die Legende will, dass die untergegangenen Glocken von Cantre’r Gwaelod läuten, wenn jemand in Seenot gerät. Ich kann bezeugen, dass diese Story nicht wahr ist: Ich hätte die Glocken oft genug hören müssen.
Der Befund in Goldcliff lässt darauf schließen, dass die Menschen, die hier ihre Spuren hinterlassen haben, nur periodisch auf den Marschen jagten und sammelten, meistens im Sommer und im frühen Herbst. Zusammen mit anderen Prädatoren folgten sie den großen Hirschrudeln und den Auerochsenherden, den Wildschweinrotten und der Abfolge von Fülle und Knappheit, wie sie auch für andere Bereiche der Natur gilt. Offenbar haben sie nur für wenige Wochen hintereinander ihre Lager auf den Salzmarschen aufgeschlagen, wenn die Küstenwälder reich an Wild waren und die Gewässer vor Fischen wimmelten. Aus dem ausgegrabenen Boden ragen große Stümpfe und umgestürzte Eichenstämme. Einige davon weisen über zwölf Meter keine Äste auf. Dies legt nahe, dass hier ein dichter Wald mit hohem Kronendach stand, der bis an die Gezeitenlinie reichte. Im Schlamm finden sich Pollen von Eiche, Birke, Kiefer, Hasel, Ulme, Linde, Erle, Esche und Weide. Die Küste war gesäumt von Schilfflächen, Hochmooren und Erlenbrüchen. Um die Baumwurzeln herum fanden die Archäologen Vorratslager mit Haselnüssen, die von mesolithischen Eichhörnchen gegraben worden waren.
Diese Menschen, spekulieren sie, werden sich neben Wildbret und Fisch von Schilfwurzeln und -sprossen ernährt haben, dem süßen, von Binsen abgesonderten Gummi, von Grassamen und Melde, Rindenbrot aus Birken, von Nüssen, Ahorn, Blättern und wilden Früchten. Funde aus anderen Teilen Britanniens und Europas legen nahe, dass sie ausgehöhlte Einbäume zum Jagen und Sammeln im Mündungsgebiet oder für die Fahrt zu anderen Jagdgebieten entlang der Küste benutzt haben.
Im Spätherbst könnten sie an Strände gewandert sein, wo sich Robben aus dem Wasser hievten, um Nachwuchs zu zeugen: leichte Beute, wenn man sie erwischte, bevor sie ins Wasser plumpsten. Im Winter zogen sie landeinwärts und jagten Zugvögel in den oberen Mündungsgebieten und Tiere in den Wäldern. Die Wachstumsmuster der Herzmuscheln von mesolithischen Muschelhaufen in Nordwales lassen vermuten, dass sie im Frühjahr und im Frühsommer gesammelt wurden. Dann waren sie am fettesten. Die Goldcliff-Menschen dürften das Ästuar hinuntergefahren sein, um sie zu finden. Wenn die Muschelsaison vorbei war, folgten die Jagdverbände den Hirschen in die Berge bis auf die ergrünenden Weidegründe jenseits der Baumlinie. Dann, so sieht es aus, zogen sie zurück an die Küste, um die Fischwanderungen abzupassen. Es wird wahrscheinlich Plätze gegeben haben, an die sie jährlich zurückkehrten, aber einen festen Wohnort hatten sie nicht. Sie zogen mit ihrer Beute und hinterließen mit ihren Wanderungen die Fragmente ihres Daseins: Steinwerkzeuge auf den Gipfeln der Berge, Muschelhaufen an der Meeresküste, Waffen in den Wäldern, aufgeschlagene Knochen, verzierte Kieselsteine und gelegentlich eine Grabstätte. In den fossilierten Marschen in Lydstep in Pembrokeshire sind Archäologen auf das Skelett eines Wildschweins gestoßen, in dem zwei Mikrolithen steckten. Pfeil oder Speer im Rücken, die die Wunde schlugen, stürzte es sich zum Sterben in den Sumpf.6
Noch einmal betrachtete ich die Fußabdrücke, die sich in den Marschen und in der Zeit verloren. Ich hörte den Lärm von im Schlamm spielenden Kindern, sah die angespannten, ernsten Gesichter der Jäger, beobachtete mit meinem inneren Auge die Frauen und Alten, die mit ihren Speeren und Gabeln durch das Mündungsgebiet wateten, und spürte nun besser, wer ich war; woher ich gekommen war; was ich noch bin.
* Ein Tier, das eines natürlichen Todes gestorben ist, aufzulesen und mit nach Hause zu nehmen, ist keine gute Idee: Als ich einen mir bekannten Veterinär fragte, ob ich den Hirsch verspeisen könnte, riet er mir dringend, das Tier zu begraben.